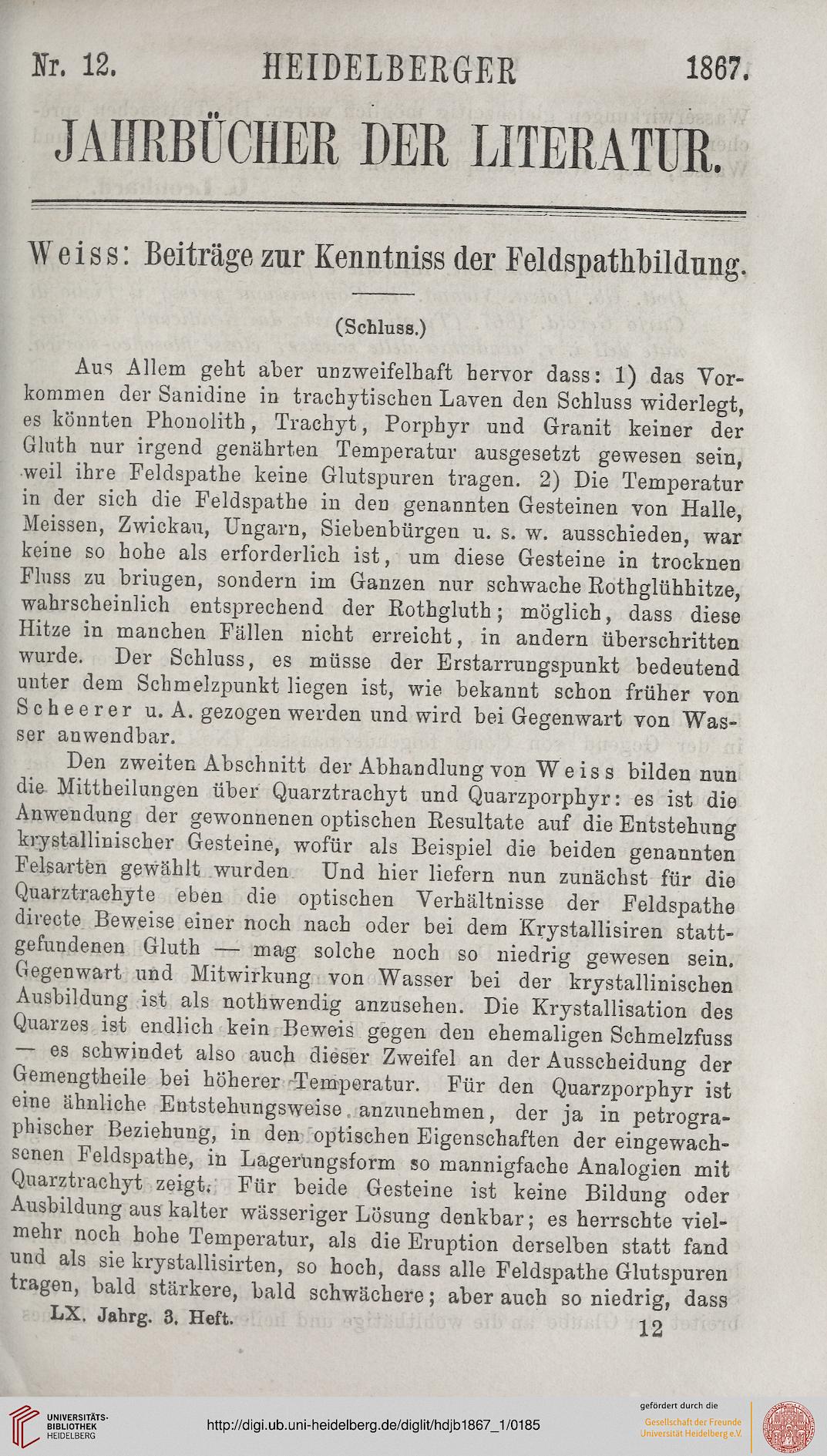Nr. 12. HEIDELBERGER 1867.
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
Weiss: Beiträge zur Kenntniss der Feldspathbildung.
(Schluss.)
Aus Allem geht aber unzweifelhaft hervor dass: 1) das Vor-
kommen der Sanidine in trachytischen Laven den Schluss widerlegt,
es könnten Phonolith, Trachyt, Porphyr und Granit keiner der
Gluth nur irgend genährten Temperatur ausgesetzt gewesen sein,
weil ihre Feldspathe keine Glutspuren tragen. 2) Die Temperatur
in der sich die Feldspathe in den genannten Gesteinen von Halle,
Meissen, Zwickau, Ungarn, Siebenbürgen u. s. w. ausschieden, war
keine so hohe als erforderlich ist, um diese Gesteine in trocknen
Fluss zu briugen, sondern im Ganzen nur schwache Rothglühhitze,
wahrscheinlich entsprechend der Rothgluth; möglich, dass diese
Hitze in manchen Fällen nicht erreicht, in andern überschritten
wurde. Der Schluss, es müsse der Erstarrungspunkt bedeutend
unter dem Schmelzpunkt liegen ist, wie bekannt schon früher von
Scheerer u. A. gezogen werden und wird bei Gegenwart von Was-
ser anwendbar.
Den zweiten Abschnitt der Abhandlung von W e is s bilden nun
die Mittheilungen über Quarztrachyt und Quarzporphyr: es ist die
Anwendung der gewonnenen optischen Resultate auf die Entstehung
krystallinischer Gesteine, wofür als Beispiel die beiden genannten
Felsarten gewählt wurden Und hier liefern nun zunächst für die
Quarztrachyte eben die optischen Verhältnisse der Feldspathe
directe Beweise einer noch nach oder bei dem Krystallisiren statt-
gefundenen Gluth — mag solche noch so niedrig gewesen sein.
Gegenwart und Mitwirkung von Wasser bei der krystallinischen
Ausbildung ist als nothwendig anzusehen. Die Krystallisation des
Quarzes ist endlich kein Beweis gegen den ehemaligen Schmelzfuss
— es schwindet also auch dieser Zweifel an der Ausscheidung der
Gemengtheile bei höherer -Temperatur. Für den Quarzporphyr ist
eine ähnliche Entstehungsweise anzunehmen, der ja in petrogra-
phischer Beziehung, in den optischen Eigenschaften der eingewach-
senen Feldspathe, in Lagerungsform so mannigfache Analogien mit
Quarztrachyt zeigt. Für beide Gesteine ist keine Bildung oder
Ausbildung aus kalter wässeriger Lösung denkbar; es herrschte viel-
mehr noch hohe Temperatur, als die Eruption derselben statt fand
und als sie krystallisirten, so hoch, dass alle Feldspathe Glutspuren
tragen, bald stärkere, bald schwächere; aber auch so niedrig, dass
LX. Jahrg. 3. Heft. 12
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
Weiss: Beiträge zur Kenntniss der Feldspathbildung.
(Schluss.)
Aus Allem geht aber unzweifelhaft hervor dass: 1) das Vor-
kommen der Sanidine in trachytischen Laven den Schluss widerlegt,
es könnten Phonolith, Trachyt, Porphyr und Granit keiner der
Gluth nur irgend genährten Temperatur ausgesetzt gewesen sein,
weil ihre Feldspathe keine Glutspuren tragen. 2) Die Temperatur
in der sich die Feldspathe in den genannten Gesteinen von Halle,
Meissen, Zwickau, Ungarn, Siebenbürgen u. s. w. ausschieden, war
keine so hohe als erforderlich ist, um diese Gesteine in trocknen
Fluss zu briugen, sondern im Ganzen nur schwache Rothglühhitze,
wahrscheinlich entsprechend der Rothgluth; möglich, dass diese
Hitze in manchen Fällen nicht erreicht, in andern überschritten
wurde. Der Schluss, es müsse der Erstarrungspunkt bedeutend
unter dem Schmelzpunkt liegen ist, wie bekannt schon früher von
Scheerer u. A. gezogen werden und wird bei Gegenwart von Was-
ser anwendbar.
Den zweiten Abschnitt der Abhandlung von W e is s bilden nun
die Mittheilungen über Quarztrachyt und Quarzporphyr: es ist die
Anwendung der gewonnenen optischen Resultate auf die Entstehung
krystallinischer Gesteine, wofür als Beispiel die beiden genannten
Felsarten gewählt wurden Und hier liefern nun zunächst für die
Quarztrachyte eben die optischen Verhältnisse der Feldspathe
directe Beweise einer noch nach oder bei dem Krystallisiren statt-
gefundenen Gluth — mag solche noch so niedrig gewesen sein.
Gegenwart und Mitwirkung von Wasser bei der krystallinischen
Ausbildung ist als nothwendig anzusehen. Die Krystallisation des
Quarzes ist endlich kein Beweis gegen den ehemaligen Schmelzfuss
— es schwindet also auch dieser Zweifel an der Ausscheidung der
Gemengtheile bei höherer -Temperatur. Für den Quarzporphyr ist
eine ähnliche Entstehungsweise anzunehmen, der ja in petrogra-
phischer Beziehung, in den optischen Eigenschaften der eingewach-
senen Feldspathe, in Lagerungsform so mannigfache Analogien mit
Quarztrachyt zeigt. Für beide Gesteine ist keine Bildung oder
Ausbildung aus kalter wässeriger Lösung denkbar; es herrschte viel-
mehr noch hohe Temperatur, als die Eruption derselben statt fand
und als sie krystallisirten, so hoch, dass alle Feldspathe Glutspuren
tragen, bald stärkere, bald schwächere; aber auch so niedrig, dass
LX. Jahrg. 3. Heft. 12