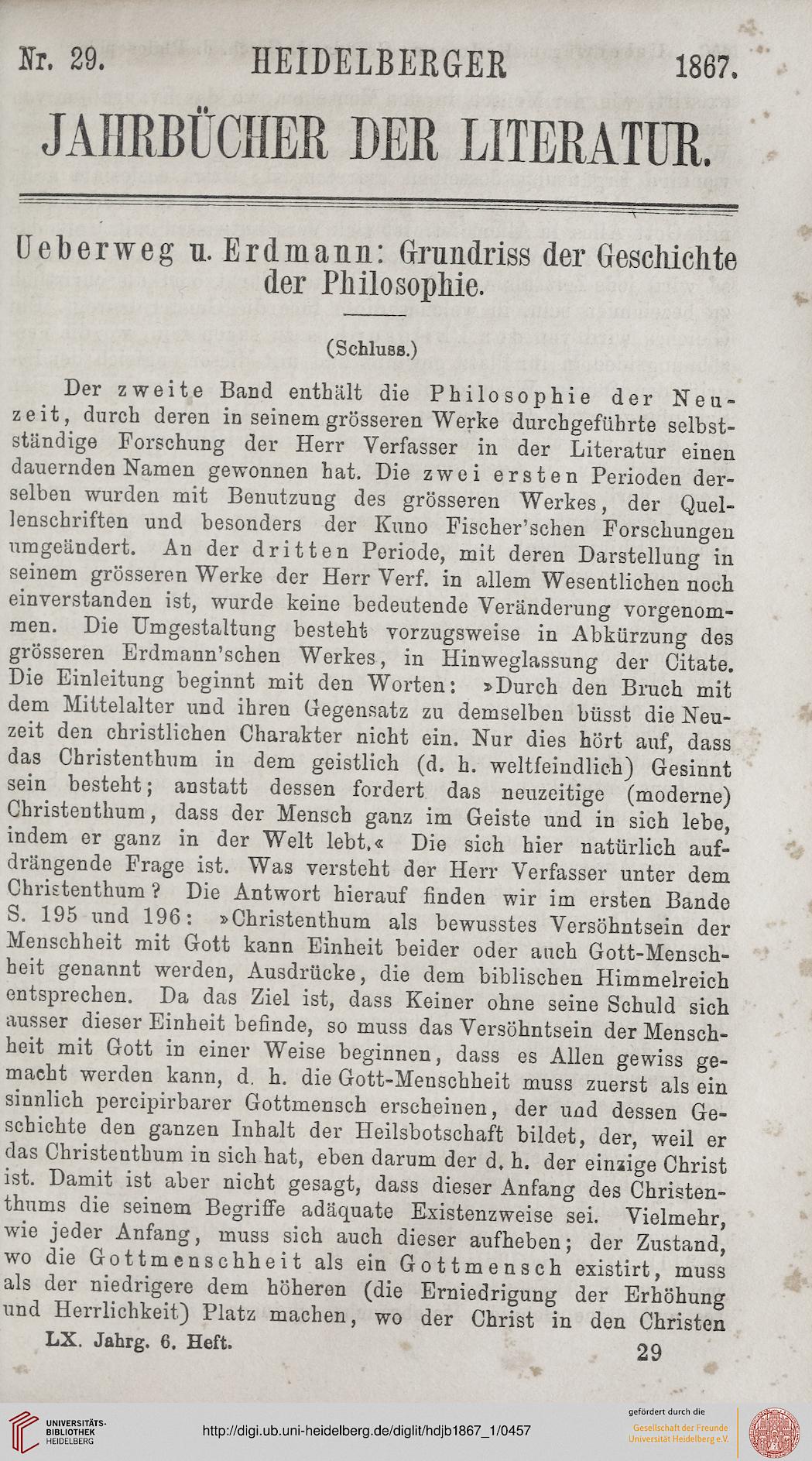Nr. 29. HEIDELBERGER 1867.
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
üeberweg u. Erdmann: Grundriss der Geschichte
der Philosophie.
(Schluss.)
Der zweite Band enthält die Philosophie der Neu-
zeit, durch deren in seinem grösseren Werke durchgeführte selbst-
ständige Forschung der Herr Verfasser in der Literatur einen
dauernden Namen gewonnen hat. Die zwei ersten Perioden der-
selben wurden mit Benutzung des grösseren Werkes, der Quel-
lenschriften und besonders der Kuno Fischer’schen Forschungen
umgeändert. An der dritten Periode, mit deren Darstellung in
seinem grösseren Werke der Herr Verf. in allem Wesentlichen noch
einverstanden ist, wurde keine bedeutende Veränderung vorgenom-
men. Die Umgestaltung besteht vorzugsweise in Abkürzung des
grösseren Erdmann’schen Werkes, in Hinweglassung der Citate.
Die Einleitung beginnt mit den Worten: »Durch den Bruch mit
dem Mittelalter und ihren Gegensatz zu demselben büsst die Neu-
zeit den christlichen Charakter nicht ein. Nur dies hört auf, dass
das Christenthum in dem geistlich (d. h. weltfeindlich) Gesinnt
sein besteht; anstatt dessen fordert das neuzeitige (moderne)
Christenthum, dass der Mensch ganz im Geiste und in sich lebe,
indem er ganz in der Welt lebt.« Die sich hier natürlich auf-
drängende Frage ist. Was versteht der Herr Verfasser unter dem
Christenthum ? Die Antwort hierauf finden wir im ersten Bande
S. 195 und 196: »Christenthum als bewusstes Versöhntsein der
Menschheit mit Gott kann Einheit beider oder auch Gott-Mensch-
heit genannt werden, Ausdrücke, die dem biblischen Himmelreich
entsprechen. Da das Ziel ist, dass Keiner ohne seine Schuld sich
äusser dieser Einheit befinde, so muss das Versöhntsein der Mensch-
heit mit Gott in einer Weise beginnen, dass es Allen gewiss ge-
macht werden kann, d. h. die Gott-Menschheit muss zuerst als ein
sinnlich percipirbarer Gottmensch erscheinen, der und dessen Ge-
schichte den ganzen Inhalt der Heilsbotschaft bildet, der, weil er
das Christenthum in sich hat, eben darum der d. h. der einzige Christ
ist. Damit ist aber nicht gesagt, dass dieser Anfang des Christen-
thums die seinem Begriffe adäquate Existenzweise sei. Vielmehr,
wie jeder Anfang, muss sich auch dieser aufheben; der Zustand,
wo die Gottmenschheit als ein Gottmensch existirt, muss
als der niedrigere dem höheren (die Erniedrigung der Erhöhung
und Herrlichkeit) Platz machen, wo der Christ in den Christen
LX. Jahrg. 6. Heft. 29
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
üeberweg u. Erdmann: Grundriss der Geschichte
der Philosophie.
(Schluss.)
Der zweite Band enthält die Philosophie der Neu-
zeit, durch deren in seinem grösseren Werke durchgeführte selbst-
ständige Forschung der Herr Verfasser in der Literatur einen
dauernden Namen gewonnen hat. Die zwei ersten Perioden der-
selben wurden mit Benutzung des grösseren Werkes, der Quel-
lenschriften und besonders der Kuno Fischer’schen Forschungen
umgeändert. An der dritten Periode, mit deren Darstellung in
seinem grösseren Werke der Herr Verf. in allem Wesentlichen noch
einverstanden ist, wurde keine bedeutende Veränderung vorgenom-
men. Die Umgestaltung besteht vorzugsweise in Abkürzung des
grösseren Erdmann’schen Werkes, in Hinweglassung der Citate.
Die Einleitung beginnt mit den Worten: »Durch den Bruch mit
dem Mittelalter und ihren Gegensatz zu demselben büsst die Neu-
zeit den christlichen Charakter nicht ein. Nur dies hört auf, dass
das Christenthum in dem geistlich (d. h. weltfeindlich) Gesinnt
sein besteht; anstatt dessen fordert das neuzeitige (moderne)
Christenthum, dass der Mensch ganz im Geiste und in sich lebe,
indem er ganz in der Welt lebt.« Die sich hier natürlich auf-
drängende Frage ist. Was versteht der Herr Verfasser unter dem
Christenthum ? Die Antwort hierauf finden wir im ersten Bande
S. 195 und 196: »Christenthum als bewusstes Versöhntsein der
Menschheit mit Gott kann Einheit beider oder auch Gott-Mensch-
heit genannt werden, Ausdrücke, die dem biblischen Himmelreich
entsprechen. Da das Ziel ist, dass Keiner ohne seine Schuld sich
äusser dieser Einheit befinde, so muss das Versöhntsein der Mensch-
heit mit Gott in einer Weise beginnen, dass es Allen gewiss ge-
macht werden kann, d. h. die Gott-Menschheit muss zuerst als ein
sinnlich percipirbarer Gottmensch erscheinen, der und dessen Ge-
schichte den ganzen Inhalt der Heilsbotschaft bildet, der, weil er
das Christenthum in sich hat, eben darum der d. h. der einzige Christ
ist. Damit ist aber nicht gesagt, dass dieser Anfang des Christen-
thums die seinem Begriffe adäquate Existenzweise sei. Vielmehr,
wie jeder Anfang, muss sich auch dieser aufheben; der Zustand,
wo die Gottmenschheit als ein Gottmensch existirt, muss
als der niedrigere dem höheren (die Erniedrigung der Erhöhung
und Herrlichkeit) Platz machen, wo der Christ in den Christen
LX. Jahrg. 6. Heft. 29