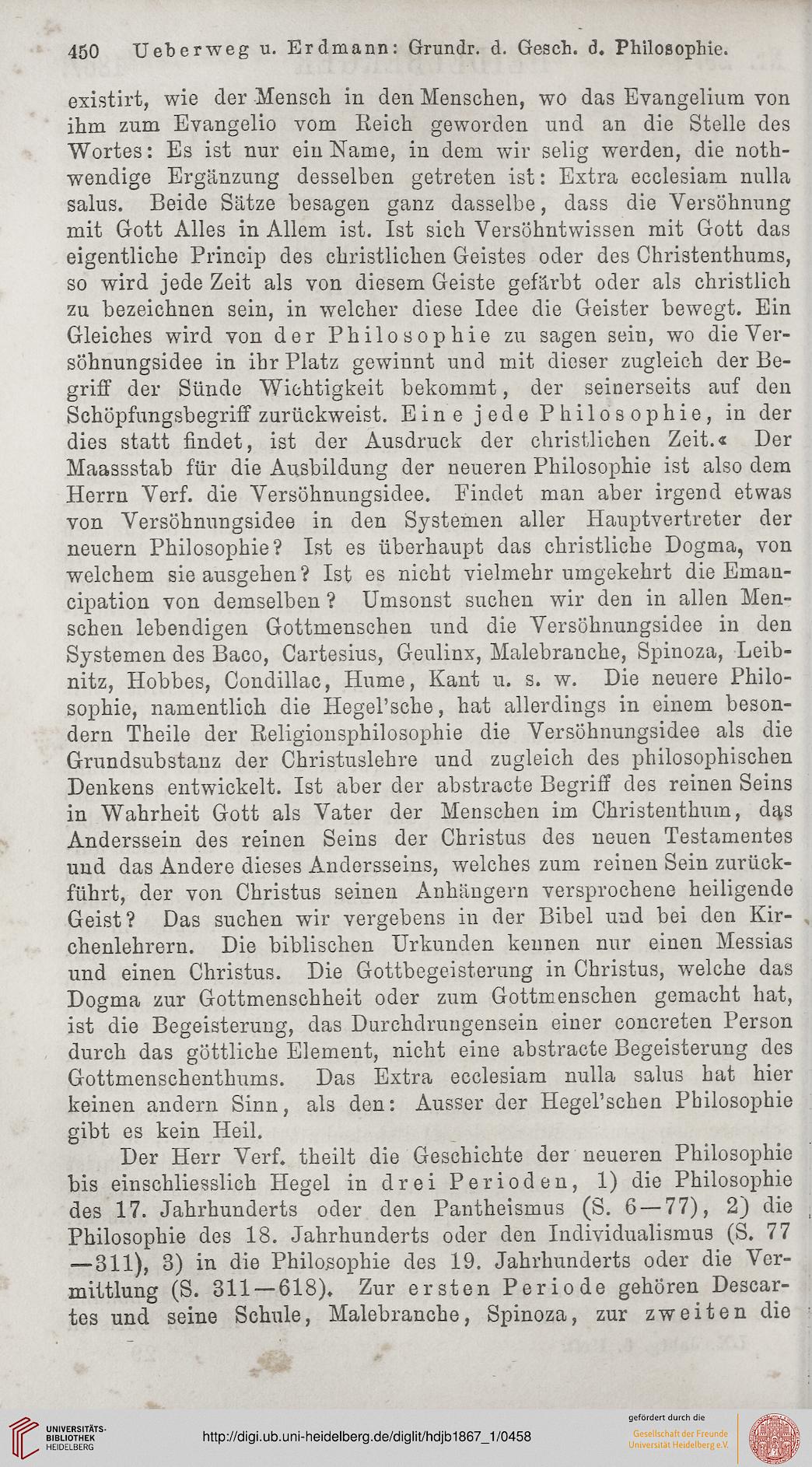450 Geber weg u. Erdmann: Grundr. d. Gesch. d. Philosophie.
existirt, wie der Mensch in den Menschen, wo das Evangelium von
ihm zum Evangelio vom Reich geworden und an die Stelle des
Wortes: Es ist nur ein Name, in dem wir selig werden, die noth-
wendige Ergänzung desselben getreten ist: Extra ecclesiam nulla
salus. Beide Sätze besagen ganz dasselbe, dass die Versöhnung
mit Gott Alles in Allem ist. Ist sich Versöhntwissen mit Gott das
eigentliche Princip des christlichen Geistes oder des Christenthums,
so wird jede Zeit als von diesem Geiste gefärbt oder als christlich
zu bezeichnen sein, in welcher diese Idee die Geister bewegt. Ein
Gleiches wird von der Philosophie zu sagen sein, wo die Ver-
söhnungsidee in ihr Platz gewinnt und mit dieser zugleich der Be-
griff der Sünde Wichtigkeit bekommt, der seinerseits auf den
Schöpfungsbegriff zurückweist. Eine jede Philosophie, in der
dies statt findet, ist der Ausdruck der christlichen Zeit.« Der
Maassstab für die Ausbildung der neueren Philosophie ist also dem
Herrn Verf. die Versöhnungsidee. Findet man aber irgend etwas
von Versöhnungsidee in den Systemen aller Hauptvertreter der
neuern Philosophie? Ist es überhaupt das christliche Dogma, von
welchem sie ausgehen? Ist es nicht vielmehrumgekehrt die Eman-
cipation von demselben ? Umsonst suchen wir den in allen Men-
schen lebendigen Gottmenschen und die Versöhnungsidee in den
Systemen des Baco, Cartesius, Geulinx, Malebranche, Spinoza, Leib-
nitz, Hobbes, Condillac, Hume, Kant u. s. w. Die neuere Philo-
sophie, namentlich die Hegel’sche, hat allerdings in einem beson-
dern Theile der Religionsphilosophie die Versöhnungsidee als die
Grundsubstanz der Christuslehre und zugleich des philosophischen
Denkens entwickelt. Ist aber der abstracte Begriff des reinen Seins
in Wahrheit Gott als Vater der Menschen im Christenthum, d^s
Anderssein des reinen Seins der Christus des neuen Testamentes
und das Andere dieses Andersseins, welches zum reinen Sein zurück-
führt, der von Christus seinen Anhängern versprochene heiligende
Geist? Das suchen wir vergebens in der Bibel und bei den Kir-
chenlehrern. Die biblischen Urkunden kennen nur einen Messias
und einen Christus. Die Gottbegeisterung in Christus, welche das
Dogma zur Gottmenschheit oder zum Gottmenschen gemacht hat,
ist die Begeisterung, das Durchdrungensein einer concreten Person
durch das göttliche Element, nicht eine abstracte Begeisterung des
Gottmenschenthums. Das Extra ecclesiam nulla salus hat hier
keinen andern Sinn, als den: Äusser der Hegel’schen Philosophie
gibt es kein Heil.
Der Herr Verf. theilt die Geschichte der neueren Philosophie
bis einschliesslich Hegel in drei Perioden, 1) die Philosophie
des 17. Jahrhunderts oder den Pantheismus (S. 6 — 77), 2) die
Philosophie des 18. Jahrhunderts oder den Individualismus (S. 77
-—311), 3) in die Philosophie des 19. Jahrhunderts oder die Ver-
mittlung (S. 311 — 618). Zur ersten Periode gehören Descar-
tes und seine Schule, Malebranche, Spinoza, zur zweiten die
existirt, wie der Mensch in den Menschen, wo das Evangelium von
ihm zum Evangelio vom Reich geworden und an die Stelle des
Wortes: Es ist nur ein Name, in dem wir selig werden, die noth-
wendige Ergänzung desselben getreten ist: Extra ecclesiam nulla
salus. Beide Sätze besagen ganz dasselbe, dass die Versöhnung
mit Gott Alles in Allem ist. Ist sich Versöhntwissen mit Gott das
eigentliche Princip des christlichen Geistes oder des Christenthums,
so wird jede Zeit als von diesem Geiste gefärbt oder als christlich
zu bezeichnen sein, in welcher diese Idee die Geister bewegt. Ein
Gleiches wird von der Philosophie zu sagen sein, wo die Ver-
söhnungsidee in ihr Platz gewinnt und mit dieser zugleich der Be-
griff der Sünde Wichtigkeit bekommt, der seinerseits auf den
Schöpfungsbegriff zurückweist. Eine jede Philosophie, in der
dies statt findet, ist der Ausdruck der christlichen Zeit.« Der
Maassstab für die Ausbildung der neueren Philosophie ist also dem
Herrn Verf. die Versöhnungsidee. Findet man aber irgend etwas
von Versöhnungsidee in den Systemen aller Hauptvertreter der
neuern Philosophie? Ist es überhaupt das christliche Dogma, von
welchem sie ausgehen? Ist es nicht vielmehrumgekehrt die Eman-
cipation von demselben ? Umsonst suchen wir den in allen Men-
schen lebendigen Gottmenschen und die Versöhnungsidee in den
Systemen des Baco, Cartesius, Geulinx, Malebranche, Spinoza, Leib-
nitz, Hobbes, Condillac, Hume, Kant u. s. w. Die neuere Philo-
sophie, namentlich die Hegel’sche, hat allerdings in einem beson-
dern Theile der Religionsphilosophie die Versöhnungsidee als die
Grundsubstanz der Christuslehre und zugleich des philosophischen
Denkens entwickelt. Ist aber der abstracte Begriff des reinen Seins
in Wahrheit Gott als Vater der Menschen im Christenthum, d^s
Anderssein des reinen Seins der Christus des neuen Testamentes
und das Andere dieses Andersseins, welches zum reinen Sein zurück-
führt, der von Christus seinen Anhängern versprochene heiligende
Geist? Das suchen wir vergebens in der Bibel und bei den Kir-
chenlehrern. Die biblischen Urkunden kennen nur einen Messias
und einen Christus. Die Gottbegeisterung in Christus, welche das
Dogma zur Gottmenschheit oder zum Gottmenschen gemacht hat,
ist die Begeisterung, das Durchdrungensein einer concreten Person
durch das göttliche Element, nicht eine abstracte Begeisterung des
Gottmenschenthums. Das Extra ecclesiam nulla salus hat hier
keinen andern Sinn, als den: Äusser der Hegel’schen Philosophie
gibt es kein Heil.
Der Herr Verf. theilt die Geschichte der neueren Philosophie
bis einschliesslich Hegel in drei Perioden, 1) die Philosophie
des 17. Jahrhunderts oder den Pantheismus (S. 6 — 77), 2) die
Philosophie des 18. Jahrhunderts oder den Individualismus (S. 77
-—311), 3) in die Philosophie des 19. Jahrhunderts oder die Ver-
mittlung (S. 311 — 618). Zur ersten Periode gehören Descar-
tes und seine Schule, Malebranche, Spinoza, zur zweiten die