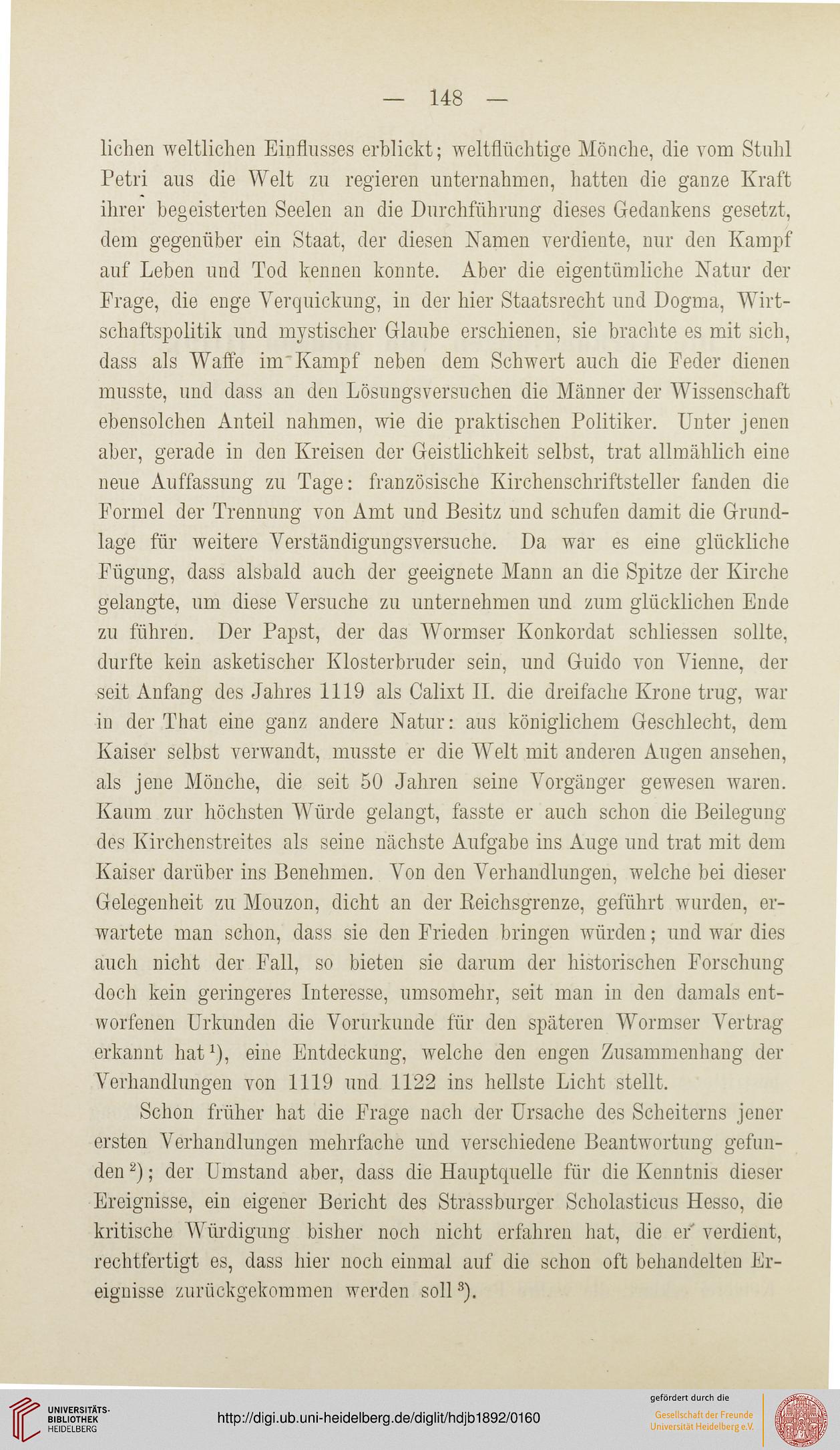148
liehen weltlichen Einflusses erblickt; weltflüchtige Mönche, die vom Stuhl
Petri aus die Welt zu regieren unternahmen, hatten die ganze Kraft
ihrer begeisterten Seelen an die Durchführung dieses Gedankens gesetzt,
dem gegenüber ein Staat, der diesen Kamen verdiente, nur den Kampf
auf Leben und Tod kennen konnte. Aber die eigentümliche Natur der
Frage, die enge Verquickung, in der hier Staatsrecht und Dogma, Wirt-
schaftspolitik und mystischer Glaube erschienen, sie brachte es mit sich,
dass als Waffe im'Kampf neben dein Schwert auch die Feder dienen
musste, und dass an den Lösungsversuchen die Männer der Wissenschaft
ebensolchen Anteil nahmen, wie die praktischen Politiker. Unter jenen
aber, gerade in den Kreisen der Geistlichkeit selbst, trat allmählich eine
neue Auffassung zu Tage: französische Kirchenschriftsteller fanden die
Formel der Trennung von Amt und Besitz und schufen damit die Grund-
lage für weitere Verständigungsversuche. Da war es eine glückliche
Fügung, dass alsbald auch der geeignete Mann an die Spitze der Kirche
gelangte, um diese Versuche zu unternehmen und zum glücklichen Ende
zu führen. Der Papst, der das Wormser Konkordat schliessen sollte,
durfte kein asketischer Klosterbruder sein, und Guido von Vienne, der
seit Anfang des Jahres 1119 als Calixt II. die dreifache Krone trug, war
in der That eine ganz andere Natur: aus königlichem Geschlecht, dem
Kaiser selbst verwandt, musste er die Welt mit anderen Augen ansehen,
als jene Mönche, die seit 50 Jahren seine Vorgänger gewesen waren.
Kaum zur höchsten Würde gelangt, fasste er auch schon die Beilegung
des Kirchenstreites als seine nächste Aufgabe ins Auge und trat mit dem
Kaiser darüber ins Benehmen. Von den Verhandlungen, welche bei dieser
Gelegenheit zu Mouzon, dicht an der Keichsgrenze, geführt wurden, er-
wartete man schon, dass sie den Frieden bringen würden; und war dies
auch nicht der Fall, so bieten sie darum der historischen Forschung
doch kein geringeres Interesse, umsomehr, seit man in den damals ent-
worfenen Urkunden die Vorurkunde für den späteren Wormser Vertrag
erkannt hat1), eine Entdeckung, welche den engen Zusammenhang der
Verhandlungen von 1119 und 1122 ins hellste Licht stellt.
Schon früher hat die Frage nach der Ursache des Scheiterns jener
ersten Verhandlungen mehrfache und verschiedene Beantwortung gefun-
den 2); der Umstand aber, dass die Hauptquelle für die Kenntnis dieser
Ereignisse, ein eigener Bericht des Strassburger Scholasticus Hesso, die
kritische Würdigung bisher noch nicht erfahren hat, die er verdient,
rechtfertigt es, dass hier noch einmal auf die schon oft behandelten Er-
eignisse zurückgekommen werden soll3).
liehen weltlichen Einflusses erblickt; weltflüchtige Mönche, die vom Stuhl
Petri aus die Welt zu regieren unternahmen, hatten die ganze Kraft
ihrer begeisterten Seelen an die Durchführung dieses Gedankens gesetzt,
dem gegenüber ein Staat, der diesen Kamen verdiente, nur den Kampf
auf Leben und Tod kennen konnte. Aber die eigentümliche Natur der
Frage, die enge Verquickung, in der hier Staatsrecht und Dogma, Wirt-
schaftspolitik und mystischer Glaube erschienen, sie brachte es mit sich,
dass als Waffe im'Kampf neben dein Schwert auch die Feder dienen
musste, und dass an den Lösungsversuchen die Männer der Wissenschaft
ebensolchen Anteil nahmen, wie die praktischen Politiker. Unter jenen
aber, gerade in den Kreisen der Geistlichkeit selbst, trat allmählich eine
neue Auffassung zu Tage: französische Kirchenschriftsteller fanden die
Formel der Trennung von Amt und Besitz und schufen damit die Grund-
lage für weitere Verständigungsversuche. Da war es eine glückliche
Fügung, dass alsbald auch der geeignete Mann an die Spitze der Kirche
gelangte, um diese Versuche zu unternehmen und zum glücklichen Ende
zu führen. Der Papst, der das Wormser Konkordat schliessen sollte,
durfte kein asketischer Klosterbruder sein, und Guido von Vienne, der
seit Anfang des Jahres 1119 als Calixt II. die dreifache Krone trug, war
in der That eine ganz andere Natur: aus königlichem Geschlecht, dem
Kaiser selbst verwandt, musste er die Welt mit anderen Augen ansehen,
als jene Mönche, die seit 50 Jahren seine Vorgänger gewesen waren.
Kaum zur höchsten Würde gelangt, fasste er auch schon die Beilegung
des Kirchenstreites als seine nächste Aufgabe ins Auge und trat mit dem
Kaiser darüber ins Benehmen. Von den Verhandlungen, welche bei dieser
Gelegenheit zu Mouzon, dicht an der Keichsgrenze, geführt wurden, er-
wartete man schon, dass sie den Frieden bringen würden; und war dies
auch nicht der Fall, so bieten sie darum der historischen Forschung
doch kein geringeres Interesse, umsomehr, seit man in den damals ent-
worfenen Urkunden die Vorurkunde für den späteren Wormser Vertrag
erkannt hat1), eine Entdeckung, welche den engen Zusammenhang der
Verhandlungen von 1119 und 1122 ins hellste Licht stellt.
Schon früher hat die Frage nach der Ursache des Scheiterns jener
ersten Verhandlungen mehrfache und verschiedene Beantwortung gefun-
den 2); der Umstand aber, dass die Hauptquelle für die Kenntnis dieser
Ereignisse, ein eigener Bericht des Strassburger Scholasticus Hesso, die
kritische Würdigung bisher noch nicht erfahren hat, die er verdient,
rechtfertigt es, dass hier noch einmal auf die schon oft behandelten Er-
eignisse zurückgekommen werden soll3).