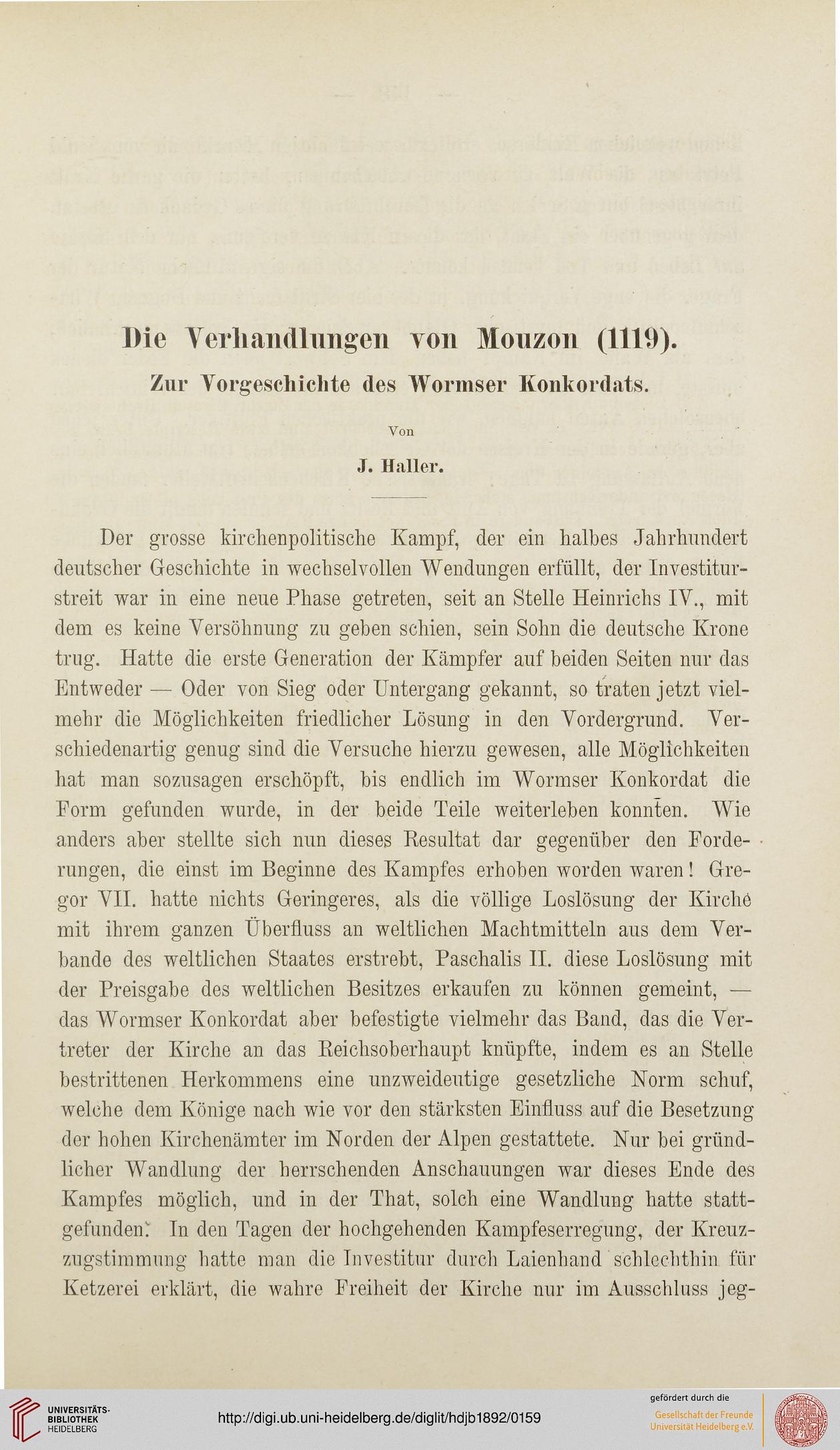Die Verhandlungen von Monzon (1119).
Zur Vorgeschichte des Wormser Konkordats.
Von
J. Haller.
Der grosse kirchenpolitische Kampf, der ein halbes Jahrhundert
deutscher Geschichte in wechselvollen Wendungen erfüllt, der Investitur-
streit war in eine neue Phase getreten, seit an Stelle Heinrichs IV., mit
dem es keine Versöhnung zu geben schien, sein Sohn die deutsche Krone
trug. Hatte die erste Generation der Kämpfer auf beiden Seiten nur das
Entweder — Oder von Sieg oder Untergang gekannt, so traten jetzt viel-
mehr die Möglichkeiten friedlicher Lösung in den Vordergrund. Ver-
schiedenartig genug sind die Versuche hierzu gewesen, alle Möglichkeiten
hat man sozusagen erschöpft, bis endlich im Wormser Konkordat die
Form gefunden wurde, in der beide Teile weiterleben konnten. Wie
anders aber stellte sich nun dieses Resultat dar gegenüber den Forde-
rungen, die einst im Beginne des Kampfes erhoben worden waren! Gre-
gor VII. hatte nichts Geringeres, als die völlige Loslösung der Kirche
mit ihrem ganzen Überfluss an weltlichen Machtmitteln aus dem Ver-
bände des weltlichen Staates erstrebt, Paschalis II. diese Loslösung mit
der Preisgabe des weltlichen Besitzes erkaufen zu können gemeint, —
das Wormser Konkordat aber befestigte vielmehr das Band, das die Ver-
treter der Kirche an das Reichsoberhaupt knüpfte, indem es an Stelle
bestrittenen Herkommens eine unzweideutige gesetzliche Norm schuf,
welche dem Könige nach wie vor den stärksten Einfluss auf die Besetzung
der hohen Kirchenämter im Norden der Alpen gestattete. Nur bei gründ-
licher Wandlung der herrschenden Anschauungen war dieses Ende des
Kampfes möglich, und in der That, solch eine Wandlung hatte statt-
gefunden" In den Tagen der hochgehenden Kampfeserregung, der Kreuz-
zugstimmung hatte man die Investitur durch Laienhand schlechthin, für
Ketzerei erklärt, die wahre Freiheit der Kirche nur im Ausschluss jeg-
Zur Vorgeschichte des Wormser Konkordats.
Von
J. Haller.
Der grosse kirchenpolitische Kampf, der ein halbes Jahrhundert
deutscher Geschichte in wechselvollen Wendungen erfüllt, der Investitur-
streit war in eine neue Phase getreten, seit an Stelle Heinrichs IV., mit
dem es keine Versöhnung zu geben schien, sein Sohn die deutsche Krone
trug. Hatte die erste Generation der Kämpfer auf beiden Seiten nur das
Entweder — Oder von Sieg oder Untergang gekannt, so traten jetzt viel-
mehr die Möglichkeiten friedlicher Lösung in den Vordergrund. Ver-
schiedenartig genug sind die Versuche hierzu gewesen, alle Möglichkeiten
hat man sozusagen erschöpft, bis endlich im Wormser Konkordat die
Form gefunden wurde, in der beide Teile weiterleben konnten. Wie
anders aber stellte sich nun dieses Resultat dar gegenüber den Forde-
rungen, die einst im Beginne des Kampfes erhoben worden waren! Gre-
gor VII. hatte nichts Geringeres, als die völlige Loslösung der Kirche
mit ihrem ganzen Überfluss an weltlichen Machtmitteln aus dem Ver-
bände des weltlichen Staates erstrebt, Paschalis II. diese Loslösung mit
der Preisgabe des weltlichen Besitzes erkaufen zu können gemeint, —
das Wormser Konkordat aber befestigte vielmehr das Band, das die Ver-
treter der Kirche an das Reichsoberhaupt knüpfte, indem es an Stelle
bestrittenen Herkommens eine unzweideutige gesetzliche Norm schuf,
welche dem Könige nach wie vor den stärksten Einfluss auf die Besetzung
der hohen Kirchenämter im Norden der Alpen gestattete. Nur bei gründ-
licher Wandlung der herrschenden Anschauungen war dieses Ende des
Kampfes möglich, und in der That, solch eine Wandlung hatte statt-
gefunden" In den Tagen der hochgehenden Kampfeserregung, der Kreuz-
zugstimmung hatte man die Investitur durch Laienhand schlechthin, für
Ketzerei erklärt, die wahre Freiheit der Kirche nur im Ausschluss jeg-