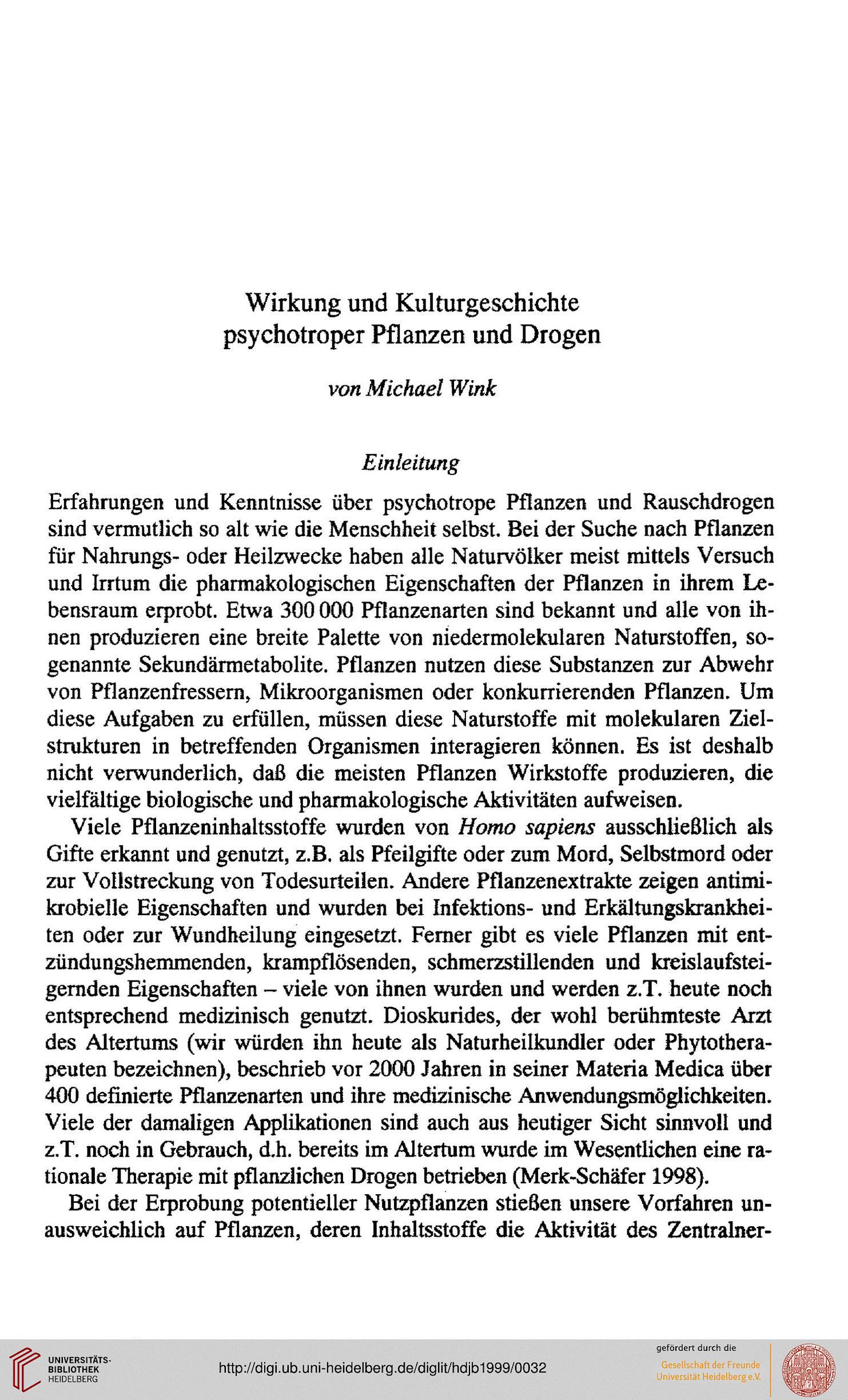Wirkung und Kulturgeschichte
psychotroper Pflanzen und Drogen
von Michael Wink
Einleitung
Erfahrungen und Kenntnisse über psychotrope Pflanzen und Rauschdrogen
sind vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Bei der Suche nach Pflanzen
für Nahrungs- oder Heilzwecke haben alle Naturvölker meist mittels Versuch
und Irrtum die pharmakologischen Eigenschaften der Pflanzen in ihrem Le-
bensraum erprobt. Etwa 300 000 Pflanzenarten sind bekannt und alle von ih-
nen produzieren eine breite Palette von niedermolekularen Naturstoffen, so-
genannte Sekundärmetabolite. Pflanzen nutzen diese Substanzen zur Abwehr
von Pflanzenfressern, Mikroorganismen oder konkurrierenden Pflanzen. Um
diese Aufgaben zu erfüllen, müssen diese Naturstoffe mit molekularen Ziel-
strukturen in betreffenden Organismen interagieren können. Es ist deshalb
nicht verwunderlich, daß die meisten Pflanzen Wirkstoffe produzieren, die
vielfältige biologische und pharmakologische Aktivitäten aufweisen.
Viele Pflanzeninhaltsstoffe wurden von Homo sapiens ausschließlich als
Gifte erkannt und genutzt, z.B. als Pfeilgifte oder zum Mord, Selbstmord oder
zur Vollstreckung von Todesurteilen. Andere Pflanzenextrakte zeigen antimi-
krobielle Eigenschaften und wurden bei Infektions- und Erkältungskrankhei-
ten oder zur Wundheilung eingesetzt. Ferner gibt es viele Pflanzen mit ent-
zündungshemmenden, krampflösenden, schmerzstillenden und kreislaufstei-
gernden Eigenschaften - viele von ihnen wurden und werden z.T. heute noch
entsprechend medizinisch genutzt. Dioskurides, der wohl berühmteste Arzt
des Altertums (wir würden ihn heute als Narurheilkundler oder Phytothera-
peuten bezeichnen), beschrieb vor 2000 Jahren in seiner Materia Medica über
400 definierte Pflanzenarten und ihre medizinische Anwendungsmöglichkeiten.
Viele der damaligen Applikationen sind auch aus heutiger Sicht sinnvoll und
z.T. noch in Gebrauch, d.h. bereits im Altertum wurde im Wesentlichen eine ra-
tionale Therapie mit pflanzlichen Drogen betrieben (Merk-Schäfer 1998).
Bei der Erprobung potentieller Nutzpflanzen stießen unsere Vorfahren un-
ausweichlich auf Pflanzen, deren Inhaltsstoffe die Aktivität des Zentralner-
psychotroper Pflanzen und Drogen
von Michael Wink
Einleitung
Erfahrungen und Kenntnisse über psychotrope Pflanzen und Rauschdrogen
sind vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Bei der Suche nach Pflanzen
für Nahrungs- oder Heilzwecke haben alle Naturvölker meist mittels Versuch
und Irrtum die pharmakologischen Eigenschaften der Pflanzen in ihrem Le-
bensraum erprobt. Etwa 300 000 Pflanzenarten sind bekannt und alle von ih-
nen produzieren eine breite Palette von niedermolekularen Naturstoffen, so-
genannte Sekundärmetabolite. Pflanzen nutzen diese Substanzen zur Abwehr
von Pflanzenfressern, Mikroorganismen oder konkurrierenden Pflanzen. Um
diese Aufgaben zu erfüllen, müssen diese Naturstoffe mit molekularen Ziel-
strukturen in betreffenden Organismen interagieren können. Es ist deshalb
nicht verwunderlich, daß die meisten Pflanzen Wirkstoffe produzieren, die
vielfältige biologische und pharmakologische Aktivitäten aufweisen.
Viele Pflanzeninhaltsstoffe wurden von Homo sapiens ausschließlich als
Gifte erkannt und genutzt, z.B. als Pfeilgifte oder zum Mord, Selbstmord oder
zur Vollstreckung von Todesurteilen. Andere Pflanzenextrakte zeigen antimi-
krobielle Eigenschaften und wurden bei Infektions- und Erkältungskrankhei-
ten oder zur Wundheilung eingesetzt. Ferner gibt es viele Pflanzen mit ent-
zündungshemmenden, krampflösenden, schmerzstillenden und kreislaufstei-
gernden Eigenschaften - viele von ihnen wurden und werden z.T. heute noch
entsprechend medizinisch genutzt. Dioskurides, der wohl berühmteste Arzt
des Altertums (wir würden ihn heute als Narurheilkundler oder Phytothera-
peuten bezeichnen), beschrieb vor 2000 Jahren in seiner Materia Medica über
400 definierte Pflanzenarten und ihre medizinische Anwendungsmöglichkeiten.
Viele der damaligen Applikationen sind auch aus heutiger Sicht sinnvoll und
z.T. noch in Gebrauch, d.h. bereits im Altertum wurde im Wesentlichen eine ra-
tionale Therapie mit pflanzlichen Drogen betrieben (Merk-Schäfer 1998).
Bei der Erprobung potentieller Nutzpflanzen stießen unsere Vorfahren un-
ausweichlich auf Pflanzen, deren Inhaltsstoffe die Aktivität des Zentralner-