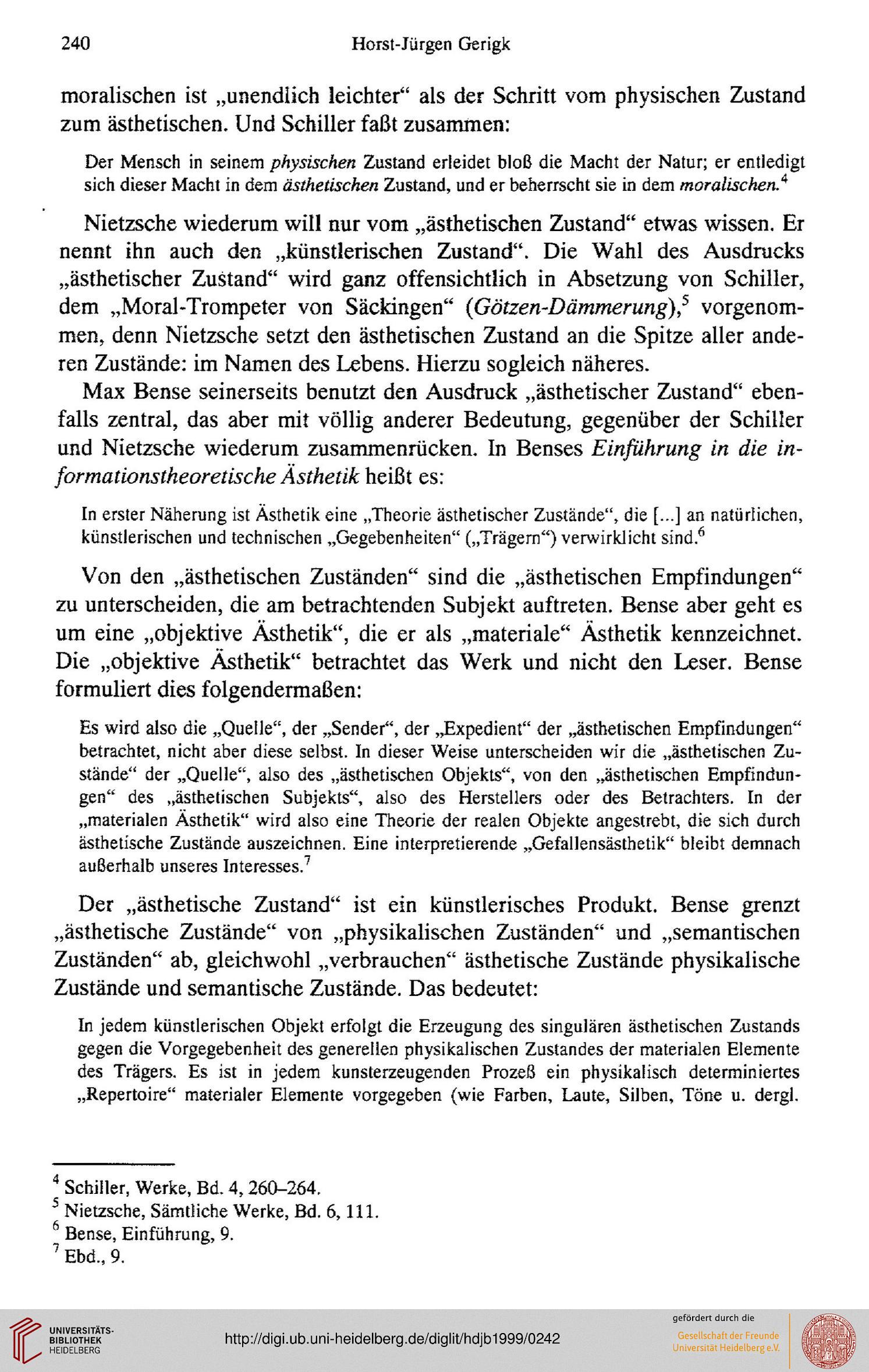240 Horst-Jürgen Gerigk
moralischen ist „unendlich leichter" als der Schritt vom physischen Zustand
zum ästhetischen. Und Schiller faßt zusammen:
Der Mensch in seinem physischen Zustand erleidet bloß die Macht der Natur; er entledigt
sich dieser Macht in dem ästhetischen Zustand, und er beherrscht sie in dem moralischen.4
Nietzsche wiederum will nur vom „ästhetischen Zustand" etwas wissen. Er
nennt ihn auch den „künstlerischen Zustand". Die Wahl des Ausdrucks
„ästhetischer Zustand" wird ganz offensichtlich in Absetzung von Schiller,
dem „Moral-Trompeter von Säckingen" (Götzen-Dämmerung),5 vorgenom-
men, denn Nietzsche setzt den ästhetischen Zustand an die Spitze aller ande-
ren Zustände: im Namen des Lebens. Hierzu sogleich näheres.
Max Bense seinerseits benutzt den Ausdruck „ästhetischer Zustand" eben-
falls zentral, das aber mit völlig anderer Bedeutung, gegenüber der Schiller
und Nietzsche wiederum zusammenrücken. In Benses Einführung in die in-
formationstheoretische Ästhetik heißt es:
In erster Näherung ist Ästhetik eine „Theorie ästhetischer Zustände", die [...] an natürlichen,
künstlerischen und technischen „Gegebenheiten" („Trägern") verwirklicht sind.6
Von den „ästhetischen Zuständen" sind die „ästhetischen Empfindungen"
zu unterscheiden, die am betrachtenden Subjekt auftreten. Bense aber geht es
um eine „objektive Ästhetik", die er als „materiale" Ästhetik kennzeichnet.
Die „objektive Ästhetik" betrachtet das Werk und nicht den Leser. Bense
formuliert dies folgendermaßen:
Es wird also die „Quelle", der „Sender", der „Expedient" der „ästhetischen Empfindungen"
betrachtet, nicht aber diese selbst. In dieser Weise unterscheiden wir die „ästhetischen Zu-
stände" der „Quelle", also des „ästhetischen Objekts", von den „ästhetischen Empfindun-
gen" des „ästhetischen Subjekts", also des Herstellers oder des Betrachters. In der
„materialen Ästhetik" wird also eine Theorie der realen Objekte angestrebt, die sich durch
ästhetische Zustände auszeichnen. Eine interpretierende „Gefallensästhetik" bleibt demnach
außerhalb unseres Interesses.7
Der „ästhetische Zustand" ist ein künstlerisches Produkt. Bense grenzt
„ästhetische Zustände" von „physikalischen Zuständen" und „semantischen
Zuständen" ab, gleichwohl „verbrauchen" ästhetische Zustände physikalische
Zustände und semantische Zustände. Das bedeutet:
In jedem künstlerischen Objekt erfolgt die Erzeugung des singulären ästhetischen Zustands
gegen die Vorgegebenheit des generellen physikalischen Zustandes der materialen Elemente
des Trägers. Es ist in jedem kunsterzeugenden Prozeß ein physikalisch determiniertes
„Repertoire" materialer Elemente vorgegeben (wie Farben, Laute, Silben, Töne u. dergl.
* Schiller, Werke, Bd. 4,260-264.
5 Nietzsche, Sämtliche Werke, Bd. 6,111.
Bense, Einführung, 9.
7 Ebd., 9.
moralischen ist „unendlich leichter" als der Schritt vom physischen Zustand
zum ästhetischen. Und Schiller faßt zusammen:
Der Mensch in seinem physischen Zustand erleidet bloß die Macht der Natur; er entledigt
sich dieser Macht in dem ästhetischen Zustand, und er beherrscht sie in dem moralischen.4
Nietzsche wiederum will nur vom „ästhetischen Zustand" etwas wissen. Er
nennt ihn auch den „künstlerischen Zustand". Die Wahl des Ausdrucks
„ästhetischer Zustand" wird ganz offensichtlich in Absetzung von Schiller,
dem „Moral-Trompeter von Säckingen" (Götzen-Dämmerung),5 vorgenom-
men, denn Nietzsche setzt den ästhetischen Zustand an die Spitze aller ande-
ren Zustände: im Namen des Lebens. Hierzu sogleich näheres.
Max Bense seinerseits benutzt den Ausdruck „ästhetischer Zustand" eben-
falls zentral, das aber mit völlig anderer Bedeutung, gegenüber der Schiller
und Nietzsche wiederum zusammenrücken. In Benses Einführung in die in-
formationstheoretische Ästhetik heißt es:
In erster Näherung ist Ästhetik eine „Theorie ästhetischer Zustände", die [...] an natürlichen,
künstlerischen und technischen „Gegebenheiten" („Trägern") verwirklicht sind.6
Von den „ästhetischen Zuständen" sind die „ästhetischen Empfindungen"
zu unterscheiden, die am betrachtenden Subjekt auftreten. Bense aber geht es
um eine „objektive Ästhetik", die er als „materiale" Ästhetik kennzeichnet.
Die „objektive Ästhetik" betrachtet das Werk und nicht den Leser. Bense
formuliert dies folgendermaßen:
Es wird also die „Quelle", der „Sender", der „Expedient" der „ästhetischen Empfindungen"
betrachtet, nicht aber diese selbst. In dieser Weise unterscheiden wir die „ästhetischen Zu-
stände" der „Quelle", also des „ästhetischen Objekts", von den „ästhetischen Empfindun-
gen" des „ästhetischen Subjekts", also des Herstellers oder des Betrachters. In der
„materialen Ästhetik" wird also eine Theorie der realen Objekte angestrebt, die sich durch
ästhetische Zustände auszeichnen. Eine interpretierende „Gefallensästhetik" bleibt demnach
außerhalb unseres Interesses.7
Der „ästhetische Zustand" ist ein künstlerisches Produkt. Bense grenzt
„ästhetische Zustände" von „physikalischen Zuständen" und „semantischen
Zuständen" ab, gleichwohl „verbrauchen" ästhetische Zustände physikalische
Zustände und semantische Zustände. Das bedeutet:
In jedem künstlerischen Objekt erfolgt die Erzeugung des singulären ästhetischen Zustands
gegen die Vorgegebenheit des generellen physikalischen Zustandes der materialen Elemente
des Trägers. Es ist in jedem kunsterzeugenden Prozeß ein physikalisch determiniertes
„Repertoire" materialer Elemente vorgegeben (wie Farben, Laute, Silben, Töne u. dergl.
* Schiller, Werke, Bd. 4,260-264.
5 Nietzsche, Sämtliche Werke, Bd. 6,111.
Bense, Einführung, 9.
7 Ebd., 9.