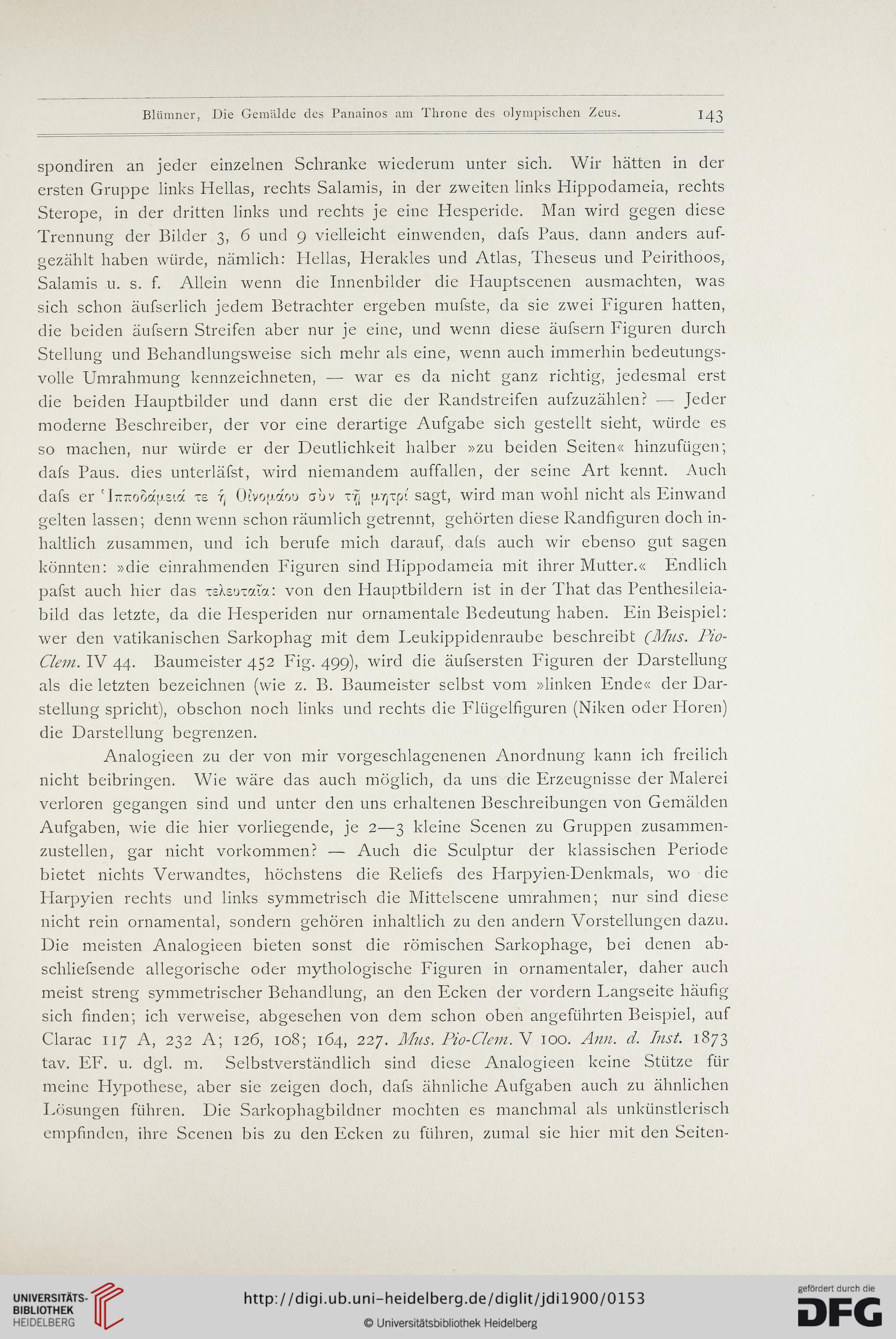Blümner, Die Gemälde des Panainos am Throne des olympischen Zeus.
143
spondiren an jeder einzelnen Schranke wiederum unter sich. Wir hätten in der
ersten Gruppe links Hellas, rechts Salamis, in der zweiten links Hippodameia, rechts
Sterope, in der dritten links und rechts je eine Hesperide. Man wird gegen diese
Trennung der Bilder 3, 6 und 9 vielleicht einwenden, dafs Paus, dann anders auf-
gezählt haben würde, nämlich: Hellas, Herakles und Atlas, Theseus und Peirithoos,
Salamis u. s. f. Allein wenn die Innenbilder die Hauptscenen ausmachten, was
sich schon äufserlich jedem Betrachter ergeben mufste, da sie zwei Figuren hatten,
die beiden äufsern Streifen aber nur je eine, und wenn diese äufsern Figuren durch
Stellung und Behandlungsweise sich mehr als eine, wenn auch immerhin bedeutungs-
volle Umrahmung kennzeichneten, — war es da nicht ganz richtig, jedesmal erst
die beiden Hauptbilder und dann erst die der Randstreifen aufzuzählen? — Jeder
moderne Beschreiber, der vor eine derartige Aufgabe sich gestellt sieht, würde es
so machen, nur würde er der Deutlichkeit halber »zu beiden Seiten« hinzufügen;
dafs Paus, dies unterläfst, wird niemandem auffallen, der seine Art kennt. Auch
dafs er 'iTntoSapsia xs 4 Oivopaou auv r(j [xyjxpt sagt, wird man wohl nicht als Einwand
gelten lassen; denn wenn schon räumlich getrennt, gehörten diese Randfiguren doch in-
haltlich zusammen, und ich berufe mich darauf, dafs auch wir ebenso gut sagen
könnten: »die einrahmenden Figuren sind Hippodameia mit ihrer Mutter.« Endlich
pafst auch hier das xAsuxata: von den Hauptbildern ist in der That das Penthesileia-
bild das letzte, da die Hesperiden nur ornamentale Bedeutung haben. Ein Beispiel:
wer den vatikanischen Sarkophag mit dem Eeukippidenraube beschreibt (Mus. Pio-
Clem. IV 44. Baumeister 452 Fig. 499), wird die äufsersten Figuren der Darstellung
als die letzten bezeichnen (wie z. B. Baumeister selbst vom »linken Ende« der Dar-
stellung spricht), obschon noch links und rechts die Flügelfiguren (Niken oder Horen)
die Darstellung begrenzen.
Analogieen zu der von mir vorgeschlagenenen Anordnung kann ich freilich
nicht beibringen. Wie wäre das auch möglich, da uns die Erzeugnisse der Malerei
verloren gegangen sind und unter den uns erhaltenen Beschreibungen von Gemälden
Aufgaben, wie die hier vorliegende, je 2—3 kleine Scenen zu Gruppen zusammen-
zustellen, gar nicht Vorkommen? — Auch die Sculptur der klassischen Periode
bietet nichts Verwandtes, höchstens die Reliefs des Harpyien-Denkmals, wo die
Harpyien rechts und links symmetrisch die Mittelscene umrahmen; nur sind diese
nicht rein ornamental, sondern gehören inhaltlich zu den andern Vorstellungen dazu.
Die meisten Analogieen bieten sonst die römischen Sarkophage, bei denen ab-
schliefsende allegorische oder mythologische Figuren in ornamentaler, daher auch
meist streng symmetrischer Behandlung, an den Ecken der vordem Langseite häufig
sich finden; ich verweise, abgesehen von dem schon oben angeführten Beispiel, auf
Clarac 117 A, 232 A; 126, 108; 164, 227. Mus. Pio-Clem. V 100. Ann. d. Inst. 1873
tav. EF. u. dgl. m. Selbstverständlich sind diese Analogieen keine Stütze für
meine Hypothese, aber sie zeigen doch, dafs ähnliche Aufgaben auch zu ähnlichen
Lösungen führen. Die Sarkophagbildner mochten es manchmal als unkünstlerisch
empfinden, ihre Scenen bis zu den Ecken zu führen, zumal sie hier mit den Seiten-
143
spondiren an jeder einzelnen Schranke wiederum unter sich. Wir hätten in der
ersten Gruppe links Hellas, rechts Salamis, in der zweiten links Hippodameia, rechts
Sterope, in der dritten links und rechts je eine Hesperide. Man wird gegen diese
Trennung der Bilder 3, 6 und 9 vielleicht einwenden, dafs Paus, dann anders auf-
gezählt haben würde, nämlich: Hellas, Herakles und Atlas, Theseus und Peirithoos,
Salamis u. s. f. Allein wenn die Innenbilder die Hauptscenen ausmachten, was
sich schon äufserlich jedem Betrachter ergeben mufste, da sie zwei Figuren hatten,
die beiden äufsern Streifen aber nur je eine, und wenn diese äufsern Figuren durch
Stellung und Behandlungsweise sich mehr als eine, wenn auch immerhin bedeutungs-
volle Umrahmung kennzeichneten, — war es da nicht ganz richtig, jedesmal erst
die beiden Hauptbilder und dann erst die der Randstreifen aufzuzählen? — Jeder
moderne Beschreiber, der vor eine derartige Aufgabe sich gestellt sieht, würde es
so machen, nur würde er der Deutlichkeit halber »zu beiden Seiten« hinzufügen;
dafs Paus, dies unterläfst, wird niemandem auffallen, der seine Art kennt. Auch
dafs er 'iTntoSapsia xs 4 Oivopaou auv r(j [xyjxpt sagt, wird man wohl nicht als Einwand
gelten lassen; denn wenn schon räumlich getrennt, gehörten diese Randfiguren doch in-
haltlich zusammen, und ich berufe mich darauf, dafs auch wir ebenso gut sagen
könnten: »die einrahmenden Figuren sind Hippodameia mit ihrer Mutter.« Endlich
pafst auch hier das xAsuxata: von den Hauptbildern ist in der That das Penthesileia-
bild das letzte, da die Hesperiden nur ornamentale Bedeutung haben. Ein Beispiel:
wer den vatikanischen Sarkophag mit dem Eeukippidenraube beschreibt (Mus. Pio-
Clem. IV 44. Baumeister 452 Fig. 499), wird die äufsersten Figuren der Darstellung
als die letzten bezeichnen (wie z. B. Baumeister selbst vom »linken Ende« der Dar-
stellung spricht), obschon noch links und rechts die Flügelfiguren (Niken oder Horen)
die Darstellung begrenzen.
Analogieen zu der von mir vorgeschlagenenen Anordnung kann ich freilich
nicht beibringen. Wie wäre das auch möglich, da uns die Erzeugnisse der Malerei
verloren gegangen sind und unter den uns erhaltenen Beschreibungen von Gemälden
Aufgaben, wie die hier vorliegende, je 2—3 kleine Scenen zu Gruppen zusammen-
zustellen, gar nicht Vorkommen? — Auch die Sculptur der klassischen Periode
bietet nichts Verwandtes, höchstens die Reliefs des Harpyien-Denkmals, wo die
Harpyien rechts und links symmetrisch die Mittelscene umrahmen; nur sind diese
nicht rein ornamental, sondern gehören inhaltlich zu den andern Vorstellungen dazu.
Die meisten Analogieen bieten sonst die römischen Sarkophage, bei denen ab-
schliefsende allegorische oder mythologische Figuren in ornamentaler, daher auch
meist streng symmetrischer Behandlung, an den Ecken der vordem Langseite häufig
sich finden; ich verweise, abgesehen von dem schon oben angeführten Beispiel, auf
Clarac 117 A, 232 A; 126, 108; 164, 227. Mus. Pio-Clem. V 100. Ann. d. Inst. 1873
tav. EF. u. dgl. m. Selbstverständlich sind diese Analogieen keine Stütze für
meine Hypothese, aber sie zeigen doch, dafs ähnliche Aufgaben auch zu ähnlichen
Lösungen führen. Die Sarkophagbildner mochten es manchmal als unkünstlerisch
empfinden, ihre Scenen bis zu den Ecken zu führen, zumal sie hier mit den Seiten-