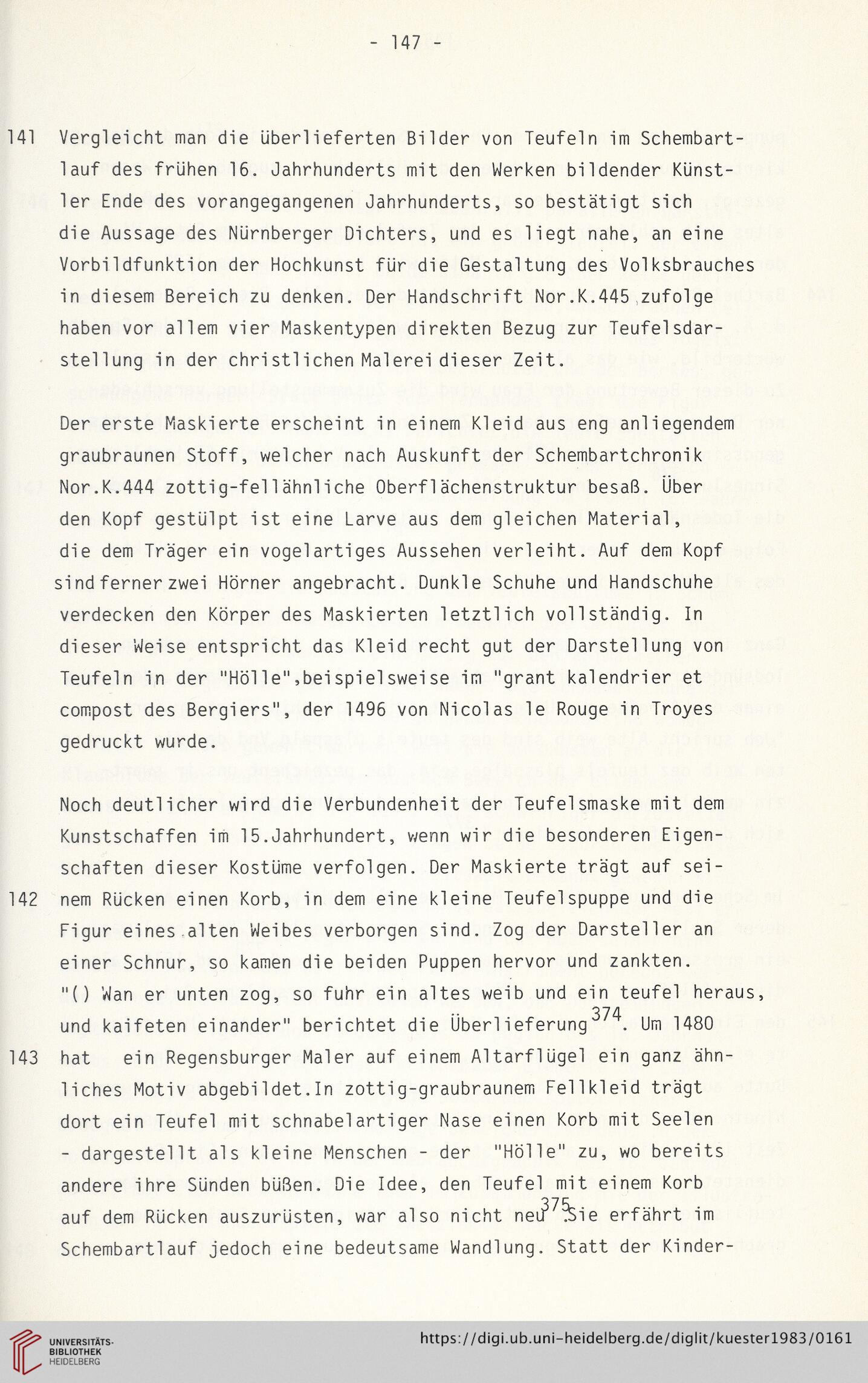- 147 -
141 Vergleicht man die überlieferten Bilder von Teufeln im Schembart-
lauf des frühen 16. Jahrhunderts mit den Werken bildender Künst-
ler Ende des vorangegangenen Jahrhunderts, so bestätigt sich
die Aussage des Nürnberger Dichters, und es liegt nahe, an eine
Vorbildfunktion der Hochkunst für die Gestaltung des Volksbrauches
in diesem Bereich zu denken. Der Handschrift Nor.K.445 zufolge
haben vor allem vier Maskentypen direkten Bezug zur Teufelsdar-
stellung in der christlichen Malerei dieser Zeit.
Der erste Maskierte erscheint in einem Kleid aus eng anliegendem
graubraunen Stoff, welcher nach Auskunft der Schembartchronik
Nor.K.444 zottig-fellähnliche Oberflächenstruktur besaß. Über
den Kopf gestülpt ist eine Larve aus dem gleichen Material,
die dem Träger ein vogelartiges Aussehen verleiht. Auf dem Kopf
sind ferner zwei Hörner angebracht. Dunkle Schuhe und Handschuhe
verdecken den Körper des Maskierten letztlich vollständig. In
dieser Weise entspricht das Kleid recht gut der Darstellung von
Teufeln in der "Hölle", beispielsweise im "grant kalendrier et
compost des Bergiers", der 1496 von Nicolas le Rouge in Troyes
gedruckt wurde.
Noch deutlicher wird die Verbundenheit der Teufelsmaske mit dem
Kunstschaffen im 15.Jahrhundert, wenn wir die besonderen Eigen-
schaften dieser Kostüme verfolgen. Der Maskierte trägt auf sei-
142 nem Rücken einen Korb, in dem eine kleine Teufelspuppe und die
Figur eines alten Weibes verborgen sind. Zog der Darsteller an
einer Schnur, so kamen die beiden Puppen hervor und zankten.
"() Wan er unten zog, so fuhr ein altes weib und ein teufel heraus,
und kaifeten einander" berichtet die Überlieferung . Um 1480
143 hat ein Regensburger Maler auf einem Altarflügel ein ganz ähn-
liches Motiv abgebildet.In zottig-graubraunem Fellkleid trägt
dort ein Teufel mit schnabelartiger Nase einen Korb mit Seelen
- dargestellt als kleine Menschen - der "Hölle" zu, wo bereits
andere ihre Sünden büßen. Die Idee, den Teufel mit einem Korb
auf dem Rücken auszurüsten, war also nicht ne^'^ie erfährt im
Schembartlauf jedoch eine bedeutsame Wandlung. Statt der Kinder-
141 Vergleicht man die überlieferten Bilder von Teufeln im Schembart-
lauf des frühen 16. Jahrhunderts mit den Werken bildender Künst-
ler Ende des vorangegangenen Jahrhunderts, so bestätigt sich
die Aussage des Nürnberger Dichters, und es liegt nahe, an eine
Vorbildfunktion der Hochkunst für die Gestaltung des Volksbrauches
in diesem Bereich zu denken. Der Handschrift Nor.K.445 zufolge
haben vor allem vier Maskentypen direkten Bezug zur Teufelsdar-
stellung in der christlichen Malerei dieser Zeit.
Der erste Maskierte erscheint in einem Kleid aus eng anliegendem
graubraunen Stoff, welcher nach Auskunft der Schembartchronik
Nor.K.444 zottig-fellähnliche Oberflächenstruktur besaß. Über
den Kopf gestülpt ist eine Larve aus dem gleichen Material,
die dem Träger ein vogelartiges Aussehen verleiht. Auf dem Kopf
sind ferner zwei Hörner angebracht. Dunkle Schuhe und Handschuhe
verdecken den Körper des Maskierten letztlich vollständig. In
dieser Weise entspricht das Kleid recht gut der Darstellung von
Teufeln in der "Hölle", beispielsweise im "grant kalendrier et
compost des Bergiers", der 1496 von Nicolas le Rouge in Troyes
gedruckt wurde.
Noch deutlicher wird die Verbundenheit der Teufelsmaske mit dem
Kunstschaffen im 15.Jahrhundert, wenn wir die besonderen Eigen-
schaften dieser Kostüme verfolgen. Der Maskierte trägt auf sei-
142 nem Rücken einen Korb, in dem eine kleine Teufelspuppe und die
Figur eines alten Weibes verborgen sind. Zog der Darsteller an
einer Schnur, so kamen die beiden Puppen hervor und zankten.
"() Wan er unten zog, so fuhr ein altes weib und ein teufel heraus,
und kaifeten einander" berichtet die Überlieferung . Um 1480
143 hat ein Regensburger Maler auf einem Altarflügel ein ganz ähn-
liches Motiv abgebildet.In zottig-graubraunem Fellkleid trägt
dort ein Teufel mit schnabelartiger Nase einen Korb mit Seelen
- dargestellt als kleine Menschen - der "Hölle" zu, wo bereits
andere ihre Sünden büßen. Die Idee, den Teufel mit einem Korb
auf dem Rücken auszurüsten, war also nicht ne^'^ie erfährt im
Schembartlauf jedoch eine bedeutsame Wandlung. Statt der Kinder-