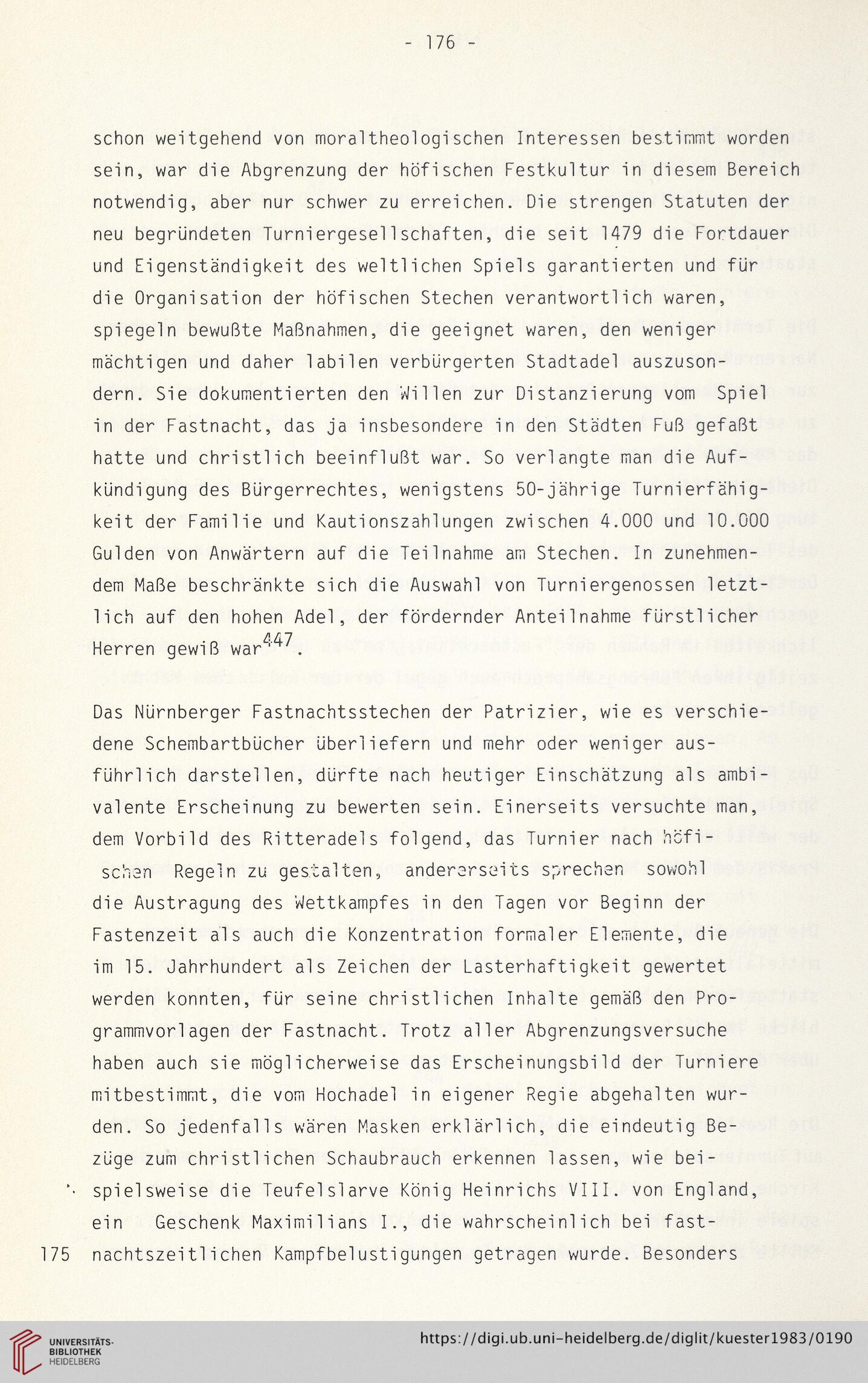- 176 -
schon weitgehend von moraltheologischen Interessen bestimmt worden
sein, war die Abgrenzung der höfischen Festkultur in diesem Bereich
notwendig, aber nur schwer zu erreichen. Die strengen Statuten der
neu begründeten Turniergesellschaften, die seit 1479 die Fortdauer
und Eigenständigkeit des weltlichen Spiels garantierten und für
die Organisation der höfischen Stechen verantwortlich waren,
spiegeln bewußte Maßnahmen, die geeignet waren, den weniger
mächtigen und daher labilen verbürgerten Stadtadel auszuson-
dern. Sie dokumentierten den Willen zur Distanzierung vom Spiel
in der Fastnacht, das ja insbesondere in den Städten Fuß gefaßt
hatte und christlich beeinflußt war. So verlangte man die Auf-
kündigung des Bürgerrechtes, wenigstens 50-jährige Turnierfähig-
keit der Familie und Kautionszahlungen zwischen 4.000 und 10.000
Gulden von Anwärtern auf die Teilnahme am Stechen. In zunehmen-
dem Maße beschränkte sich die Auswahl von Turniergenossen letzt-
lich auf den hohen Adel, der fördernder Anteilnahme fürstlicher
Herren gewiß war .
Das Nürnberger Fastnachtsstechen der Patrizier, wie es verschie-
dene Schembartbücher überliefern und mehr oder weniger aus-
führlich darstellen, dürfte nach heutiger Einschätzung als ambi-
valente Erscheinung zu bewerten sein. Einerseits versuchte man,
dem Vorbild des Ritteradels folgend, das Turnier nach höfi-
schen Regeln zu gestalten, andererseits sprechen sowohl
die Austragung des Wettkampfes in den Tagen vor Beginn der
Fastenzeit als auch die Konzentration formaler Elemente, die
im 15. Jahrhundert als Zeichen der Lasterhaftigkeit gewertet
werden konnten, für seine christlichen Inhalte gemäß den Pro-
grammvorlagen der Fastnacht. Trotz aller Abgrenzungsversuche
haben auch sie möglicherweise das Erscheinungsbild der Turniere
mitbestimmt, die vom Hochadel in eigener Regie abgehalten wur-
den. So jedenfalls wären Masken erklärlich, die eindeutig Be-
züge zum christlichen Schaubrauch erkennen lassen, wie bei-
'< spielsweise die Teufelslarve König Heinrichs VIII. von England,
ein Geschenk Maximilians I., die wahrscheinlich bei fast-
175 nachtszeitlichen Kampfbelustigungen getragen wurde. Besonders
schon weitgehend von moraltheologischen Interessen bestimmt worden
sein, war die Abgrenzung der höfischen Festkultur in diesem Bereich
notwendig, aber nur schwer zu erreichen. Die strengen Statuten der
neu begründeten Turniergesellschaften, die seit 1479 die Fortdauer
und Eigenständigkeit des weltlichen Spiels garantierten und für
die Organisation der höfischen Stechen verantwortlich waren,
spiegeln bewußte Maßnahmen, die geeignet waren, den weniger
mächtigen und daher labilen verbürgerten Stadtadel auszuson-
dern. Sie dokumentierten den Willen zur Distanzierung vom Spiel
in der Fastnacht, das ja insbesondere in den Städten Fuß gefaßt
hatte und christlich beeinflußt war. So verlangte man die Auf-
kündigung des Bürgerrechtes, wenigstens 50-jährige Turnierfähig-
keit der Familie und Kautionszahlungen zwischen 4.000 und 10.000
Gulden von Anwärtern auf die Teilnahme am Stechen. In zunehmen-
dem Maße beschränkte sich die Auswahl von Turniergenossen letzt-
lich auf den hohen Adel, der fördernder Anteilnahme fürstlicher
Herren gewiß war .
Das Nürnberger Fastnachtsstechen der Patrizier, wie es verschie-
dene Schembartbücher überliefern und mehr oder weniger aus-
führlich darstellen, dürfte nach heutiger Einschätzung als ambi-
valente Erscheinung zu bewerten sein. Einerseits versuchte man,
dem Vorbild des Ritteradels folgend, das Turnier nach höfi-
schen Regeln zu gestalten, andererseits sprechen sowohl
die Austragung des Wettkampfes in den Tagen vor Beginn der
Fastenzeit als auch die Konzentration formaler Elemente, die
im 15. Jahrhundert als Zeichen der Lasterhaftigkeit gewertet
werden konnten, für seine christlichen Inhalte gemäß den Pro-
grammvorlagen der Fastnacht. Trotz aller Abgrenzungsversuche
haben auch sie möglicherweise das Erscheinungsbild der Turniere
mitbestimmt, die vom Hochadel in eigener Regie abgehalten wur-
den. So jedenfalls wären Masken erklärlich, die eindeutig Be-
züge zum christlichen Schaubrauch erkennen lassen, wie bei-
'< spielsweise die Teufelslarve König Heinrichs VIII. von England,
ein Geschenk Maximilians I., die wahrscheinlich bei fast-
175 nachtszeitlichen Kampfbelustigungen getragen wurde. Besonders