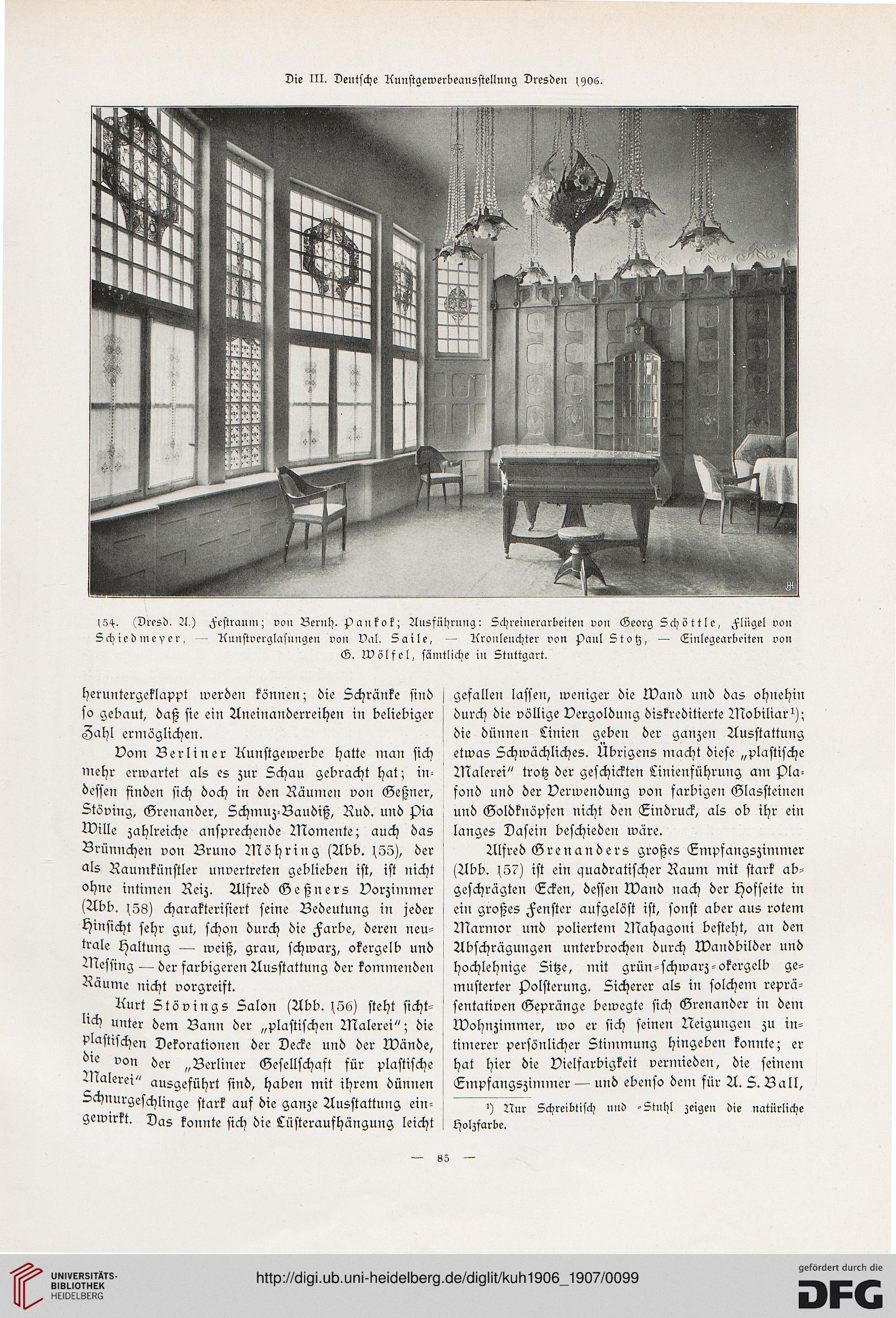Die XII. Deutsche Knnstgewerbeausstellung Dresden ;go6.
ts^. (Dresd. 21.) Festrauin; von Beruh. Pan kok; Ansführung: Schreinerarbeiten von Georg Schüttle, Flügel von
Schied meyer, - Kunstverglasungen von Val. Saile, — Kronleuchter von Paul Stotz, — Einlegearbeiten von
G. Wölfel, sämtliche in Stuttgart.
heruntergeklappt werden können; die Schränke sind
so gebaut, daß sie ein Aneinanderreihen in beliebiger
Zahl ermöglichen.
vom Berliner Aunstgewerbe hatte man sich
mehr erwartet als es zur Schau gebracht hat; in-
dessen finden sich doch in den Räunien von Geßner,
Äöving, Grenander, Schmuz-Baudiß, Rud. und Pia
Wille zahlreiche ansprechende Momente; auch das
Brünnchen von Bruno Möhring (Abb. der
als Raumkünstler unvertreten geblieben ist, ist nicht
ohne intimen Reiz. Alfred Geßners Vorzimmer
(Abb. f58) charakterisiert seine Bedeutung in jeder
Einsicht sehr gut, schon durch die Farbe, deren neu-
trale Haltung — weiß, grau, schwarz, okergelb und
Messing — der farbigeren Ausstattung der kommenden
Räunre nicht vorgreift.
Aurt Stövings Salon (Abb. (56) steht sicht-
ttch unter dem Bann der „plastischen Malerei"; die
plastischen Dekorationen der Decke und der Wände,
dis von der „Berliner Gesellschaft für plastische
Malerei" ausgeführt sind, haben mit ihrem dünnen
5chnurgeschlinge stark auf die ganze Ausstattung ein-
gewirkt. Das konnte sich die Lüsteraufhängung leicht
gefallen lassen, weniger die Wand und das ohnehin
durch die völlige Vergoldung diskreditierte Mobiliars;
die dünnen Linien geben der ganzen Ausstattung
etwas Schwächliches. Übrigens macht diese „plastische
Malerei" trotz der geschickten Linienführung am Pla-
fond und der Verwendung von farbigen Glassteinen
und Goldknöpfen nicht den Gindruck, als ob ihr ein
langes Dasein beschieden wäre.
Alfred Grenanders großes Empfangszimmer
(Abb. (57) ist ein quadratischer Raum mit stark ab-
geschrägten Ecken, dessen Wand nach der Hofseite in
ein großes Fenster aufgelöst ist, sonst aber aus rotem
Marmor und polierten: Mahagoni besteht, an den
Abschrägungen unterbrochen durch Wandbilder und
hochlehnige Sitze, mit grün-schwarz-okergelb ge-
musterter Polsterung. Sicherer als in solchem reprä-
sentativen Gepränge bewegte sich Grenander in dem
Wohnzimmer, wo er sich seinen Neigungen zu in-
timerer persönlicher Stimmung hingeben konnte; er
hat hier die Vielfarbigkeit vermieden, die seinem
Empfangszimmer — und ebenso dem für A. 5. Ball,
') Nur Schreibtisch und -Stuhl zeigen die natürliche
Ijolzfarbe.
ts^. (Dresd. 21.) Festrauin; von Beruh. Pan kok; Ansführung: Schreinerarbeiten von Georg Schüttle, Flügel von
Schied meyer, - Kunstverglasungen von Val. Saile, — Kronleuchter von Paul Stotz, — Einlegearbeiten von
G. Wölfel, sämtliche in Stuttgart.
heruntergeklappt werden können; die Schränke sind
so gebaut, daß sie ein Aneinanderreihen in beliebiger
Zahl ermöglichen.
vom Berliner Aunstgewerbe hatte man sich
mehr erwartet als es zur Schau gebracht hat; in-
dessen finden sich doch in den Räunien von Geßner,
Äöving, Grenander, Schmuz-Baudiß, Rud. und Pia
Wille zahlreiche ansprechende Momente; auch das
Brünnchen von Bruno Möhring (Abb. der
als Raumkünstler unvertreten geblieben ist, ist nicht
ohne intimen Reiz. Alfred Geßners Vorzimmer
(Abb. f58) charakterisiert seine Bedeutung in jeder
Einsicht sehr gut, schon durch die Farbe, deren neu-
trale Haltung — weiß, grau, schwarz, okergelb und
Messing — der farbigeren Ausstattung der kommenden
Räunre nicht vorgreift.
Aurt Stövings Salon (Abb. (56) steht sicht-
ttch unter dem Bann der „plastischen Malerei"; die
plastischen Dekorationen der Decke und der Wände,
dis von der „Berliner Gesellschaft für plastische
Malerei" ausgeführt sind, haben mit ihrem dünnen
5chnurgeschlinge stark auf die ganze Ausstattung ein-
gewirkt. Das konnte sich die Lüsteraufhängung leicht
gefallen lassen, weniger die Wand und das ohnehin
durch die völlige Vergoldung diskreditierte Mobiliars;
die dünnen Linien geben der ganzen Ausstattung
etwas Schwächliches. Übrigens macht diese „plastische
Malerei" trotz der geschickten Linienführung am Pla-
fond und der Verwendung von farbigen Glassteinen
und Goldknöpfen nicht den Gindruck, als ob ihr ein
langes Dasein beschieden wäre.
Alfred Grenanders großes Empfangszimmer
(Abb. (57) ist ein quadratischer Raum mit stark ab-
geschrägten Ecken, dessen Wand nach der Hofseite in
ein großes Fenster aufgelöst ist, sonst aber aus rotem
Marmor und polierten: Mahagoni besteht, an den
Abschrägungen unterbrochen durch Wandbilder und
hochlehnige Sitze, mit grün-schwarz-okergelb ge-
musterter Polsterung. Sicherer als in solchem reprä-
sentativen Gepränge bewegte sich Grenander in dem
Wohnzimmer, wo er sich seinen Neigungen zu in-
timerer persönlicher Stimmung hingeben konnte; er
hat hier die Vielfarbigkeit vermieden, die seinem
Empfangszimmer — und ebenso dem für A. 5. Ball,
') Nur Schreibtisch und -Stuhl zeigen die natürliche
Ijolzfarbe.