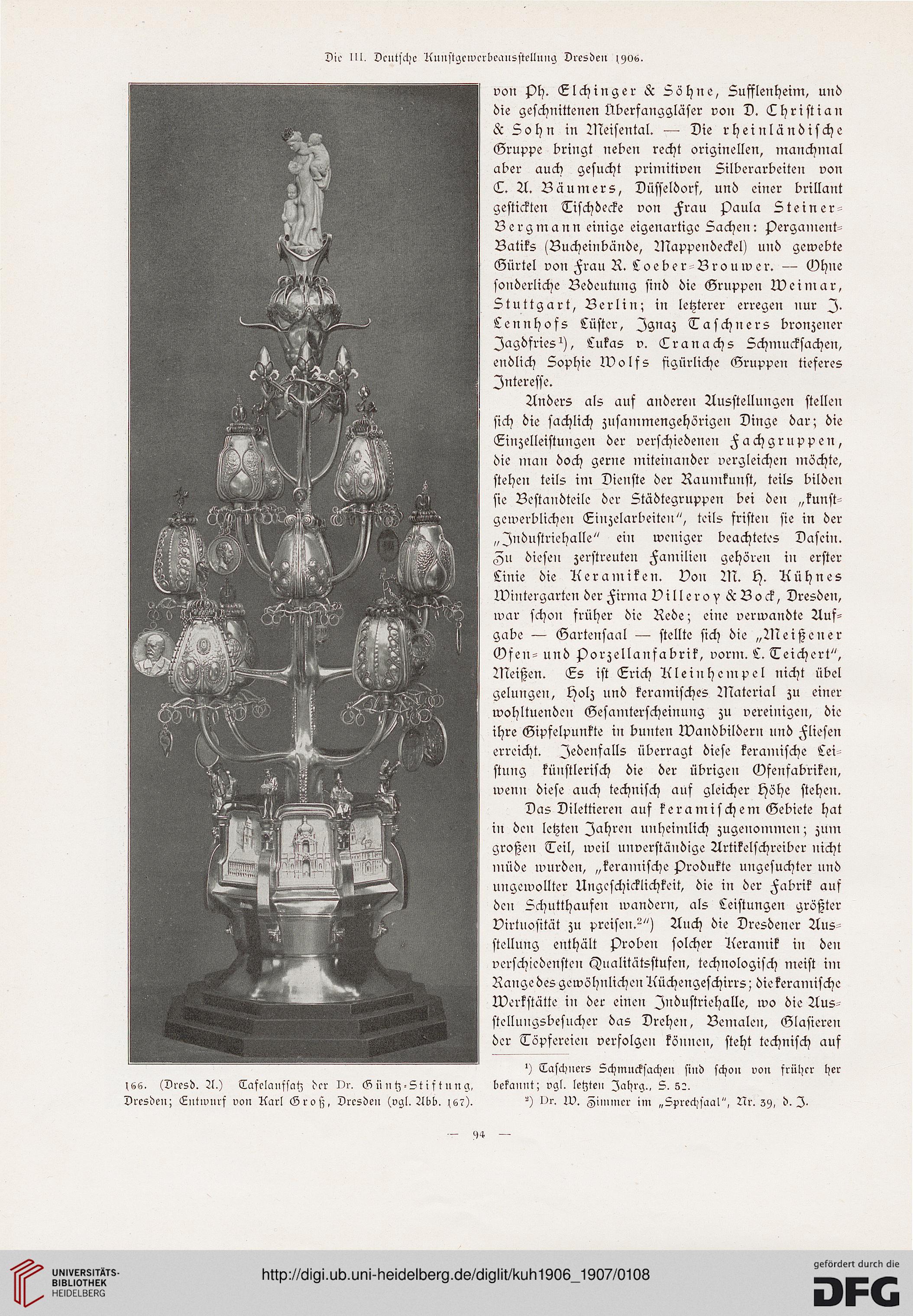Die UI. Deutsche Kunstgcivcrbeansstellung Dresden (906.
;ss. (Dresd. A.) Tafelaufsatz der Idr. Güntz-Stiftung.
Dresden; Entwurf von Karl Groß, Dresden (vgl. Abb. ;s?).
von PH. Tlchinger & Söhne, Sufflenheim, und
die geschnittenen Überfanggläser von D. Christian
6c Sohn in Meisental. — Die rheinländische
Gruppe bringt neben recht originellen, manchmal
aber auch gesucht primitiven Silberarbeiten von
T. A. Säumers, Düsseldorf, und einer brillant
gestickten Tischdecke von Frau Paula Steiner-
Bergmann einige eigenartige Sachen: Pergament-
Batiks (Bucheinbände, Mappendeckel) und gewebte
Gürtel von Frau R. Loeber-Brouwer. — Ohne
sonderliche Bedeutung sind die Gruppen Weinrar,
Stuttgart, Berlin; in letzterer erregen nur I.
Lennhofs Lüster, Ignaz Taschners bronzener
Iagdfries , Lukas v. Tranachs Schmucksachen,
endlich Sophie Wolfs figürliche Gruppen tieferes
Interesse.
Anders als auf airderen Ausstellungen stellen
sich die sachlich zusanrmengehörigen Dinge dar; die
Ginzelleistungen der verschiedenen Fachgruppen,
die man doch gerne miteinander vergleichen möchte,
steheir teils inr Dienste der Raumkunst, teils bilden
sie Bestandteile der Städtegruppen bei den „kunst-
gewerblicherr Ginzelarbeiteir", teils fristen sie in der
„Industriehalle" ein weniger beachtetes Dasein.
Irr dieseir zerstreuten Familieir gehören iir erster
Linie die Aer antiken. Bon M. p. Aühnes
Wirrtergarten der Firma Bille roy 6cBock, Dresden,
war schon früher die Rede; eine verwandte Auf-
gabe — Gartensaal — stellte sich die „Meißener
Ofen-und Porzellanfabrik, vorm. L. Teichert",
Meißen. Gs ist Grich Aleinhempel nicht übel
gelungen, polz und keramisches Material zu einer
wohltuenden Gefanrterfcheinung zu vereiirigen, die
ihre Gipfelpunkte in bunten Wairdbilderir und Fliesen
erreicht. Jedenfalls überragt diese keramische Lei-
stung künstlerisch die der übrigen Ofenfabriken,
wenn diese auch techirisch auf gleicher Höhe stehen.
Das Dilettieren auf keramischem Gebiete hat
in deir letzten Jahren nnheimlich zugenommen; zum
großen Teil, weil unverstäirdige Artikelschreiber iricht
nrüde wurden, „keramische Produkte ungesuchter und
ungewollter Ungeschicklichkeit, die in der Fabrik auf
deir Schutthauferr wandern, als Leistungen größter
Virtuosität zu preisen?") Auch die Dresdener Aus
stellung enthält Probeir solcher Aeramik iir den
verschiedensten Aualitätsstufen, technologisch meist im
Range des gewöhnlichen Aüchengeschirrs; die keramische
Werkstätte in der einen Industriehalle, wo die Aus-
stcllungsbesucher das Drehen, Benralen, Glasieren
der Töpfereien verfolgen können, steht technisch auf
‘) Taschners Schmucksachen sind schon von früher her
bekannt; vgl. letzten Iahrg.. S. se.
2) Dr. D). Dimmer im „Sprechsaal", Nr. ZJ, d. I.
;ss. (Dresd. A.) Tafelaufsatz der Idr. Güntz-Stiftung.
Dresden; Entwurf von Karl Groß, Dresden (vgl. Abb. ;s?).
von PH. Tlchinger & Söhne, Sufflenheim, und
die geschnittenen Überfanggläser von D. Christian
6c Sohn in Meisental. — Die rheinländische
Gruppe bringt neben recht originellen, manchmal
aber auch gesucht primitiven Silberarbeiten von
T. A. Säumers, Düsseldorf, und einer brillant
gestickten Tischdecke von Frau Paula Steiner-
Bergmann einige eigenartige Sachen: Pergament-
Batiks (Bucheinbände, Mappendeckel) und gewebte
Gürtel von Frau R. Loeber-Brouwer. — Ohne
sonderliche Bedeutung sind die Gruppen Weinrar,
Stuttgart, Berlin; in letzterer erregen nur I.
Lennhofs Lüster, Ignaz Taschners bronzener
Iagdfries , Lukas v. Tranachs Schmucksachen,
endlich Sophie Wolfs figürliche Gruppen tieferes
Interesse.
Anders als auf airderen Ausstellungen stellen
sich die sachlich zusanrmengehörigen Dinge dar; die
Ginzelleistungen der verschiedenen Fachgruppen,
die man doch gerne miteinander vergleichen möchte,
steheir teils inr Dienste der Raumkunst, teils bilden
sie Bestandteile der Städtegruppen bei den „kunst-
gewerblicherr Ginzelarbeiteir", teils fristen sie in der
„Industriehalle" ein weniger beachtetes Dasein.
Irr dieseir zerstreuten Familieir gehören iir erster
Linie die Aer antiken. Bon M. p. Aühnes
Wirrtergarten der Firma Bille roy 6cBock, Dresden,
war schon früher die Rede; eine verwandte Auf-
gabe — Gartensaal — stellte sich die „Meißener
Ofen-und Porzellanfabrik, vorm. L. Teichert",
Meißen. Gs ist Grich Aleinhempel nicht übel
gelungen, polz und keramisches Material zu einer
wohltuenden Gefanrterfcheinung zu vereiirigen, die
ihre Gipfelpunkte in bunten Wairdbilderir und Fliesen
erreicht. Jedenfalls überragt diese keramische Lei-
stung künstlerisch die der übrigen Ofenfabriken,
wenn diese auch techirisch auf gleicher Höhe stehen.
Das Dilettieren auf keramischem Gebiete hat
in deir letzten Jahren nnheimlich zugenommen; zum
großen Teil, weil unverstäirdige Artikelschreiber iricht
nrüde wurden, „keramische Produkte ungesuchter und
ungewollter Ungeschicklichkeit, die in der Fabrik auf
deir Schutthauferr wandern, als Leistungen größter
Virtuosität zu preisen?") Auch die Dresdener Aus
stellung enthält Probeir solcher Aeramik iir den
verschiedensten Aualitätsstufen, technologisch meist im
Range des gewöhnlichen Aüchengeschirrs; die keramische
Werkstätte in der einen Industriehalle, wo die Aus-
stcllungsbesucher das Drehen, Benralen, Glasieren
der Töpfereien verfolgen können, steht technisch auf
‘) Taschners Schmucksachen sind schon von früher her
bekannt; vgl. letzten Iahrg.. S. se.
2) Dr. D). Dimmer im „Sprechsaal", Nr. ZJ, d. I.