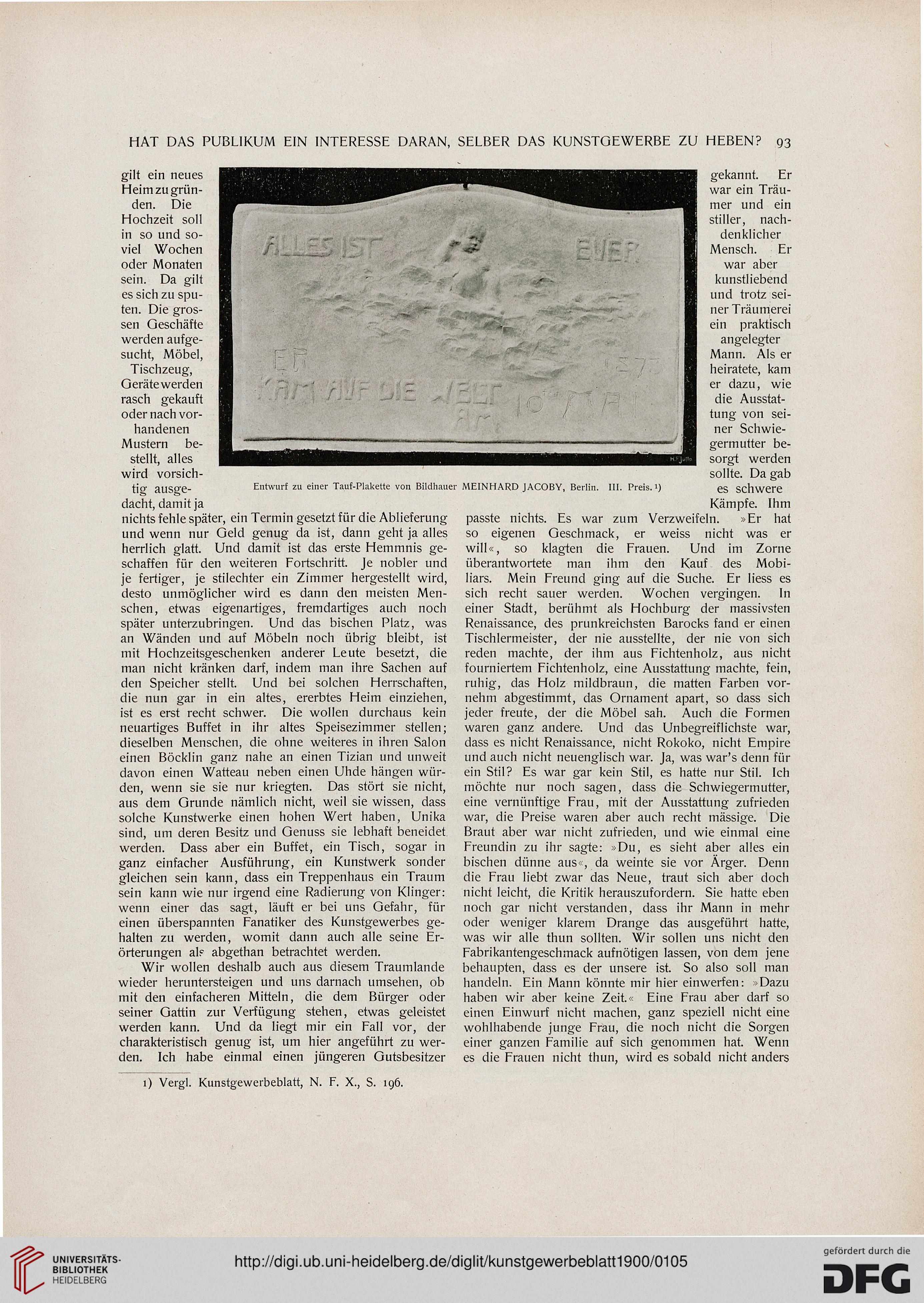HAT DAS PUBLIKUM EIN INTERESSE DARAN, SELBER DAS KUNSTGEWERBE ZU HEBEN? 93
Entwurf zu einer Tauf-PIakette von Bildhauer MEINHARD JACOBY, Berlin. III. Preis, i)
gilt ein neues
Heim zu grün-
den. Die
Hochzeit soll
in so und so-
viel Wochen
oder Monaten
sein. Da gilt
es sich zu spu-
ten. Die gros-
sen Geschäfte
werden aufge-
sucht, Möbel,
Tischzeug,
Geräte werden
rasch gekauft
oder nach vor-
handenen
Mustern be-
stellt, alles
wird vorsich-
tig ausge-
dacht, damit ja
nichts fehle später, ein Termin gesetzt für die Ablieferung
und wenn nur Geld genug da ist, dann geht ja alles
herrlich glatt. Und damit ist das erste Hemmnis ge-
schaffen für den weiteren Fortschritt. Je nobler und
je fertiger, je stilechter ein Zimmer hergestellt wird,
desto unmöglicher wird es dann den meisten Men-
schen, etwas eigenartiges, fremdartiges auch noch
später unterzubringen. Und das bischen Platz, was
an Wänden und auf Möbeln noch übrig bleibt, ist
mit Hochzeitsgeschenken anderer Leute besetzt, die
man nicht kränken darf, indem man ihre Sachen auf
den Speicher stellt. Und bei solchen Herrschaften,
die nun gar in ein altes, ererbtes Heim einziehen,
ist es erst recht schwer. Die wollen durchaus kein
neuartiges Büffet in ihr altes Speisezimmer stellen;
dieselben Menschen, die ohne weiteres in ihren Salon
einen Böcklin ganz nahe an einen Tizian und unweit
davon einen Watteau neben einen Uhde hängen wür-
den, wenn sie sie nur kriegten. Das stört sie nicht,
aus dem Grunde nämlich nicht, weil sie wissen, dass
solche Kunstwerke einen hohen Wert haben, Unika
sind, um deren Besitz und Genuss sie lebhaft beneidet
werden. Dass aber ein Büffet, ein Tisch, sogar in
ganz einfacher Ausführung, ein Kunstwerk sonder
gleichen sein kann, dass ein Treppenhaus ein Traum
sein kann wie nur irgend eine Radierung von Klinger:
wenn einer das sagt, läuft er bei uns Gefahr, für
einen überspannten Fanatiker des Kunstgewerbes ge-
halten zu werden, womit dann auch alle seine Er-
örterungen alf abgethan betrachtet werden.
Wir wollen deshalb auch aus diesem Traumlande
wieder heruntersteigen und uns darnach umsehen, ob
mit den einfacheren Mitteln, die dem Bürger oder
seiner Gattin zur Verfügung stehen, etwas geleistet
werden kann. Und da liegt mir ein Fall vor, der
charakteristisch genug ist, um hier angeführt zu wer-
den. Ich habe einmal einen jüngeren Gutsbesitzer
gekannt. Er
war ein Träu-
mer und ein
stiller, nach-
denklicher
Mensch. Er
war aber
kunstliebend
und trotz sei-
ner Träumerei
ein praktisch
angelegter
Mann. Als er
heiratete, kam
er dazu, wie
die Ausstat-
tung von sei-
ner Schwie-
germutter be-
sorgt werden
sollte. Da gab
es schwere
Kämpfe. Ihm
war zum Verzweifeln. »Er hat
er weiss nicht was er
Und im Zorne
Kauf des Mobi-
, Er Hess es
passte nichts. Es
so eigenen Geschmack,
will«, so klagten die Frauen
überantwortete man ihm den
liars. Mein Freund ging auf die Suche,
sich recht sauer werden. Wochen vergingen. In
einer Stadt, berühmt als Hochburg der massivsten
Renaissance, des prunkreichsten Barocks fand er einen
Tischlermeister, der nie ausstellte, der nie von sich
reden machte, der ihm aus Fichtenholz, aus nicht
fourniertem Fichtenholz, eine Ausstattung machte, fein,
ruhig, das Holz mildbraun, die matten Farben vor-
nehm abgestimmt, das Ornament apart, so dass sich
jeder freute, der die Möbel sah. Auch die Formen
waren ganz andere. Und das Unbegreiflichste war,
dass es nicht Renaissance, nicht Rokoko, nicht Empire
und auch nicht neuenglisch war. Ja, was war's denn für
ein Stil? Es war gar kein Stil, es hatte nur Stil. Ich
möchte nur noch sagen, dass die Schwiegermutter,
eine vernünftige Frau, mit der Ausstattung zufrieden
war, die Preise waren aber auch recht massige. Die
Braut aber war nicht zufrieden, und wie einmal eine
Freundin zu ihr sagte: »Du, es sieht aber alles ein
bischen dünne aus«, da weinte sie vor Ärger. Denn
die Frau liebt zwar das Neue, traut sich aber doch
nicht leicht, die Kritik herauszufordern. Sie hatte eben
noch gar nicht verstanden, dass ihr Mann in mehr
oder weniger klarem Drange das ausgeführt hatte,
was wir alle thun sollten. Wir sollen uns nicht den
Fabrikantengeschmack aufnötigen lassen, von dem jene
behaupten, dass es der unsere ist. So also soll man
handeln. Ein Mann könnte mir hier einwerfen: »Dazu
haben wir aber keine Zeit.« Eine Frau aber darf so
einen Einwurf nicht machen, ganz speziell nicht eine
wohlhabende junge Frau, die noch nicht die Sorgen
einer ganzen Familie auf sich genommen hat. Wenn
es die Frauen nicht thun, wird es sobald nicht anders
1) Vergl. Kunstgewcrbeblatt, N. F. X., S. 196.