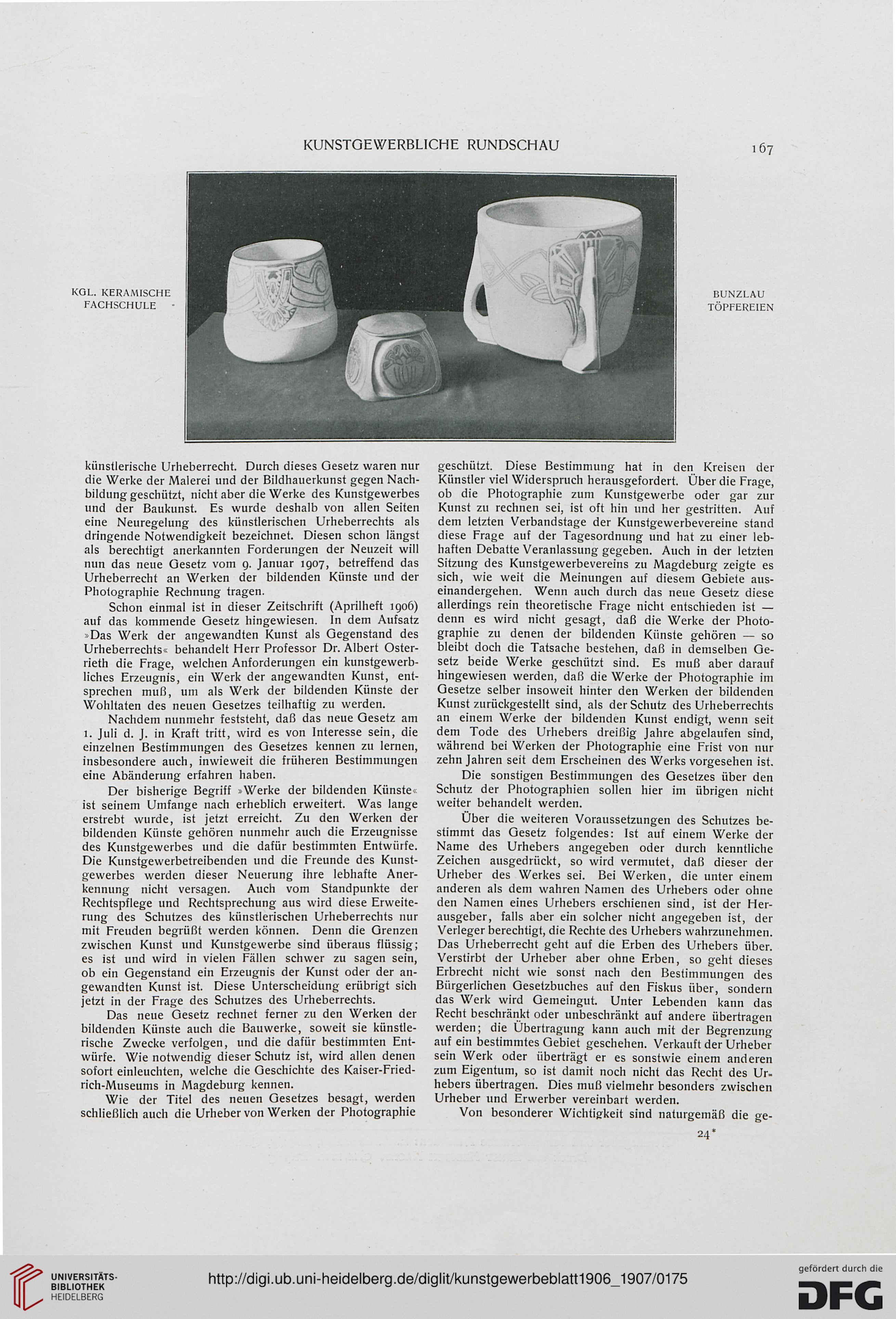KUNSTGEWERBLICHE RUNDSCHAU
167
KGL. KERAMISCHE
FACHSCHULE •
BUNZLAU
TÖPFEREIEN
künstlerische Urheberrecht. Durch dieses Gesetz waren nur
die Werke der Malerei und der Bildhauerkunst gegen Nach-
bildung geschützt, nicht aber die Werke des Kunstgewerbes
und der Baukunst. Es wurde deshalb von allen Seiten
eine Neuregelung des künstlerischen Urheberrechts als
dringende Notwendigkeit bezeichnet. Diesen schon längst
als berechtigt anerkannten Forderungen der Neuzeit will
nun das neue Gesetz vom 9. Januar 1907, betreffend das
Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der
Photographie Rechnung tragen.
Schon einmal ist in dieser Zeitschrift (Aprilheft 1906)
auf das kommende Gesetz hingewiesen. In dem Aufsatz
»Das Werk der angewandten Kunst als Gegenstand des
Urheberrechts« behandelt Herr Professor Dr. Albert Oster-
rieth die Frage, welchen Anforderungen ein kunstgewerb-
liches Erzeugnis, ein Werk der angewandten Kunst, ent-
sprechen muß, um als Werk der bildenden Künste der
Wohltaten des neuen Gesetzes teilhaftig zu werden.
Nachdem nunmehr feststeht, daß das neue Gesetz am
1. Juli d. J. in Kraft tritt, wird es von Interesse sein, die
einzelnen Bestimmungen des Gesetzes kennen zu lernen,
insbesondere auch, inwieweit die früheren Bestimmungen
eine Abänderung erfahren haben.
Der bisherige Begriff »Werke der bildenden Künste
ist seinem Umfange nach erheblich erweitert. Was lange
erstrebt wurde, ist jetzt erreicht. Zu den Werken der
bildenden Künste gehören nunmehr auch die Erzeugnisse
des Kunstgewerbes und die dafür bestimmten Entwürfe.
Die Kunstgewerbetreibenden und die Freunde des Kunst-
gewerbes werden dieser Neuerung ihre lebhafte Aner-
kennung nicht versagen. Auch vom Standpunkte der
Rechtspflege und Rechtsprechung aus wird diese Erweite-
rung des Schutzes des künstlerischen Urheberrechts nur
mit Freuden begrüßt werden können. Denn die Grenzen
zwischen Kunst und Kunstgewerbe sind überaus flüssig;
es ist und wird in vielen Fällen schwer zu sagen sein,
ob ein Gegenstand ein Erzeugnis der Kunst oder der an-
gewandten Kunst ist. Diese Unterscheidung erübrigt sich
jetzt in der Frage des Schutzes des Urheberrechts.
Das neue Gesetz rechnet ferner zu den Werken der
bildenden Künste auch die Bauwerke, soweit sie künstle-
rische Zwecke verfolgen, und die dafür bestimmten Ent-
würfe. Wie notwendig dieser Schutz ist, wird allen denen
sofort einleuchten, welche die Geschichte des Kaiser-Fried-
rich-Museums in Magdeburg kennen.
Wie der Titel des neuen Gesetzes besagt, werden
schließlich auch die Urheber von Werken der Photographie
geschützt. Diese Bestimmung hat in den Kreisen der
Künstler viel Widerspruch herausgefordert. Über die Frage,
ob die Photographie zum Kunstgewerbe oder gar zur
Kunst zu rechnen sei, ist oft hin und her gestritten. Auf
dem letzten Verbandstage der Kunstgewerbevereine stand
diese Frage auf der Tagesordnung und hat zu einer leb-
haften Debatte Veranlassung gegeben. Auch in der letzten
Sitzung des Kunstgewerbevereins zu Magdeburg zeigte es
sich, wie weit die Meinungen auf diesem Gebiete aus-
einandergehen. Wenn auch durch das neue Gesetz diese
allerdings rein theoretische Frage nicht entschieden ist —
denn es wird nicht gesagt, daß die Werke der Photo-
graphie zu denen der bildenden Künste gehören — so
bleibt doch die Tatsache bestehen, daß in demselben Ge-
setz beide Werke geschützt sind. Es muß aber darauf
hingewiesen werden, daß die Werke der Photographie im
Gesetze selber insoweit hinter den Werken der bildenden
Kunst zurückgestellt sind, als der Schutz des Urheberrechts
an einem Werke der bildenden Kunst endigt, wenn seit
dem Tode des Urhebers dreißig Jahre abgelaufen sind,
während bei Werken der Photographie eine Frist von nur
zehn Jahren seit dem Erscheinen des Werks vorgesehen ist.
Die sonstigen Bestimmungen des Gesetzes über den
Schutz der Photographien sollen hier im übrigen nicht
weiter behandelt werden.
Über die weiteren Voraussetzungen des Schutzes be-
stimmt das Gesetz folgendes: Ist auf einem Werke der
Name des Urhebers angegeben oder durch kenntliche
Zeichen ausgedrückt, so wird vermutet, daß dieser der
Urheber des Werkes sei. Bei Werken, die unter einem
anderen als dem wahren Namen des Urhebers oder ohne
den Namen eines Urhebers erschienen sind, ist der Her-
ausgeber, falls aber ein solcher nicht angegeben ist, der
Verleger berechtigt, die Rechte des Urhebers wahrzunehmen.
Das Urheberrecht geht auf die Erben des Urhebers über.
Verstirbt der Urheber aber ohne Erben, so geht dieses
Erbrecht nicht wie sonst nach den Bestimmungen des
Bürgerlichen Gesetzbuches auf den Fiskus über, sondern
das Werk wird Gemeingut. Unter Lebenden kann das
Recht beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen
werden; die Übertragung kann auch mit der Begrenzung
auf ein bestimmtes Gebiet geschehen. Verkauft der Urheber
sein Werk oder überträgt er es sonstwie einem anderen
zum Eigentum, so ist damit noch nicht das Recht des Ur-
hebers übertragen. Dies muß vielmehr besonders zwischen
Urheber und Erwerber vereinbart werden.
Von besonderer Wichtigkeit sind naturgemäß die ge-
24*
167
KGL. KERAMISCHE
FACHSCHULE •
BUNZLAU
TÖPFEREIEN
künstlerische Urheberrecht. Durch dieses Gesetz waren nur
die Werke der Malerei und der Bildhauerkunst gegen Nach-
bildung geschützt, nicht aber die Werke des Kunstgewerbes
und der Baukunst. Es wurde deshalb von allen Seiten
eine Neuregelung des künstlerischen Urheberrechts als
dringende Notwendigkeit bezeichnet. Diesen schon längst
als berechtigt anerkannten Forderungen der Neuzeit will
nun das neue Gesetz vom 9. Januar 1907, betreffend das
Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der
Photographie Rechnung tragen.
Schon einmal ist in dieser Zeitschrift (Aprilheft 1906)
auf das kommende Gesetz hingewiesen. In dem Aufsatz
»Das Werk der angewandten Kunst als Gegenstand des
Urheberrechts« behandelt Herr Professor Dr. Albert Oster-
rieth die Frage, welchen Anforderungen ein kunstgewerb-
liches Erzeugnis, ein Werk der angewandten Kunst, ent-
sprechen muß, um als Werk der bildenden Künste der
Wohltaten des neuen Gesetzes teilhaftig zu werden.
Nachdem nunmehr feststeht, daß das neue Gesetz am
1. Juli d. J. in Kraft tritt, wird es von Interesse sein, die
einzelnen Bestimmungen des Gesetzes kennen zu lernen,
insbesondere auch, inwieweit die früheren Bestimmungen
eine Abänderung erfahren haben.
Der bisherige Begriff »Werke der bildenden Künste
ist seinem Umfange nach erheblich erweitert. Was lange
erstrebt wurde, ist jetzt erreicht. Zu den Werken der
bildenden Künste gehören nunmehr auch die Erzeugnisse
des Kunstgewerbes und die dafür bestimmten Entwürfe.
Die Kunstgewerbetreibenden und die Freunde des Kunst-
gewerbes werden dieser Neuerung ihre lebhafte Aner-
kennung nicht versagen. Auch vom Standpunkte der
Rechtspflege und Rechtsprechung aus wird diese Erweite-
rung des Schutzes des künstlerischen Urheberrechts nur
mit Freuden begrüßt werden können. Denn die Grenzen
zwischen Kunst und Kunstgewerbe sind überaus flüssig;
es ist und wird in vielen Fällen schwer zu sagen sein,
ob ein Gegenstand ein Erzeugnis der Kunst oder der an-
gewandten Kunst ist. Diese Unterscheidung erübrigt sich
jetzt in der Frage des Schutzes des Urheberrechts.
Das neue Gesetz rechnet ferner zu den Werken der
bildenden Künste auch die Bauwerke, soweit sie künstle-
rische Zwecke verfolgen, und die dafür bestimmten Ent-
würfe. Wie notwendig dieser Schutz ist, wird allen denen
sofort einleuchten, welche die Geschichte des Kaiser-Fried-
rich-Museums in Magdeburg kennen.
Wie der Titel des neuen Gesetzes besagt, werden
schließlich auch die Urheber von Werken der Photographie
geschützt. Diese Bestimmung hat in den Kreisen der
Künstler viel Widerspruch herausgefordert. Über die Frage,
ob die Photographie zum Kunstgewerbe oder gar zur
Kunst zu rechnen sei, ist oft hin und her gestritten. Auf
dem letzten Verbandstage der Kunstgewerbevereine stand
diese Frage auf der Tagesordnung und hat zu einer leb-
haften Debatte Veranlassung gegeben. Auch in der letzten
Sitzung des Kunstgewerbevereins zu Magdeburg zeigte es
sich, wie weit die Meinungen auf diesem Gebiete aus-
einandergehen. Wenn auch durch das neue Gesetz diese
allerdings rein theoretische Frage nicht entschieden ist —
denn es wird nicht gesagt, daß die Werke der Photo-
graphie zu denen der bildenden Künste gehören — so
bleibt doch die Tatsache bestehen, daß in demselben Ge-
setz beide Werke geschützt sind. Es muß aber darauf
hingewiesen werden, daß die Werke der Photographie im
Gesetze selber insoweit hinter den Werken der bildenden
Kunst zurückgestellt sind, als der Schutz des Urheberrechts
an einem Werke der bildenden Kunst endigt, wenn seit
dem Tode des Urhebers dreißig Jahre abgelaufen sind,
während bei Werken der Photographie eine Frist von nur
zehn Jahren seit dem Erscheinen des Werks vorgesehen ist.
Die sonstigen Bestimmungen des Gesetzes über den
Schutz der Photographien sollen hier im übrigen nicht
weiter behandelt werden.
Über die weiteren Voraussetzungen des Schutzes be-
stimmt das Gesetz folgendes: Ist auf einem Werke der
Name des Urhebers angegeben oder durch kenntliche
Zeichen ausgedrückt, so wird vermutet, daß dieser der
Urheber des Werkes sei. Bei Werken, die unter einem
anderen als dem wahren Namen des Urhebers oder ohne
den Namen eines Urhebers erschienen sind, ist der Her-
ausgeber, falls aber ein solcher nicht angegeben ist, der
Verleger berechtigt, die Rechte des Urhebers wahrzunehmen.
Das Urheberrecht geht auf die Erben des Urhebers über.
Verstirbt der Urheber aber ohne Erben, so geht dieses
Erbrecht nicht wie sonst nach den Bestimmungen des
Bürgerlichen Gesetzbuches auf den Fiskus über, sondern
das Werk wird Gemeingut. Unter Lebenden kann das
Recht beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen
werden; die Übertragung kann auch mit der Begrenzung
auf ein bestimmtes Gebiet geschehen. Verkauft der Urheber
sein Werk oder überträgt er es sonstwie einem anderen
zum Eigentum, so ist damit noch nicht das Recht des Ur-
hebers übertragen. Dies muß vielmehr besonders zwischen
Urheber und Erwerber vereinbart werden.
Von besonderer Wichtigkeit sind naturgemäß die ge-
24*