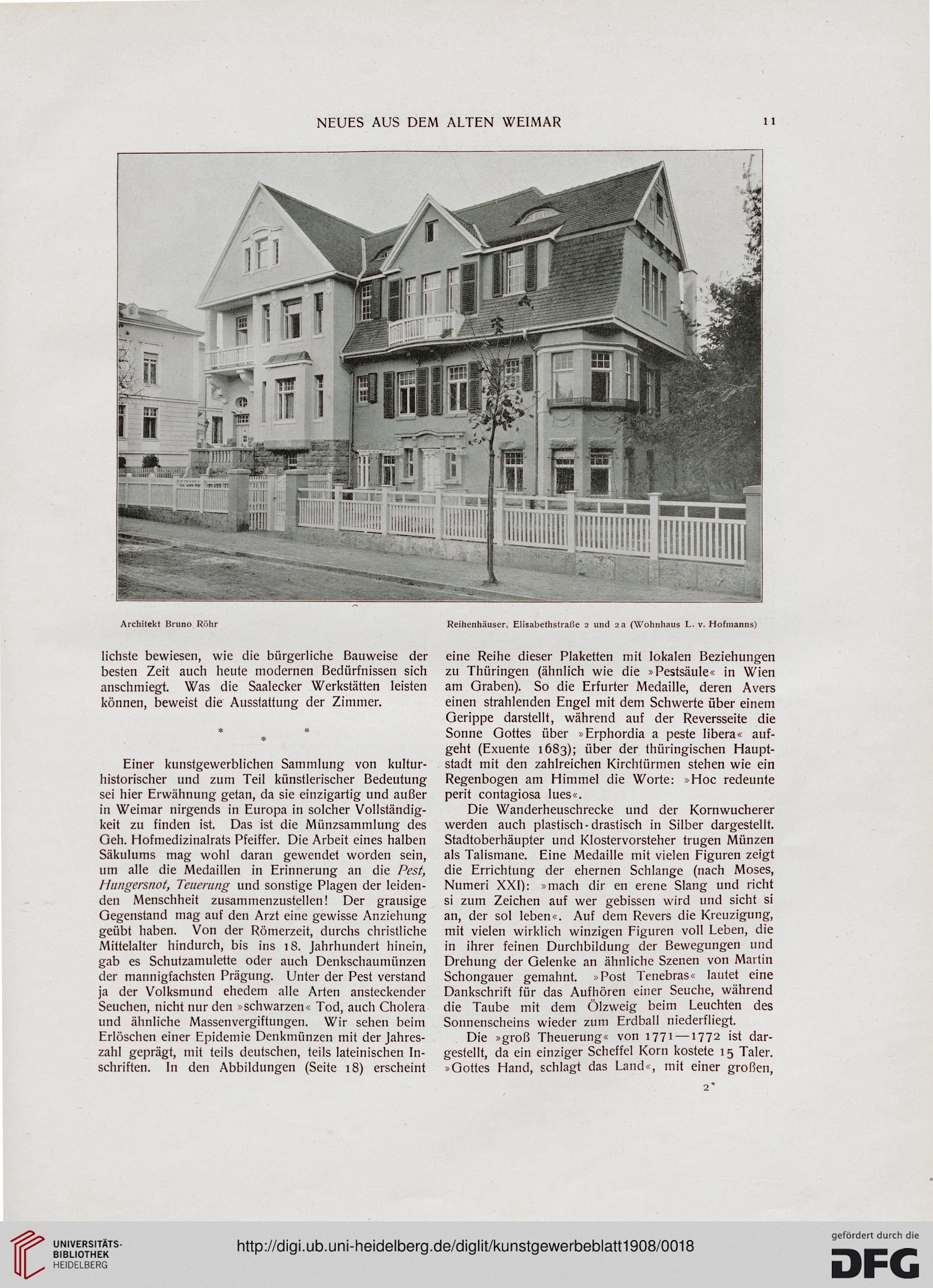NEUES AUS DEM ALTEN WEIMAR
11
Architekt Bruno Röhr
Reihenhäuser, Elisabethstraße 2 und 2 a (Wohnhaus L. v. Hofmanns)
lichste bewiesen, wie die bürgerliche Bauweise der
besten Zeit auch heute modernen Bedürfnissen sich
anschmiegt. Was die Saalecker Werkstätten leisten
können, beweist die Ausstattung der Zimmer.
Einer kunstgewerblichen Sammlung von kultur-
historischer und zum Teil künstlerischer Bedeutung
sei hier Erwähnung getan, da sie einzigartig und außer
in Weimar nirgends in Europa in solcher Vollständig-
keit zu finden ist. Das ist die Münzsammlung des
Geh. Hofmedizinalrats Pfeiffer. Die Arbeit eines halben
Säkulums mag wohl daran gewendet worden sein,
um alle die Medaillen in Erinnerung an die Pest,
Hungersnot, Teuerung und sonstige Plagen der leiden-
den Menschheit zusammenzustellen! Der grausige
Gegenstand mag auf den Arzt eine gewisse Anziehung
geübt haben. Von der Römerzeit, durchs christliche
Mittelalter hindurch, bis ins 18. Jahrhundert hinein,
gab es Schutzamulette oder auch Denkschaumünzen
der mannigfachsten Prägung. Unter der Pest verstand
ja der Volksmund ehedem alle Arten ansteckender
Seuchen, nicht nur den »schwarzen« Tod, auch Cholera
und ähnliche Massenvergiftungen. Wir sehen beim
Erlöschen einer Epidemie Denkmünzen mit der Jahres-
zahl geprägt, mit teils deutschen, teils lateinischen In-
schriften. In den Abbildungen (Seite 18) erscheint
eine Reihe dieser Plaketten mit lokalen Beziehungen
zu Thüringen (ähnlich wie die »Pestsäule« in Wien
am Graben). So die Erfurter Medaille, deren Avers
einen strahlenden Engel mit dem Schwerte über einem
Gerippe darstellt, während auf der Reversseite die
Sonne Gottes über »Erphordia a peste libera« auf-
geht (Exuente 1683); über der thüringischen Haupt-
stadt mit den zahlreichen Kirchtürmen stehen wie ein
Regenbogen am Himmel die Worte: »Hoc redeunte
perit contagiosa lues«.
Die Wanderheuschrecke und der Kornwucherer
werden auch plastisch-drastisch in Silber dargestellt.
Stadtoberhäupter und Klostervorsteher trugen Münzen
als Talismane. Eine Medaille mit vielen Figuren zeigt
die Errichtung der ehernen Schlange (nach Moses,
Numeri XXI): »mach dir en erene Slang und rieht
si zum Zeichen auf wer gebissen wird und sieht si
an, der sol leben«. Auf dem Revers die Kreuzigung,
mit vielen wirklich winzigen Figuren voll Leben, die
in ihrer feinen Durchbildung der Bewegungen und
Drehung der Gelenke an ähnliche Szenen von Martin
Schongauer gemahnt. »Post Tenebras« lautet eine
Dankschrift für das Aufhören einer Seuche, während
die Taube mit dem Ölzweig beim Leuchten des
Sonnenscheins wieder zum Erdball niederfliegt.
Die »groß Theuerung« von 1771 —1772 ist dar-
gestellt, da ein einziger Scheffel Korn kostete 15 Taler.
»Gottes Hand, schlagt das Land«, mit einer großen,
11
Architekt Bruno Röhr
Reihenhäuser, Elisabethstraße 2 und 2 a (Wohnhaus L. v. Hofmanns)
lichste bewiesen, wie die bürgerliche Bauweise der
besten Zeit auch heute modernen Bedürfnissen sich
anschmiegt. Was die Saalecker Werkstätten leisten
können, beweist die Ausstattung der Zimmer.
Einer kunstgewerblichen Sammlung von kultur-
historischer und zum Teil künstlerischer Bedeutung
sei hier Erwähnung getan, da sie einzigartig und außer
in Weimar nirgends in Europa in solcher Vollständig-
keit zu finden ist. Das ist die Münzsammlung des
Geh. Hofmedizinalrats Pfeiffer. Die Arbeit eines halben
Säkulums mag wohl daran gewendet worden sein,
um alle die Medaillen in Erinnerung an die Pest,
Hungersnot, Teuerung und sonstige Plagen der leiden-
den Menschheit zusammenzustellen! Der grausige
Gegenstand mag auf den Arzt eine gewisse Anziehung
geübt haben. Von der Römerzeit, durchs christliche
Mittelalter hindurch, bis ins 18. Jahrhundert hinein,
gab es Schutzamulette oder auch Denkschaumünzen
der mannigfachsten Prägung. Unter der Pest verstand
ja der Volksmund ehedem alle Arten ansteckender
Seuchen, nicht nur den »schwarzen« Tod, auch Cholera
und ähnliche Massenvergiftungen. Wir sehen beim
Erlöschen einer Epidemie Denkmünzen mit der Jahres-
zahl geprägt, mit teils deutschen, teils lateinischen In-
schriften. In den Abbildungen (Seite 18) erscheint
eine Reihe dieser Plaketten mit lokalen Beziehungen
zu Thüringen (ähnlich wie die »Pestsäule« in Wien
am Graben). So die Erfurter Medaille, deren Avers
einen strahlenden Engel mit dem Schwerte über einem
Gerippe darstellt, während auf der Reversseite die
Sonne Gottes über »Erphordia a peste libera« auf-
geht (Exuente 1683); über der thüringischen Haupt-
stadt mit den zahlreichen Kirchtürmen stehen wie ein
Regenbogen am Himmel die Worte: »Hoc redeunte
perit contagiosa lues«.
Die Wanderheuschrecke und der Kornwucherer
werden auch plastisch-drastisch in Silber dargestellt.
Stadtoberhäupter und Klostervorsteher trugen Münzen
als Talismane. Eine Medaille mit vielen Figuren zeigt
die Errichtung der ehernen Schlange (nach Moses,
Numeri XXI): »mach dir en erene Slang und rieht
si zum Zeichen auf wer gebissen wird und sieht si
an, der sol leben«. Auf dem Revers die Kreuzigung,
mit vielen wirklich winzigen Figuren voll Leben, die
in ihrer feinen Durchbildung der Bewegungen und
Drehung der Gelenke an ähnliche Szenen von Martin
Schongauer gemahnt. »Post Tenebras« lautet eine
Dankschrift für das Aufhören einer Seuche, während
die Taube mit dem Ölzweig beim Leuchten des
Sonnenscheins wieder zum Erdball niederfliegt.
Die »groß Theuerung« von 1771 —1772 ist dar-
gestellt, da ein einziger Scheffel Korn kostete 15 Taler.
»Gottes Hand, schlagt das Land«, mit einer großen,