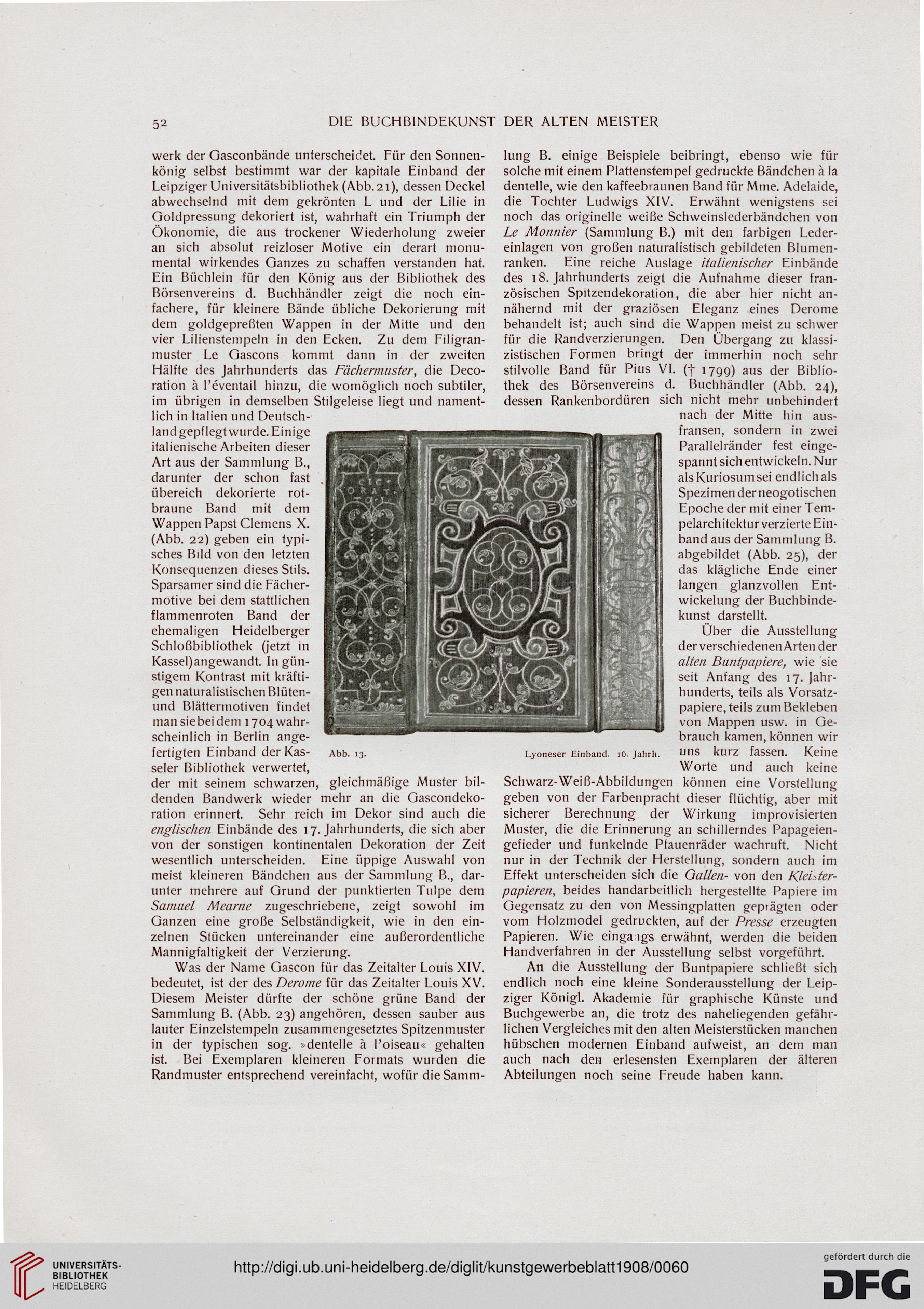52
DIE BUCHBINDEKUNST DER ALTEN MEISTER
werk der Gasconbände unterscheidet. Für den Sonnen-
könig selbst bestimmt war der kapitale Einband der
Leipziger Universitätsbibliothek (Abb.21), dessen Deckel
abwechselnd mit dem gekrönten L und der Lilie in
Goldpressung dekoriert ist, wahrhaft ein Triumph der
Ökonomie, die aus trockener Wiederholung zweier
an sich absolut reizloser Motive ein derart monu-
mental wirkendes Ganzes zu schaffen verstanden hat.
Ein Büchlein für den König aus der Bibliothek des
Börsenvereins d. Buchhändler zeigt die noch ein-
fachere, für kleinere Bände übliche Dekorierung mit
dem goldgepreßten Wappen in der Mitte und den
vier Lilienstempeln in den Ecken. Zu dem Filigran-
muster Le Gascons kommt dann in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts das Fächermustcr, die Deco-
ration ä l'eventail hinzu, die womöglich noch subtiler,
im übrigen in demselben Stilgeleise liegt und nament-
lich in Italien und Deutsch-
land gepflegt wurde. Einige
italienische Arbeiten dieser
Art aus der Sammlung B.,
darunter der schon fast
übereich dekorierte rot-
braune Band mit dem
Wappen Papst Clemens X.
(Abb. 22) geben ein typi-
sches Bild von den letzten
Konsequenzen dieses Stils.
Sparsamer sind die Fächer-
motive bei dem stattlichen
flamm enroten Band der
ehemaligen Heidelberger
Schloßbibliothek (jetzt in
Kassel)angewandt. In gün-
stigem Kontrast mit kräfti-
gen naturalistischen Blüten-
und Blättermotiven findet
man siebeidem 1704 wahr-
scheinlich in Berlin ange-
fertigten Einband der Kas-
seler Bibliothek verwertet,
der mit seinem schwarzen, gleichmäßige Muster bil-
denden Bandwerk wieder mehr an die Gascondeko-
ration erinnert. Sehr reich im Dekor sind auch die
englischen Einbände des 17. Jahrhunderts, die sich aber
von der sonstigen kontinentalen Dekoration der Zeit
wesentlich unterscheiden. Eine üppige Auswahl von
meist kleineren Bändchen aus der Sammlung B., dar-
unter mehrere auf Grund der punktierten Tulpe dem
Samuel Mearne zugeschriebene, zeigt sowohl im
Ganzen eine große Selbständigkeit, wie in den ein-
zelnen Stücken untereinander eine außerordentliche
Mannigfaltigkeit der Verzierung.
Was der Name Gascon für das Zeitalter Louis XIV.
bedeutet, ist der des Derome für das Zeitalter Louis XV.
Diesem Meister dürfte der schöne grüne Band der
Sammlung B. (Abb. 23) angehören, dessen sauber aus
lauter Einzelstempeln zusammengesetztes Spitzenmuster
in der typischen sog. »dentelle ä l'oiseau« gehalten
ist. Bei Exemplaren kleineren Formats wurden die
Randmuster entsprechend vereinfacht, wofür die Samm-
Abb. 13.
lung B. einige Beispiele beibringt, ebenso wie für
solche mit einem Plattenstempel gedruckte Bändchen ä la
dentelle, wie den kaffeebraunen Band für Mme. Adelaide,
die Tochter Ludwigs XIV. Erwähnt wenigstens sei
noch das originelle weiße Schweinslederbändchen von
Le Monnier (Sammlung B.) mit den farbigen Leder-
einlagen von großen naturalistisch gebildeten Blumen-
ranken. Eine reiche Auslage italienischer Einbände
des 18. Jahrhunderts zeigt die Aufnahme dieser fran-
zösischen Spitzendekoration, die aber hier nicht an-
nähernd mit der graziösen Eleganz eines Derome
behandelt ist; auch sind die Wappen meist zu schwer
für die Randverzierungen. Den Übergang zu klassi-
zistischen Formen bringt der immerhin noch sehr
stilvolle Band für Pius VI. (f 1799) aus der Biblio-
thek des Börsenvereins d. Buchhändler (Abb. 24),
dessen Rankenbordüren sich nicht mehr unbehindert
nach der Mitte hin aus-
fransen, sondern in zwei
Parallelränder fest einge-
spannt sich entwickeln. Nur
als Kuriosumsei endlich als
Spezimenderneogotischen
Epoche der mit einer Tem-
pelarchitektur verzierte Ein-
band aus der Sammlung B.
abgebildet (Abb. 25), der
das klägliche Ende einer
langen glanzvollen Ent-
wickelung der Buchbinde-
kunst darstellt.
Über die Ausstellung
der versch iedenen Arten der
alten Buntpapiere, wie sie
seit Anfang des 17. Jahr-
hunderts, teils als Vorsatz-
papiere, teils zum Bekleben
von Mappen usw. in Ge-
brauch kamen, können wir
uns kurz fassen. Keine
Worte und auch keine
Schwarz-Weiß-Abbildungen können eine Vorstellung
geben von der Farbenpracht dieser flüchtig, aber mit
sicherer Berechnung der Wirkung improvisierten
Muster, die die Erinnerung an schillerndes Papageien-
gefieder und funkelnde Pfauenräder wachruft. Nicht
nur in der Technik der Herstellung, sondern auch im
Effekt unterscheiden sich die Gallen- von den Kleister-
papieren, beides handarbeitlich hergestellte Papiere im
Gegensatz zu den von Messingplatten geprägten oder
vom Holzmodel gedruckten, auf der Presse erzeugten
Papieren. Wie eingangs erwähnt, werden die beiden
Handverfahren in der Ausstellung selbst vorgeführt.
An die Ausstellung der Buntpapiere schließt sich
endlich noch eine kleine Sonderausstellung der Leip-
ziger Königl. Akademie für graphische Künste und
Buchgewerbe an, die trotz des naheliegenden gefähr-
lichen Vergleiches mit den alten Meisterstücken manchen
hübschen modernen Einband aufweist, an dem man
auch nach den erlesensten Exemplaren der älteren
Abteilungen noch seine Freude haben kann.
Lyoneser Einband. 16. Jahrb.
DIE BUCHBINDEKUNST DER ALTEN MEISTER
werk der Gasconbände unterscheidet. Für den Sonnen-
könig selbst bestimmt war der kapitale Einband der
Leipziger Universitätsbibliothek (Abb.21), dessen Deckel
abwechselnd mit dem gekrönten L und der Lilie in
Goldpressung dekoriert ist, wahrhaft ein Triumph der
Ökonomie, die aus trockener Wiederholung zweier
an sich absolut reizloser Motive ein derart monu-
mental wirkendes Ganzes zu schaffen verstanden hat.
Ein Büchlein für den König aus der Bibliothek des
Börsenvereins d. Buchhändler zeigt die noch ein-
fachere, für kleinere Bände übliche Dekorierung mit
dem goldgepreßten Wappen in der Mitte und den
vier Lilienstempeln in den Ecken. Zu dem Filigran-
muster Le Gascons kommt dann in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts das Fächermustcr, die Deco-
ration ä l'eventail hinzu, die womöglich noch subtiler,
im übrigen in demselben Stilgeleise liegt und nament-
lich in Italien und Deutsch-
land gepflegt wurde. Einige
italienische Arbeiten dieser
Art aus der Sammlung B.,
darunter der schon fast
übereich dekorierte rot-
braune Band mit dem
Wappen Papst Clemens X.
(Abb. 22) geben ein typi-
sches Bild von den letzten
Konsequenzen dieses Stils.
Sparsamer sind die Fächer-
motive bei dem stattlichen
flamm enroten Band der
ehemaligen Heidelberger
Schloßbibliothek (jetzt in
Kassel)angewandt. In gün-
stigem Kontrast mit kräfti-
gen naturalistischen Blüten-
und Blättermotiven findet
man siebeidem 1704 wahr-
scheinlich in Berlin ange-
fertigten Einband der Kas-
seler Bibliothek verwertet,
der mit seinem schwarzen, gleichmäßige Muster bil-
denden Bandwerk wieder mehr an die Gascondeko-
ration erinnert. Sehr reich im Dekor sind auch die
englischen Einbände des 17. Jahrhunderts, die sich aber
von der sonstigen kontinentalen Dekoration der Zeit
wesentlich unterscheiden. Eine üppige Auswahl von
meist kleineren Bändchen aus der Sammlung B., dar-
unter mehrere auf Grund der punktierten Tulpe dem
Samuel Mearne zugeschriebene, zeigt sowohl im
Ganzen eine große Selbständigkeit, wie in den ein-
zelnen Stücken untereinander eine außerordentliche
Mannigfaltigkeit der Verzierung.
Was der Name Gascon für das Zeitalter Louis XIV.
bedeutet, ist der des Derome für das Zeitalter Louis XV.
Diesem Meister dürfte der schöne grüne Band der
Sammlung B. (Abb. 23) angehören, dessen sauber aus
lauter Einzelstempeln zusammengesetztes Spitzenmuster
in der typischen sog. »dentelle ä l'oiseau« gehalten
ist. Bei Exemplaren kleineren Formats wurden die
Randmuster entsprechend vereinfacht, wofür die Samm-
Abb. 13.
lung B. einige Beispiele beibringt, ebenso wie für
solche mit einem Plattenstempel gedruckte Bändchen ä la
dentelle, wie den kaffeebraunen Band für Mme. Adelaide,
die Tochter Ludwigs XIV. Erwähnt wenigstens sei
noch das originelle weiße Schweinslederbändchen von
Le Monnier (Sammlung B.) mit den farbigen Leder-
einlagen von großen naturalistisch gebildeten Blumen-
ranken. Eine reiche Auslage italienischer Einbände
des 18. Jahrhunderts zeigt die Aufnahme dieser fran-
zösischen Spitzendekoration, die aber hier nicht an-
nähernd mit der graziösen Eleganz eines Derome
behandelt ist; auch sind die Wappen meist zu schwer
für die Randverzierungen. Den Übergang zu klassi-
zistischen Formen bringt der immerhin noch sehr
stilvolle Band für Pius VI. (f 1799) aus der Biblio-
thek des Börsenvereins d. Buchhändler (Abb. 24),
dessen Rankenbordüren sich nicht mehr unbehindert
nach der Mitte hin aus-
fransen, sondern in zwei
Parallelränder fest einge-
spannt sich entwickeln. Nur
als Kuriosumsei endlich als
Spezimenderneogotischen
Epoche der mit einer Tem-
pelarchitektur verzierte Ein-
band aus der Sammlung B.
abgebildet (Abb. 25), der
das klägliche Ende einer
langen glanzvollen Ent-
wickelung der Buchbinde-
kunst darstellt.
Über die Ausstellung
der versch iedenen Arten der
alten Buntpapiere, wie sie
seit Anfang des 17. Jahr-
hunderts, teils als Vorsatz-
papiere, teils zum Bekleben
von Mappen usw. in Ge-
brauch kamen, können wir
uns kurz fassen. Keine
Worte und auch keine
Schwarz-Weiß-Abbildungen können eine Vorstellung
geben von der Farbenpracht dieser flüchtig, aber mit
sicherer Berechnung der Wirkung improvisierten
Muster, die die Erinnerung an schillerndes Papageien-
gefieder und funkelnde Pfauenräder wachruft. Nicht
nur in der Technik der Herstellung, sondern auch im
Effekt unterscheiden sich die Gallen- von den Kleister-
papieren, beides handarbeitlich hergestellte Papiere im
Gegensatz zu den von Messingplatten geprägten oder
vom Holzmodel gedruckten, auf der Presse erzeugten
Papieren. Wie eingangs erwähnt, werden die beiden
Handverfahren in der Ausstellung selbst vorgeführt.
An die Ausstellung der Buntpapiere schließt sich
endlich noch eine kleine Sonderausstellung der Leip-
ziger Königl. Akademie für graphische Künste und
Buchgewerbe an, die trotz des naheliegenden gefähr-
lichen Vergleiches mit den alten Meisterstücken manchen
hübschen modernen Einband aufweist, an dem man
auch nach den erlesensten Exemplaren der älteren
Abteilungen noch seine Freude haben kann.
Lyoneser Einband. 16. Jahrb.