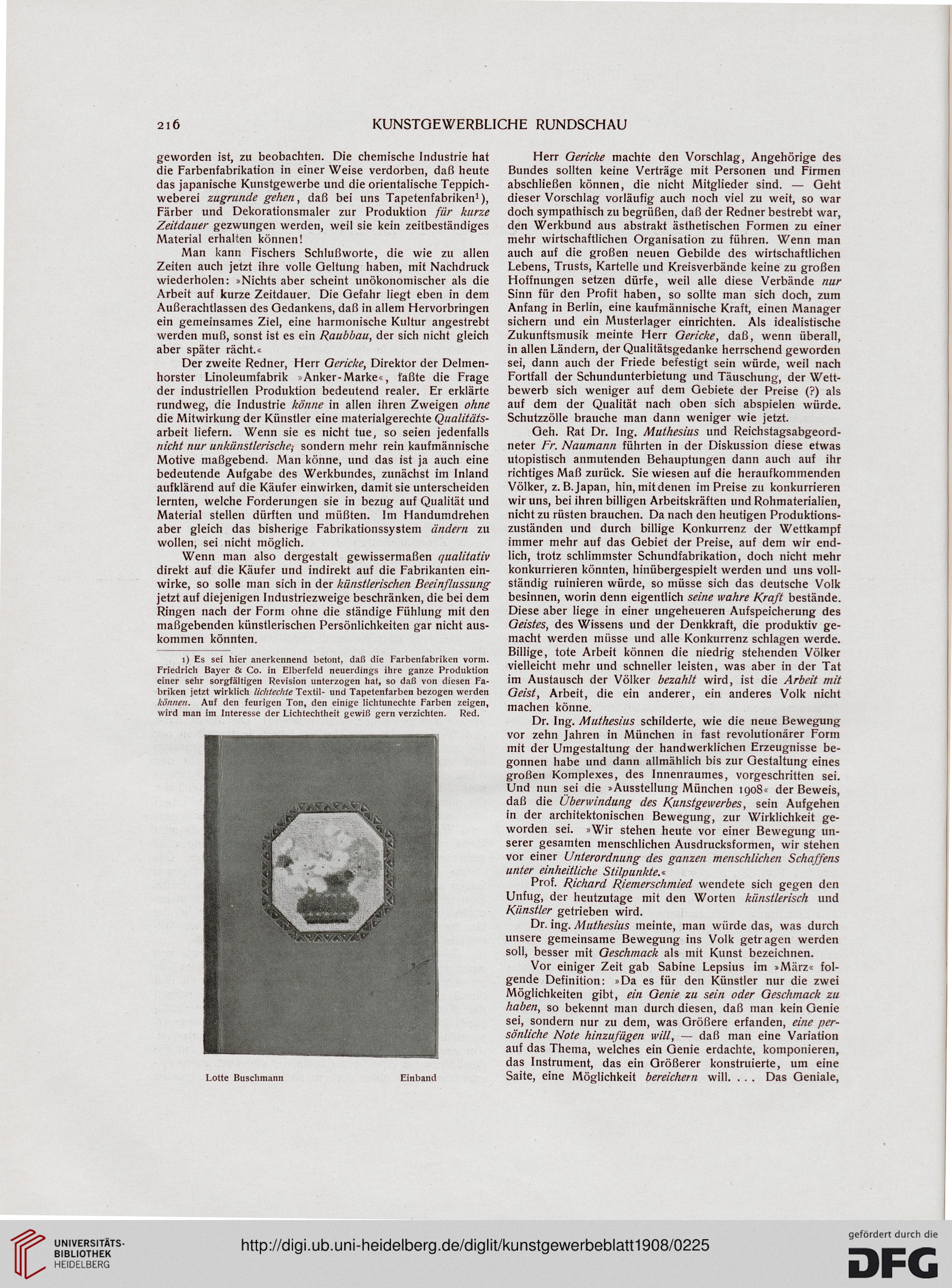2l6
KUNSTGEWERBLICHE RUNDSCHAU
geworden ist, zu beobachten. Die chemische Industrie hat
die Farbenfabrikation in einer Weise verdorben, daß heute
das japanische Kunstgewerbe und die orientalische Teppich-
weberei zugrunde gehen, daß bei uns Tapetenfabriken1),
Färber und Dekorationsmaler zur Produktion für kurze
Zeitdauer gezwungen werden, weil sie kein zeitbeständiges
Material erhalten können!
Man kann Fischers Schlußworte, die wie zu allen
Zeiten auch jetzt ihre volle Geltung haben, mit Nachdruck
wiederholen: »Nichts aber scheint unökonomischer als die
Arbeit auf kurze Zeitdauer. Die Gefahr liegt eben in dem
Außerachtlassen des Gedankens, daß in allem Hervorbringen
ein gemeinsames Ziel, eine harmonische Kultur angestrebt
werden muß, sonst ist es ein Raubbau, der sich nicht gleich
aber später rächt.«
Der zweite Redner, Herr Gericke, Direktor der Delmen-
horster Linoleumfabrik »Anker-Marke«, faßte die Frage
der industriellen Produktion bedeutend realer. Er erklärte
rundweg, die Industrie könne in allen ihren Zweigen ohne
die Mitwirkung der Künstler eine materialgerechte Qualitäts-
arbeit liefern. Wenn sie es nicht tue, so seien jedenfalls
nicht nur unkünstlerische; sondern mehr rein kaufmännische
Motive maßgebend. Man könne, und das ist ja auch eine
bedeutende Aufgabe des Werkbundes, zunächst im Inland
aufklärend auf die Käufer einwirken, damit sie unterscheiden
lernten, welche Forderungen sie in bezug auf Qualität und
Material stellen dürften und müßten. Im Handumdrehen
aber gleich das bisherige Fabrikationssystem ändern zu
wollen, sei nicht möglich.
Wenn man also dergestalt gewissermaßen qualitativ
direkt auf die Käufer und indirekt auf die Fabrikanten ein-
wirke, so solle man sich in der künstlerischen Beeinflussung
jetzt auf diejenigen Industriezweige beschränken, die bei dem
Ringen nach der Form ohne die ständige Fühlung mit den
maßgebenden künstlerischen Persönlichkeiten gar nicht aus-
kommen könnten.
1) Es sei hier anerkennend betont, daß die Farbenfabriken vorm.
Friedrich Bayer & Co. in Elberfeld neuerdings ihre ganze Produktion
einer sehr sorgfältigen Revision unterzogen hat, so daß von diesen Fa-
briken jetzt wirklich lichtechte Textil- und Tapetenfarben bezogen werden
können. Auf den feurigen Ton, den einige lichtunechte Farben zeigen,
wird man im fnteresse der Lichtechtheit gewiß gern verzichten. Red.
Lotte Buschmann
Einband
Herr Gericke machte den Vorschlag, Angehörige des
Bundes sollten keine Verträge mit Personen und Firmen
abschließen können, die nicht Mitglieder sind. — Geht
dieser Vorschlag vorläufig auch noch viel zu weit, so war
doch sympathisch zu begrüßen, daß der Redner bestrebt war,
den Werkbund aus abstrakt ästhetischen Formen zu einer
mehr wirtschaftlichen Organisation zu führen. Wenn man
auch auf die großen neuen Gebilde des wirtschaftlichen
Lebens, Trusts, Kartelle und Kreisverbände keine zu großen
Hoffnungen setzen dürfe, weil alle diese Verbände nur
Sinn für den Profit haben, so sollte man sich doch, zum
Anfang in Berlin, eine kaufmännische Kraft, einen Manager
sichern und ein Musterlager einrichten. Als idealistische
Zukunftsmusik meinte Herr Gericke, daß, wenn überall,
in allen Ländern, der Qualitätsgedanke herrschend geworden
sei, dann auch der Friede befestigt sein würde, weil nach
Fortfall der Schundunterbietung und Täuschung, der Wett-
bewerb sich weniger auf dem Gebiete der Preise (?) als
auf dem der Qualität nach oben sich abspielen würde.
Schutzzölle brauche man dann weniger wie jetzt.
Geh. Rat Dr. Ing. Muthesius und Reichstagsabgeord-
neter Fr. Naumann führten in der Diskussion diese etwas
utopistisch anmutenden Behauptungen dann auch auf ihr
richtiges Maß zurück. Sie wiesen auf die heraufkommenden
Völker, z. B.Japan, hin, mit denen im Preise zu konkurrieren
wir uns, bei ihren billigen Arbeitskräften und Rohmaterialien,
nicht zu rüsten brauchen. Da nach den heutigen Produktions-
zuständen und durch billige Konkurrenz der Wettkampf
immer mehr auf das Gebiet der Preise, auf dem wir end-
lich, trotz schlimmster Schundfabrikation, doch nicht mehr
konkurrieren könnten, hinübergespielt werden und uns voll-
ständig ruinieren würde, so müsse sich das deutsche Volk
besinnen, worin denn eigentlich seine wahre Kraft bestände.
Diese aber liege in einer ungeheueren Aufspeicherung des
Geistes, des Wissens und der Denkkraft, die produktiv ge-
macht werden müsse und alle Konkurrenz schlagen werde.
Billige, tote Arbeit können die niedrig stehenden Völker
vielleicht mehr und schneller leisten, was aber in der Tat
im Austausch der Völker bezahlt wird, ist die Arbeit mit
Geist, Arbeit, die ein anderer, ein anderes Volk nicht
machen könne.
Dr. Ing. Muthesius schilderte, wie die neue Bewegung
vor zehn Jahren in München in fast revolutionärer Form
mit der Umgestaltung der handwerklichen Erzeugnisse be-
gonnen habe und dann allmählich bis zur Gestaltung eines
großen Komplexes, des Innenraumes, vorgeschritten sei.
Und nun sei die »Ausstellung München 1908« der Beweis,
daß die Überwindung des Kunstgewerbes, sein Aufgehen
in der architektonischen Bewegung, zur Wirklichkeit ge-
worden sei. »Wir stehen heute vor einer Bewegung un-
serer gesamten menschlichen Ausdrucksformen, wir stehen
vor einer Unterordnung des ganzen menschlichen Schaffens
unter einheitliche Stilpunkte.«
Prof. Richard Riemerschmied wendete sich gegen den
Unfug, der heutzutage mit den Worten künstlerisch und
Künstler getrieben wird.
Dr. ing. Muthesius meinte, man würde das, was durch
unsere gemeinsame Bewegung ins Volk getragen werden
soll, besser mit Geschmack als mit Kunst bezeichnen.
Vor einiger Zeit gab Sabine Lepsius im »März« fol-
gende Definition: »Da es für den Künstler nur die zwei
Möglichkeiten gibt, ein Genie zu sein oder Geschmack zu
haben, so bekennt man durch diesen, daß man kein Genie
sei, sondern nur zu dem, was Größere erfanden, eine per-
sönliche Note hinzufügen will, — daß man eine Variation
auf das Thema, welches ein Genie erdachte, komponieren,
das Instrument, das ein Größerer konstruierte, um eine
Saite, eine Möglichkeit bereichern will. . . . Das Geniale,
KUNSTGEWERBLICHE RUNDSCHAU
geworden ist, zu beobachten. Die chemische Industrie hat
die Farbenfabrikation in einer Weise verdorben, daß heute
das japanische Kunstgewerbe und die orientalische Teppich-
weberei zugrunde gehen, daß bei uns Tapetenfabriken1),
Färber und Dekorationsmaler zur Produktion für kurze
Zeitdauer gezwungen werden, weil sie kein zeitbeständiges
Material erhalten können!
Man kann Fischers Schlußworte, die wie zu allen
Zeiten auch jetzt ihre volle Geltung haben, mit Nachdruck
wiederholen: »Nichts aber scheint unökonomischer als die
Arbeit auf kurze Zeitdauer. Die Gefahr liegt eben in dem
Außerachtlassen des Gedankens, daß in allem Hervorbringen
ein gemeinsames Ziel, eine harmonische Kultur angestrebt
werden muß, sonst ist es ein Raubbau, der sich nicht gleich
aber später rächt.«
Der zweite Redner, Herr Gericke, Direktor der Delmen-
horster Linoleumfabrik »Anker-Marke«, faßte die Frage
der industriellen Produktion bedeutend realer. Er erklärte
rundweg, die Industrie könne in allen ihren Zweigen ohne
die Mitwirkung der Künstler eine materialgerechte Qualitäts-
arbeit liefern. Wenn sie es nicht tue, so seien jedenfalls
nicht nur unkünstlerische; sondern mehr rein kaufmännische
Motive maßgebend. Man könne, und das ist ja auch eine
bedeutende Aufgabe des Werkbundes, zunächst im Inland
aufklärend auf die Käufer einwirken, damit sie unterscheiden
lernten, welche Forderungen sie in bezug auf Qualität und
Material stellen dürften und müßten. Im Handumdrehen
aber gleich das bisherige Fabrikationssystem ändern zu
wollen, sei nicht möglich.
Wenn man also dergestalt gewissermaßen qualitativ
direkt auf die Käufer und indirekt auf die Fabrikanten ein-
wirke, so solle man sich in der künstlerischen Beeinflussung
jetzt auf diejenigen Industriezweige beschränken, die bei dem
Ringen nach der Form ohne die ständige Fühlung mit den
maßgebenden künstlerischen Persönlichkeiten gar nicht aus-
kommen könnten.
1) Es sei hier anerkennend betont, daß die Farbenfabriken vorm.
Friedrich Bayer & Co. in Elberfeld neuerdings ihre ganze Produktion
einer sehr sorgfältigen Revision unterzogen hat, so daß von diesen Fa-
briken jetzt wirklich lichtechte Textil- und Tapetenfarben bezogen werden
können. Auf den feurigen Ton, den einige lichtunechte Farben zeigen,
wird man im fnteresse der Lichtechtheit gewiß gern verzichten. Red.
Lotte Buschmann
Einband
Herr Gericke machte den Vorschlag, Angehörige des
Bundes sollten keine Verträge mit Personen und Firmen
abschließen können, die nicht Mitglieder sind. — Geht
dieser Vorschlag vorläufig auch noch viel zu weit, so war
doch sympathisch zu begrüßen, daß der Redner bestrebt war,
den Werkbund aus abstrakt ästhetischen Formen zu einer
mehr wirtschaftlichen Organisation zu führen. Wenn man
auch auf die großen neuen Gebilde des wirtschaftlichen
Lebens, Trusts, Kartelle und Kreisverbände keine zu großen
Hoffnungen setzen dürfe, weil alle diese Verbände nur
Sinn für den Profit haben, so sollte man sich doch, zum
Anfang in Berlin, eine kaufmännische Kraft, einen Manager
sichern und ein Musterlager einrichten. Als idealistische
Zukunftsmusik meinte Herr Gericke, daß, wenn überall,
in allen Ländern, der Qualitätsgedanke herrschend geworden
sei, dann auch der Friede befestigt sein würde, weil nach
Fortfall der Schundunterbietung und Täuschung, der Wett-
bewerb sich weniger auf dem Gebiete der Preise (?) als
auf dem der Qualität nach oben sich abspielen würde.
Schutzzölle brauche man dann weniger wie jetzt.
Geh. Rat Dr. Ing. Muthesius und Reichstagsabgeord-
neter Fr. Naumann führten in der Diskussion diese etwas
utopistisch anmutenden Behauptungen dann auch auf ihr
richtiges Maß zurück. Sie wiesen auf die heraufkommenden
Völker, z. B.Japan, hin, mit denen im Preise zu konkurrieren
wir uns, bei ihren billigen Arbeitskräften und Rohmaterialien,
nicht zu rüsten brauchen. Da nach den heutigen Produktions-
zuständen und durch billige Konkurrenz der Wettkampf
immer mehr auf das Gebiet der Preise, auf dem wir end-
lich, trotz schlimmster Schundfabrikation, doch nicht mehr
konkurrieren könnten, hinübergespielt werden und uns voll-
ständig ruinieren würde, so müsse sich das deutsche Volk
besinnen, worin denn eigentlich seine wahre Kraft bestände.
Diese aber liege in einer ungeheueren Aufspeicherung des
Geistes, des Wissens und der Denkkraft, die produktiv ge-
macht werden müsse und alle Konkurrenz schlagen werde.
Billige, tote Arbeit können die niedrig stehenden Völker
vielleicht mehr und schneller leisten, was aber in der Tat
im Austausch der Völker bezahlt wird, ist die Arbeit mit
Geist, Arbeit, die ein anderer, ein anderes Volk nicht
machen könne.
Dr. Ing. Muthesius schilderte, wie die neue Bewegung
vor zehn Jahren in München in fast revolutionärer Form
mit der Umgestaltung der handwerklichen Erzeugnisse be-
gonnen habe und dann allmählich bis zur Gestaltung eines
großen Komplexes, des Innenraumes, vorgeschritten sei.
Und nun sei die »Ausstellung München 1908« der Beweis,
daß die Überwindung des Kunstgewerbes, sein Aufgehen
in der architektonischen Bewegung, zur Wirklichkeit ge-
worden sei. »Wir stehen heute vor einer Bewegung un-
serer gesamten menschlichen Ausdrucksformen, wir stehen
vor einer Unterordnung des ganzen menschlichen Schaffens
unter einheitliche Stilpunkte.«
Prof. Richard Riemerschmied wendete sich gegen den
Unfug, der heutzutage mit den Worten künstlerisch und
Künstler getrieben wird.
Dr. ing. Muthesius meinte, man würde das, was durch
unsere gemeinsame Bewegung ins Volk getragen werden
soll, besser mit Geschmack als mit Kunst bezeichnen.
Vor einiger Zeit gab Sabine Lepsius im »März« fol-
gende Definition: »Da es für den Künstler nur die zwei
Möglichkeiten gibt, ein Genie zu sein oder Geschmack zu
haben, so bekennt man durch diesen, daß man kein Genie
sei, sondern nur zu dem, was Größere erfanden, eine per-
sönliche Note hinzufügen will, — daß man eine Variation
auf das Thema, welches ein Genie erdachte, komponieren,
das Instrument, das ein Größerer konstruierte, um eine
Saite, eine Möglichkeit bereichern will. . . . Das Geniale,