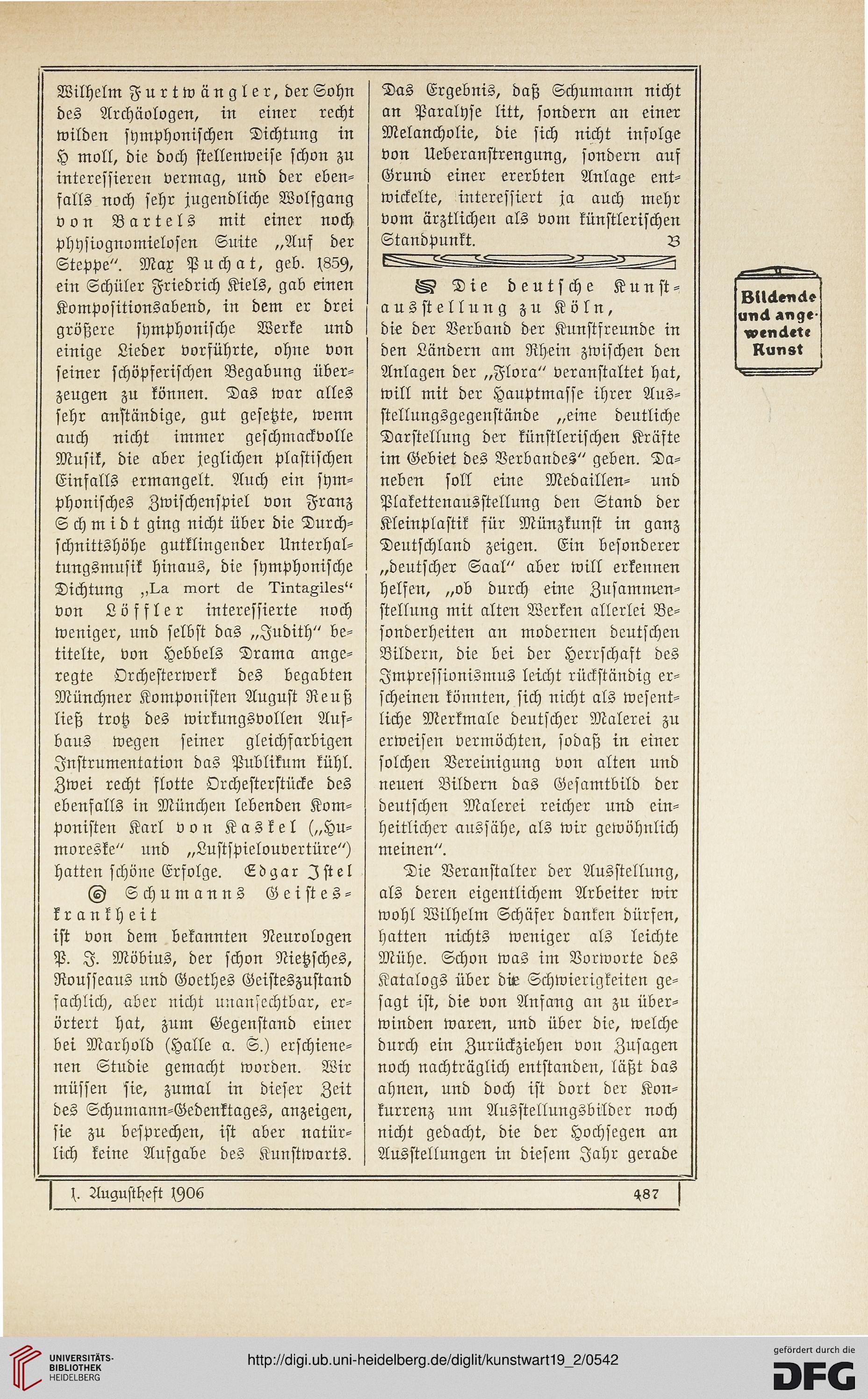Wilhelm Furtwängler, der Sohn
des Archäologen, in einer recht
wilden symphonischen Dichtung in
H moll, die doch stellenweise schon zu
interessieren vermag, und der eben-
falls noch sehr jugendliche Wolfgang
von Bartels mit einer noch
physiognomielosen Suite „Auf der
Steppe". Max Puchat, geb. s859,
ein Schnler Friedrich Kiels, gab einen
Kompositionsabend, in dem er drei
größere symphonische Werke und
einige Lieder vorfnhrte, ohne von
seiner schöpferischen Begabung über-
zeugen zu können. Das war alles
sehr anständige, gut gesetzte, wenn
auch nicht immer geschmackvolle
Musik, die aber jeglichen plastischen
Einfalls ermangelt. Auch ein sym-
phonisches Zwischenspiel von Franz
Schmidt ging nicht über die Durch-
schnittshöhe gutklingender Unterhal-
tungsmusik hinaus, die symphonische
Dichtung mori cke DiutuAcke8^
von Löffler interessierte noch
weniger, und selbst das „Jndith" be-
titelte, von Hebbels Drama ange-
regte Orchesterwerk des begabten
Münchner Komponisten August Reuß
ließ trotz des wirknngsvollen Auf-
baus wegen seiner gleichfarbigen
Jnstrumentation das Publikum kühl.
Zwei recht flotte Orchesterstücke des
ebenfalls in München lebenden Kom-
ponisten Karl von Kaskel („Hu-
moreske" und „Lustspielouvertüre")
hatten schöne Erfolge. Ldgar Istel
Schumanns Geistes-
krankheit
ist von dem bekannten Neurologen
P. I. Möbius, der schon Nietzsches,
Rousseans und Goethes Geisteszustand
fachlich, aber nicht unansechtbar, er-
örtert hat, zum Gegenstand einer
bei Marhold (Halle a. S.) erschiene-
nen Studie gemacht worden. Wir
müssen sie, zumal in dieser Zeit
des Schumann-Gedenktages, anzeigen,
sie zu besprechen, ist aber natür-
lich keine Aufgabe des Kunstwarts.
Das Ergebnis, daß Schumann nicht
an Paralyse litt, sondern an einer
Melancholie, die sich nicht infolge
von Ueberanstrengung, sondern auf
Grnnd einer ererbten Anlage ent-
wickelte, interessiert ja auch mehr
vom ärztlichen als vom künstlerischen
Standpunkt. B
M Die deutsche Kunst-
ausstellung zu Köln,
die der Verband der Kunstfreunde in
den Ländern am Rhein zwischen den
Anlagen der „Flora" veranstaltet hat,
will mit der Hauptmasse ihrer Aus-
stellungsgegenstände „eine deutliche
Darstellnng der künstlerischen Kräfte
im Gebiet des Verbandes" geben. Da-
neben solk eine Medaillen- und
Plakettenausstellung den Stand der
Kleinplastik sür Münzkunst in ganz
Deutschland zeigen. Ein besonderer
„deutscher Saal" aber will erkennen
helfen, „ob durch eine Zusammen-
stellung mit alten Werken allerlei Be-
sonderheiten an modernen deutschen
Bildern, die bei der Herrschaft des
Jmpressionismus leicht rückständig er-
scheinen könnten, sich nicht als wesent-
liche Merkmale deutscher Malerei zu
erweisen vermöchten, sodaß in einer
solchen Vereinigung von alten und
neuen Bildern das Gesamtbild der
deutschen Malerei reicher und ein-
heitlicher aussähe, als wir gewöhnlich
meinen".
Die Veranstalter der Ausstellung,
als deren eigentlichem Arbeiter wiv
wohl Wilhelm Schäfer danken dürfen,
hatten nichts weniger als leichte
Mühe. Schon was im Vorworte des
Katalogs über düe Schwierigk'eiten ge-
sagt ist, die von Anfang an zu über-
winden waren, und über die, welche
durch ein Zurückziehen von Zusagen
noch nachträglich entstanden, läßt das
ahnen, und doch ist dort der Kon-
k'urrenz um Ausstellungsbilder noch
nicht gedacht, die der Hochsegen an
Ausstellungen in diesem Jahr gerade
j. Augustheft (906 -(87 I
»ng«
ven<t«<e
kkunsl
des Archäologen, in einer recht
wilden symphonischen Dichtung in
H moll, die doch stellenweise schon zu
interessieren vermag, und der eben-
falls noch sehr jugendliche Wolfgang
von Bartels mit einer noch
physiognomielosen Suite „Auf der
Steppe". Max Puchat, geb. s859,
ein Schnler Friedrich Kiels, gab einen
Kompositionsabend, in dem er drei
größere symphonische Werke und
einige Lieder vorfnhrte, ohne von
seiner schöpferischen Begabung über-
zeugen zu können. Das war alles
sehr anständige, gut gesetzte, wenn
auch nicht immer geschmackvolle
Musik, die aber jeglichen plastischen
Einfalls ermangelt. Auch ein sym-
phonisches Zwischenspiel von Franz
Schmidt ging nicht über die Durch-
schnittshöhe gutklingender Unterhal-
tungsmusik hinaus, die symphonische
Dichtung mori cke DiutuAcke8^
von Löffler interessierte noch
weniger, und selbst das „Jndith" be-
titelte, von Hebbels Drama ange-
regte Orchesterwerk des begabten
Münchner Komponisten August Reuß
ließ trotz des wirknngsvollen Auf-
baus wegen seiner gleichfarbigen
Jnstrumentation das Publikum kühl.
Zwei recht flotte Orchesterstücke des
ebenfalls in München lebenden Kom-
ponisten Karl von Kaskel („Hu-
moreske" und „Lustspielouvertüre")
hatten schöne Erfolge. Ldgar Istel
Schumanns Geistes-
krankheit
ist von dem bekannten Neurologen
P. I. Möbius, der schon Nietzsches,
Rousseans und Goethes Geisteszustand
fachlich, aber nicht unansechtbar, er-
örtert hat, zum Gegenstand einer
bei Marhold (Halle a. S.) erschiene-
nen Studie gemacht worden. Wir
müssen sie, zumal in dieser Zeit
des Schumann-Gedenktages, anzeigen,
sie zu besprechen, ist aber natür-
lich keine Aufgabe des Kunstwarts.
Das Ergebnis, daß Schumann nicht
an Paralyse litt, sondern an einer
Melancholie, die sich nicht infolge
von Ueberanstrengung, sondern auf
Grnnd einer ererbten Anlage ent-
wickelte, interessiert ja auch mehr
vom ärztlichen als vom künstlerischen
Standpunkt. B
M Die deutsche Kunst-
ausstellung zu Köln,
die der Verband der Kunstfreunde in
den Ländern am Rhein zwischen den
Anlagen der „Flora" veranstaltet hat,
will mit der Hauptmasse ihrer Aus-
stellungsgegenstände „eine deutliche
Darstellnng der künstlerischen Kräfte
im Gebiet des Verbandes" geben. Da-
neben solk eine Medaillen- und
Plakettenausstellung den Stand der
Kleinplastik sür Münzkunst in ganz
Deutschland zeigen. Ein besonderer
„deutscher Saal" aber will erkennen
helfen, „ob durch eine Zusammen-
stellung mit alten Werken allerlei Be-
sonderheiten an modernen deutschen
Bildern, die bei der Herrschaft des
Jmpressionismus leicht rückständig er-
scheinen könnten, sich nicht als wesent-
liche Merkmale deutscher Malerei zu
erweisen vermöchten, sodaß in einer
solchen Vereinigung von alten und
neuen Bildern das Gesamtbild der
deutschen Malerei reicher und ein-
heitlicher aussähe, als wir gewöhnlich
meinen".
Die Veranstalter der Ausstellung,
als deren eigentlichem Arbeiter wiv
wohl Wilhelm Schäfer danken dürfen,
hatten nichts weniger als leichte
Mühe. Schon was im Vorworte des
Katalogs über düe Schwierigk'eiten ge-
sagt ist, die von Anfang an zu über-
winden waren, und über die, welche
durch ein Zurückziehen von Zusagen
noch nachträglich entstanden, läßt das
ahnen, und doch ist dort der Kon-
k'urrenz um Ausstellungsbilder noch
nicht gedacht, die der Hochsegen an
Ausstellungen in diesem Jahr gerade
j. Augustheft (906 -(87 I
»ng«
ven<t«<e
kkunsl