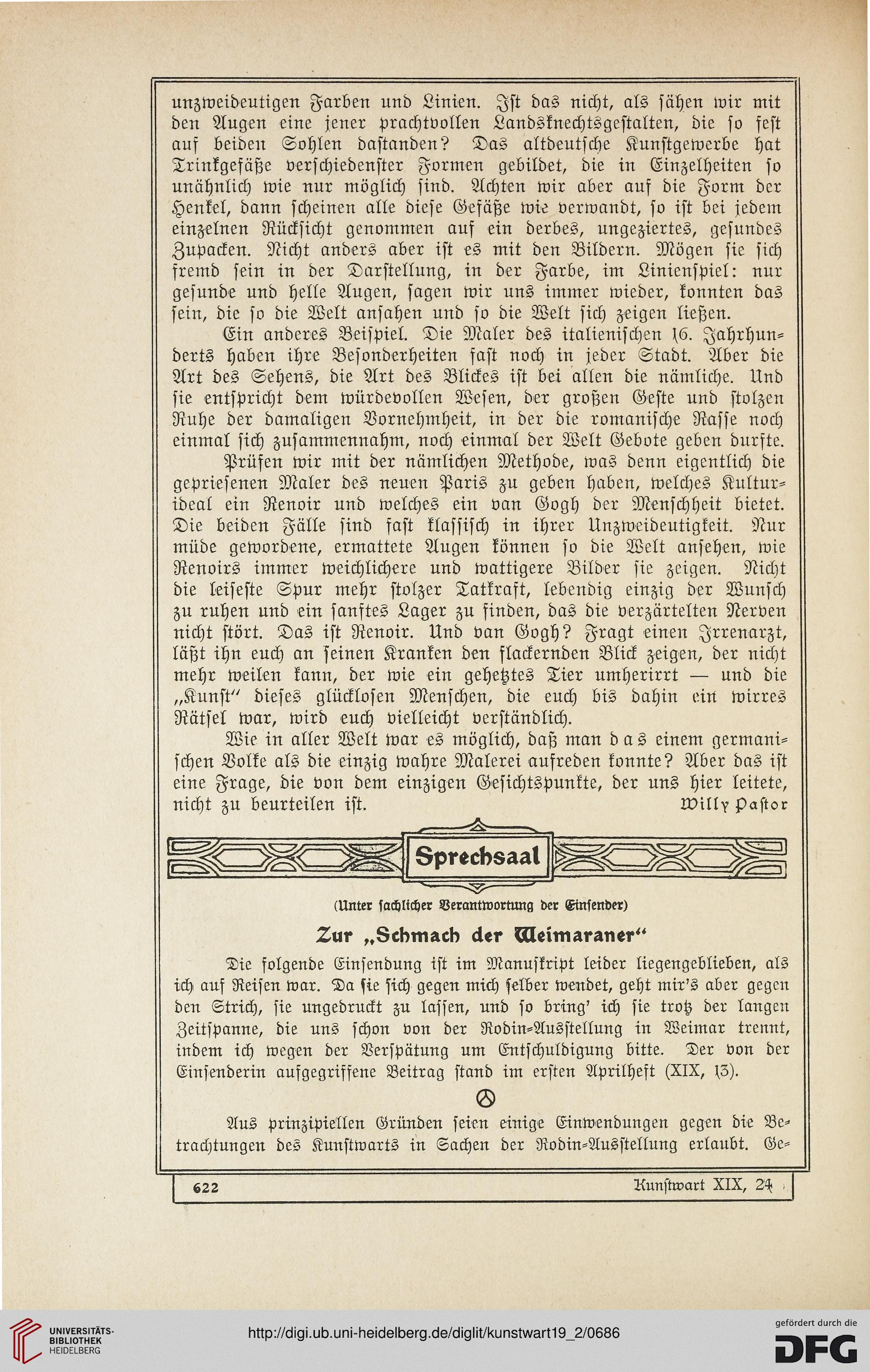unzweideutigen Farbeu und Linieu. Jst das nicht, als sähen wir mit
den Augen eine jener prachtvollen Landsknechtsgestalten, die so sest
aus beiden Sohlen dastanden? Das altdeutsche Kunstgewerbe hat
Trinkgefäße verschiedenster Formen gebildet, die in Einzelheiten so
unähnlich wie nur möglich sind. Achten wir aber auf die Form der
Henkel, dann scheinen alle diese Gefäße wie verwandt, so ist bei jedem
einzelnen Rücksicht genommen auf ein derbes, ungeziertes, gesundes
Zupacken. Nicht anders aber ist es mit den Bildern. Mögen sie sich
sremd sein in der Darstellung, in der Farbe, im Linienspiel: nur
gesunde und helle Augen, sagen wir uns immer wieder, konnten das
sein, die so die Welt ansahen und so die Welt sich zeigen ließen.
Ein anderes Beispiel. Die Maler des italienischen s6. Jahrhun-
derts haben ihre Besonderheiten sast noch in jeder Stadt. Aber die
Art des Sehens, die Art des Blickes ist bei allen die nämliche. Und
sie entspricht dem würdevollen Wesen, der großen Geste und stolzen
Ruhe der damaligen Vornehmheit, in der die romanische Rasse noch
einmal sich zusammennahm, noch einmal der Welt Gebote geben durfte.
Prüfen wir mit der nämlichen Methode, was denn eigentlich die
gepriesenen Maler des neuen Paris zu geben haben, welches Kultur-
ideal ein Renoir nnd welches ein van Gogh der Menschheit bietet.
Die beiden Fälle sind fast klassisch in ihrer Unzweideutigkeit. Nur
müde gewordene, ermattete Augen können so die Welt ansehen, wie
Renoirs immer weichlichere und wattigere Bilder sie zeigen. Nicht
die leiseste Spur mehr stolzer Tatkrast, lebendig einzig der Wunsch
zu ruhen und ein sanstes Lager zu sinden, das die verzärtelten Nerven
nicht stört. Das ist Renoir. Und van Gogh? Fragt einen Jrrenarzt,
läßt ihn euch an seinen Kranken den flackernden Blick zeigen, der nicht
mehr weilen kann, der wie ein gehetztes Tier umherirrt — und die
„Kunst" dieses glücklosen Menschen, die euch bis dahin e.itt wirres
Rätsel war, wird euch vielleicht verständlich.
Wie in aller Welt war es möglich, daß man das einem germani-
schen Volke als die einzig wahre Malerei aufreden konnte? Aber das ist
eine Frage, die von dem einzigen Gesichtspunkte, der uns hier leitete,
nicht zu beurteilen ist. lVilly pastor
lUnter sachlicher Verantwortung der Etnsender)
,.8ckmack cter Meimaraner"
Die folgende Einsendung ist im Manuskript leider liegengeblieben, als
ich auf Reisen war. Da sie sich gegen mich selber wendet, geht mir's aber gegen
den Strich, sie ungedruckt zu lassen, und so bring' ich sie trotz der langen
Zeitspanne, die uns schon von der Rodin-Ausstellung in Weimar trennt,
indem ich wegen der Verspätung um Entschuldigung bitte. Der von der
Einsenderin aufgegrisfene Beitrag stand im ersten Aprilheft (XIX, j3).
G
Aus prinzipiellen Gründen seien einige Einwendungen gegen die Be-
trachtungen des Kunstwarts in Sachen der Rodin-Ausstellung erlaubt. Ge-
ltunstwart XIX, 24
den Augen eine jener prachtvollen Landsknechtsgestalten, die so sest
aus beiden Sohlen dastanden? Das altdeutsche Kunstgewerbe hat
Trinkgefäße verschiedenster Formen gebildet, die in Einzelheiten so
unähnlich wie nur möglich sind. Achten wir aber auf die Form der
Henkel, dann scheinen alle diese Gefäße wie verwandt, so ist bei jedem
einzelnen Rücksicht genommen auf ein derbes, ungeziertes, gesundes
Zupacken. Nicht anders aber ist es mit den Bildern. Mögen sie sich
sremd sein in der Darstellung, in der Farbe, im Linienspiel: nur
gesunde und helle Augen, sagen wir uns immer wieder, konnten das
sein, die so die Welt ansahen und so die Welt sich zeigen ließen.
Ein anderes Beispiel. Die Maler des italienischen s6. Jahrhun-
derts haben ihre Besonderheiten sast noch in jeder Stadt. Aber die
Art des Sehens, die Art des Blickes ist bei allen die nämliche. Und
sie entspricht dem würdevollen Wesen, der großen Geste und stolzen
Ruhe der damaligen Vornehmheit, in der die romanische Rasse noch
einmal sich zusammennahm, noch einmal der Welt Gebote geben durfte.
Prüfen wir mit der nämlichen Methode, was denn eigentlich die
gepriesenen Maler des neuen Paris zu geben haben, welches Kultur-
ideal ein Renoir nnd welches ein van Gogh der Menschheit bietet.
Die beiden Fälle sind fast klassisch in ihrer Unzweideutigkeit. Nur
müde gewordene, ermattete Augen können so die Welt ansehen, wie
Renoirs immer weichlichere und wattigere Bilder sie zeigen. Nicht
die leiseste Spur mehr stolzer Tatkrast, lebendig einzig der Wunsch
zu ruhen und ein sanstes Lager zu sinden, das die verzärtelten Nerven
nicht stört. Das ist Renoir. Und van Gogh? Fragt einen Jrrenarzt,
läßt ihn euch an seinen Kranken den flackernden Blick zeigen, der nicht
mehr weilen kann, der wie ein gehetztes Tier umherirrt — und die
„Kunst" dieses glücklosen Menschen, die euch bis dahin e.itt wirres
Rätsel war, wird euch vielleicht verständlich.
Wie in aller Welt war es möglich, daß man das einem germani-
schen Volke als die einzig wahre Malerei aufreden konnte? Aber das ist
eine Frage, die von dem einzigen Gesichtspunkte, der uns hier leitete,
nicht zu beurteilen ist. lVilly pastor
lUnter sachlicher Verantwortung der Etnsender)
,.8ckmack cter Meimaraner"
Die folgende Einsendung ist im Manuskript leider liegengeblieben, als
ich auf Reisen war. Da sie sich gegen mich selber wendet, geht mir's aber gegen
den Strich, sie ungedruckt zu lassen, und so bring' ich sie trotz der langen
Zeitspanne, die uns schon von der Rodin-Ausstellung in Weimar trennt,
indem ich wegen der Verspätung um Entschuldigung bitte. Der von der
Einsenderin aufgegrisfene Beitrag stand im ersten Aprilheft (XIX, j3).
G
Aus prinzipiellen Gründen seien einige Einwendungen gegen die Be-
trachtungen des Kunstwarts in Sachen der Rodin-Ausstellung erlaubt. Ge-
ltunstwart XIX, 24