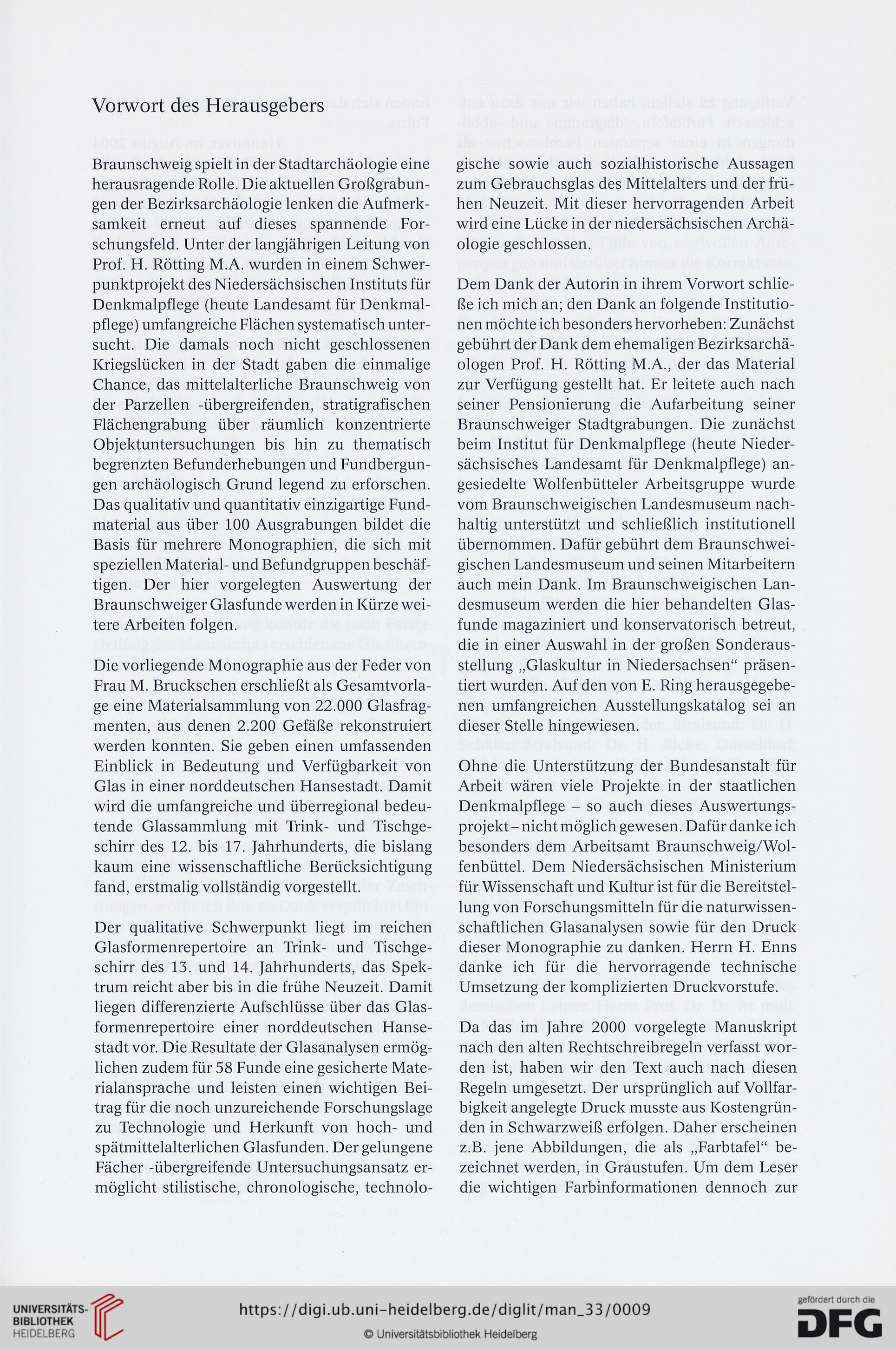Vorwort des Herausgebers
Braunschweig spielt in der Stadtarchäologie eine
herausragende Rolle. Die aktuellen Großgrabun-
gen der Bezirksarchäologie lenken die Aufmerk-
samkeit erneut auf dieses spannende For-
schungsfeld. Unter der langjährigen Leitung von
Prof. H. Rötting M.A. wurden in einem Schwer-
punktprojekt des Niedersächsischen Instituts für
Denkmalpflege (heute Landesamt für Denkmal-
pflege) umfangreiche Flächen systematisch unter-
sucht. Die damals noch nicht geschlossenen
Kriegslücken in der Stadt gaben die einmalige
Chance, das mittelalterliche Braunschweig von
der Parzellen -übergreifenden, stratigrafischen
Flächengrabung über räumlich konzentrierte
Objektuntersuchungen bis hin zu thematisch
begrenzten Befunderhebungen und Fundbergun-
gen archäologisch Grund legend zu erforschen.
Das qualitativ und quantitativ einzigartige Fund-
material aus über 100 Ausgrabungen bildet die
Basis für mehrere Monographien, die sich mit
speziellen Material- und Befundgruppen beschäf-
tigen. Der hier vorgelegten Auswertung der
Braunschweiger Glasfunde werden in Kürze wei-
tere Arbeiten folgen.
Die vorliegende Monographie aus der Feder von
Frau M. Bruckschen erschließt als Gesamtvorla-
ge eine Materialsammlung von 22.000 Glasfrag-
menten, aus denen 2.200 Gefäße rekonstruiert
werden konnten. Sie geben einen umfassenden
Einblick in Bedeutung und Verfügbarkeit von
Glas in einer norddeutschen Hansestadt. Damit
wird die umfangreiche und überregional bedeu-
tende Glassammlung mit Trink- und Tischge-
schirr des 12. bis 17. Jahrhunderts, die bislang
kaum eine wissenschaftliche Berücksichtigung
fand, erstmalig vollständig vorgestellt.
Der qualitative Schwerpunkt liegt im reichen
Glasformenrepertoire an Trink- und Tischge-
schirr des 13. und 14. Jahrhunderts, das Spek-
trum reicht aber bis in die frühe Neuzeit. Damit
liegen differenzierte Aufschlüsse über das Glas-
formenrepertoire einer norddeutschen Hanse-
stadt vor. Die Resultate der Glasanalysen ermög-
lichen zudem für 58 Funde eine gesicherte Mate-
rialansprache und leisten einen wichtigen Bei-
trag für die noch unzureichende Forschungslage
zu Technologie und Herkunft von hoch- und
spätmittelalterlichen Glasfunden. Der gelungene
Fächer -übergreifende Untersuchungsansatz er-
möglicht stilistische, chronologische, technolo-
gische sowie auch sozialhistorische Aussagen
zum Gebrauchsglas des Mittelalters und der frü-
hen Neuzeit. Mit dieser hervorragenden Arbeit
wird eine Lücke in der niedersächsischen Archä-
ologie geschlossen.
Dem Dank der Autorin in ihrem Vorwort schlie-
ße ich mich an; den Dank an folgende Institutio-
nen möchte ich besonders hervorheben: Zunächst
gebührt der Dank dem ehemaligen Bezirksarchä-
ologen Prof. H. Rötting M.A., der das Material
zur Verfügung gestellt hat. Er leitete auch nach
seiner Pensionierung die Aufarbeitung seiner
Braunschweiger Stadtgrabungen. Die zunächst
beim Institut für Denkmalpflege (heute Nieder-
sächsisches Landesamt für Denkmalpflege) an-
gesiedelte Wolfenbütteler Arbeitsgruppe wurde
vom Braunschweigischen Landesmuseum nach-
haltig unterstützt und schließlich institutionell
übernommen. Dafür gebührt dem Braunschwei-
gischen Landesmuseum und seinen Mitarbeitern
auch mein Dank. Im Braunschweigischen Lan-
desmuseum werden die hier behandelten Glas-
funde magaziniert und konservatorisch betreut,
die in einer Auswahl in der großen Sonderaus-
stellung „Glaskultur in Niedersachsen" präsen-
tiert wurden. Auf den von E. Ring herausgegebe-
nen umfangreichen Ausstellungskatalog sei an
dieser Stelle hingewiesen.
Ohne die Unterstützung der Bundesanstalt für
Arbeit wären viele Projekte in der staatlichen
Denkmalpflege - so auch dieses Auswertungs-
projekt - nicht möglich gewesen. Dafür danke ich
besonders dem Arbeitsamt Braunschweig/Wol-
fenbüttel. Dem Niedersächsischen Ministerium
für Wissenschaft und Kultur ist für die Bereitstel-
lung von Forschungsmitteln für die naturwissen-
schaftlichen Glasanalysen sowie für den Druck
dieser Monographie zu danken. Herrn H. Enns
danke ich für die hervorragende technische
Umsetzung der komplizierten Druckvorstufe.
Da das im Jahre 2000 vorgelegte Manuskript
nach den alten Rechtschreibregeln verfasst wor-
den ist, haben wir den Text auch nach diesen
Regeln umgesetzt. Der ursprünglich auf Vollfar-
bigkeit angelegte Druck musste aus Kostengrün-
den in Schwarzweiß erfolgen. Daher erscheinen
z.B. jene Abbildungen, die als „Farbtafel" be-
zeichnet werden, in Graustufen. Um dem Leser
die wichtigen Farbinformationen dennoch zur
Braunschweig spielt in der Stadtarchäologie eine
herausragende Rolle. Die aktuellen Großgrabun-
gen der Bezirksarchäologie lenken die Aufmerk-
samkeit erneut auf dieses spannende For-
schungsfeld. Unter der langjährigen Leitung von
Prof. H. Rötting M.A. wurden in einem Schwer-
punktprojekt des Niedersächsischen Instituts für
Denkmalpflege (heute Landesamt für Denkmal-
pflege) umfangreiche Flächen systematisch unter-
sucht. Die damals noch nicht geschlossenen
Kriegslücken in der Stadt gaben die einmalige
Chance, das mittelalterliche Braunschweig von
der Parzellen -übergreifenden, stratigrafischen
Flächengrabung über räumlich konzentrierte
Objektuntersuchungen bis hin zu thematisch
begrenzten Befunderhebungen und Fundbergun-
gen archäologisch Grund legend zu erforschen.
Das qualitativ und quantitativ einzigartige Fund-
material aus über 100 Ausgrabungen bildet die
Basis für mehrere Monographien, die sich mit
speziellen Material- und Befundgruppen beschäf-
tigen. Der hier vorgelegten Auswertung der
Braunschweiger Glasfunde werden in Kürze wei-
tere Arbeiten folgen.
Die vorliegende Monographie aus der Feder von
Frau M. Bruckschen erschließt als Gesamtvorla-
ge eine Materialsammlung von 22.000 Glasfrag-
menten, aus denen 2.200 Gefäße rekonstruiert
werden konnten. Sie geben einen umfassenden
Einblick in Bedeutung und Verfügbarkeit von
Glas in einer norddeutschen Hansestadt. Damit
wird die umfangreiche und überregional bedeu-
tende Glassammlung mit Trink- und Tischge-
schirr des 12. bis 17. Jahrhunderts, die bislang
kaum eine wissenschaftliche Berücksichtigung
fand, erstmalig vollständig vorgestellt.
Der qualitative Schwerpunkt liegt im reichen
Glasformenrepertoire an Trink- und Tischge-
schirr des 13. und 14. Jahrhunderts, das Spek-
trum reicht aber bis in die frühe Neuzeit. Damit
liegen differenzierte Aufschlüsse über das Glas-
formenrepertoire einer norddeutschen Hanse-
stadt vor. Die Resultate der Glasanalysen ermög-
lichen zudem für 58 Funde eine gesicherte Mate-
rialansprache und leisten einen wichtigen Bei-
trag für die noch unzureichende Forschungslage
zu Technologie und Herkunft von hoch- und
spätmittelalterlichen Glasfunden. Der gelungene
Fächer -übergreifende Untersuchungsansatz er-
möglicht stilistische, chronologische, technolo-
gische sowie auch sozialhistorische Aussagen
zum Gebrauchsglas des Mittelalters und der frü-
hen Neuzeit. Mit dieser hervorragenden Arbeit
wird eine Lücke in der niedersächsischen Archä-
ologie geschlossen.
Dem Dank der Autorin in ihrem Vorwort schlie-
ße ich mich an; den Dank an folgende Institutio-
nen möchte ich besonders hervorheben: Zunächst
gebührt der Dank dem ehemaligen Bezirksarchä-
ologen Prof. H. Rötting M.A., der das Material
zur Verfügung gestellt hat. Er leitete auch nach
seiner Pensionierung die Aufarbeitung seiner
Braunschweiger Stadtgrabungen. Die zunächst
beim Institut für Denkmalpflege (heute Nieder-
sächsisches Landesamt für Denkmalpflege) an-
gesiedelte Wolfenbütteler Arbeitsgruppe wurde
vom Braunschweigischen Landesmuseum nach-
haltig unterstützt und schließlich institutionell
übernommen. Dafür gebührt dem Braunschwei-
gischen Landesmuseum und seinen Mitarbeitern
auch mein Dank. Im Braunschweigischen Lan-
desmuseum werden die hier behandelten Glas-
funde magaziniert und konservatorisch betreut,
die in einer Auswahl in der großen Sonderaus-
stellung „Glaskultur in Niedersachsen" präsen-
tiert wurden. Auf den von E. Ring herausgegebe-
nen umfangreichen Ausstellungskatalog sei an
dieser Stelle hingewiesen.
Ohne die Unterstützung der Bundesanstalt für
Arbeit wären viele Projekte in der staatlichen
Denkmalpflege - so auch dieses Auswertungs-
projekt - nicht möglich gewesen. Dafür danke ich
besonders dem Arbeitsamt Braunschweig/Wol-
fenbüttel. Dem Niedersächsischen Ministerium
für Wissenschaft und Kultur ist für die Bereitstel-
lung von Forschungsmitteln für die naturwissen-
schaftlichen Glasanalysen sowie für den Druck
dieser Monographie zu danken. Herrn H. Enns
danke ich für die hervorragende technische
Umsetzung der komplizierten Druckvorstufe.
Da das im Jahre 2000 vorgelegte Manuskript
nach den alten Rechtschreibregeln verfasst wor-
den ist, haben wir den Text auch nach diesen
Regeln umgesetzt. Der ursprünglich auf Vollfar-
bigkeit angelegte Druck musste aus Kostengrün-
den in Schwarzweiß erfolgen. Daher erscheinen
z.B. jene Abbildungen, die als „Farbtafel" be-
zeichnet werden, in Graustufen. Um dem Leser
die wichtigen Farbinformationen dennoch zur