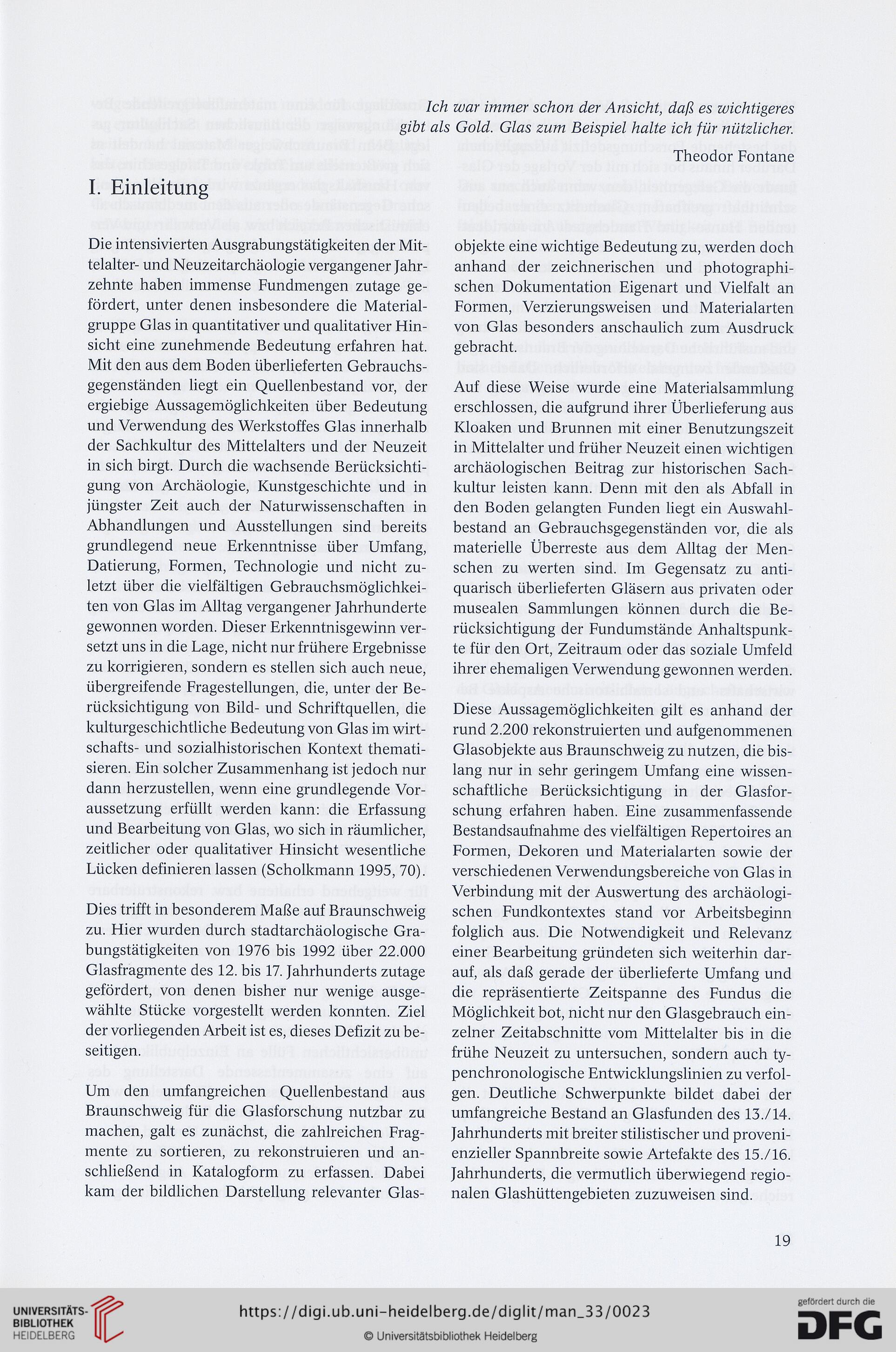Ich war immer schon der Ansicht, daß es wichtigeres
gibt als Gold. Glas zum Beispiel halte ich für nützlicher.
Theodor Fontane
I. Einleitung
Die intensivierten Ausgrabungstätigkeiten der Mit-
telalter- und Neuzeitarchäologie vergangener Jahr-
zehnte haben immense Fundmengen zutage ge-
fördert, unter denen insbesondere die Material-
gruppe Glas in quantitativer und qualitativer Hin-
sicht eine zunehmende Bedeutung erfahren hat.
Mit den aus dem Boden überlieferten Gebrauchs-
gegenständen liegt ein Quellenbestand vor, der
ergiebige Aussagemöglichkeiten über Bedeutung
und Verwendung des Werkstoffes Glas innerhalb
der Sachkultur des Mittelalters und der Neuzeit
in sich birgt. Durch die wachsende Berücksichti-
gung von Archäologie, Kunstgeschichte und in
jüngster Zeit auch der Naturwissenschaften in
Abhandlungen und Ausstellungen sind bereits
grundlegend neue Erkenntnisse über Umfang,
Datierung, Formen, Technologie und nicht zu-
letzt über die vielfältigen Gebrauchsmöglichkei-
ten von Glas im Alltag vergangener Jahrhunderte
gewonnen worden. Dieser Erkenntnisgewinn ver-
setzt uns in die Lage, nicht nur frühere Ergebnisse
zu korrigieren, sondern es stellen sich auch neue,
übergreifende Fragestellungen, die, unter der Be-
rücksichtigung von Bild- und Schriftquellen, die
kulturgeschichtliche Bedeutung von Glas im wirt-
schafts- und sozialhistorischen Kontext themati-
sieren. Ein solcher Zusammenhang ist jedoch nur
dann herzustellen, wenn eine grundlegende Vor-
aussetzung erfüllt werden kann: die Erfassung
und Bearbeitung von Glas, wo sich in räumlicher,
zeitlicher oder qualitativer Hinsicht wesentliche
Lücken definieren lassen (Scholkmann 1995, 70).
Dies trifft in besonderem Maße auf Braunschweig
zu. Hier wurden durch stadtarchäologische Gra-
bungstätigkeiten von 1976 bis 1992 über 22.000
Glasfragmente des 12. bis 17. Jahrhunderts zutage
gefördert, von denen bisher nur wenige ausge-
wählte Stücke vorgestellt werden konnten. Ziel
der vorliegenden Arbeit ist es, dieses Defizit zu be-
seitigen.
Um den umfangreichen Quellenbestand aus
Braunschweig für die Glasforschung nutzbar zu
machen, galt es zunächst, die zahlreichen Frag-
mente zu sortieren, zu rekonstruieren und an-
schließend in Katalogform zu erfassen. Dabei
kam der bildlichen Darstellung relevanter Glas-
objekte eine wichtige Bedeutung zu, werden doch
anhand der zeichnerischen und photographi-
schen Dokumentation Eigenart und Vielfalt an
Formen, Verzierungsweisen und Materialarten
von Glas besonders anschaulich zum Ausdruck
gebracht.
Auf diese Weise wurde eine Materialsammlung
erschlossen, die aufgrund ihrer Überlieferung aus
Kloaken und Brunnen mit einer Benutzungszeit
in Mittelalter und früher Neuzeit einen wichtigen
archäologischen Beitrag zur historischen Sach-
kultur leisten kann. Denn mit den als Abfall in
den Boden gelangten Funden liegt ein Auswahl-
bestand an Gebrauchsgegenständen vor, die als
materielle Überreste aus dem Alltag der Men-
schen zu werten sind. Im Gegensatz zu anti-
quarisch überlieferten Gläsern aus privaten oder
musealen Sammlungen können durch die Be-
rücksichtigung der Fundumstände Anhaltspunk-
te für den Ort, Zeitraum oder das soziale Umfeld
ihrer ehemaligen Verwendung gewonnen werden.
Diese Aussagemöglichkeiten gilt es anhand der
rund 2.200 rekonstruierten und aufgenommenen
Glasobjekte aus Braunschweig zu nutzen, die bis-
lang nur in sehr geringem Umfang eine wissen-
schaftliche Berücksichtigung in der Glasfor-
schung erfahren haben. Eine zusammenfassende
Bestandsaufnahme des vielfältigen Repertoires an
Formen, Dekoren und Materialarten sowie der
verschiedenen Verwendungsbereiche von Glas in
Verbindung mit der Auswertung des archäologi-
schen Fundkontextes stand vor Arbeitsbeginn
folglich aus. Die Notwendigkeit und Relevanz
einer Bearbeitung gründeten sich weiterhin dar-
auf, als daß gerade der überlieferte Umfang und
die repräsentierte Zeitspanne des Fundus die
Möglichkeit bot, nicht nur den Glasgebrauch ein-
zelner Zeitabschnitte vom Mittelalter bis in die
frühe Neuzeit zu untersuchen, sondern auch ty-
penchronologische Entwicklungslinien zu verfol-
gen. Deutliche Schwerpunkte bildet dabei der
umfangreiche Bestand an Glasfunden des 13./14.
Jahrhunderts mit breiter stilistischer und proveni-
enzieller Spannbreite sowie Artefakte des 15./16.
Jahrhunderts, die vermutlich überwiegend regio-
nalen Glashüttengebieten zuzuweisen sind.
19
gibt als Gold. Glas zum Beispiel halte ich für nützlicher.
Theodor Fontane
I. Einleitung
Die intensivierten Ausgrabungstätigkeiten der Mit-
telalter- und Neuzeitarchäologie vergangener Jahr-
zehnte haben immense Fundmengen zutage ge-
fördert, unter denen insbesondere die Material-
gruppe Glas in quantitativer und qualitativer Hin-
sicht eine zunehmende Bedeutung erfahren hat.
Mit den aus dem Boden überlieferten Gebrauchs-
gegenständen liegt ein Quellenbestand vor, der
ergiebige Aussagemöglichkeiten über Bedeutung
und Verwendung des Werkstoffes Glas innerhalb
der Sachkultur des Mittelalters und der Neuzeit
in sich birgt. Durch die wachsende Berücksichti-
gung von Archäologie, Kunstgeschichte und in
jüngster Zeit auch der Naturwissenschaften in
Abhandlungen und Ausstellungen sind bereits
grundlegend neue Erkenntnisse über Umfang,
Datierung, Formen, Technologie und nicht zu-
letzt über die vielfältigen Gebrauchsmöglichkei-
ten von Glas im Alltag vergangener Jahrhunderte
gewonnen worden. Dieser Erkenntnisgewinn ver-
setzt uns in die Lage, nicht nur frühere Ergebnisse
zu korrigieren, sondern es stellen sich auch neue,
übergreifende Fragestellungen, die, unter der Be-
rücksichtigung von Bild- und Schriftquellen, die
kulturgeschichtliche Bedeutung von Glas im wirt-
schafts- und sozialhistorischen Kontext themati-
sieren. Ein solcher Zusammenhang ist jedoch nur
dann herzustellen, wenn eine grundlegende Vor-
aussetzung erfüllt werden kann: die Erfassung
und Bearbeitung von Glas, wo sich in räumlicher,
zeitlicher oder qualitativer Hinsicht wesentliche
Lücken definieren lassen (Scholkmann 1995, 70).
Dies trifft in besonderem Maße auf Braunschweig
zu. Hier wurden durch stadtarchäologische Gra-
bungstätigkeiten von 1976 bis 1992 über 22.000
Glasfragmente des 12. bis 17. Jahrhunderts zutage
gefördert, von denen bisher nur wenige ausge-
wählte Stücke vorgestellt werden konnten. Ziel
der vorliegenden Arbeit ist es, dieses Defizit zu be-
seitigen.
Um den umfangreichen Quellenbestand aus
Braunschweig für die Glasforschung nutzbar zu
machen, galt es zunächst, die zahlreichen Frag-
mente zu sortieren, zu rekonstruieren und an-
schließend in Katalogform zu erfassen. Dabei
kam der bildlichen Darstellung relevanter Glas-
objekte eine wichtige Bedeutung zu, werden doch
anhand der zeichnerischen und photographi-
schen Dokumentation Eigenart und Vielfalt an
Formen, Verzierungsweisen und Materialarten
von Glas besonders anschaulich zum Ausdruck
gebracht.
Auf diese Weise wurde eine Materialsammlung
erschlossen, die aufgrund ihrer Überlieferung aus
Kloaken und Brunnen mit einer Benutzungszeit
in Mittelalter und früher Neuzeit einen wichtigen
archäologischen Beitrag zur historischen Sach-
kultur leisten kann. Denn mit den als Abfall in
den Boden gelangten Funden liegt ein Auswahl-
bestand an Gebrauchsgegenständen vor, die als
materielle Überreste aus dem Alltag der Men-
schen zu werten sind. Im Gegensatz zu anti-
quarisch überlieferten Gläsern aus privaten oder
musealen Sammlungen können durch die Be-
rücksichtigung der Fundumstände Anhaltspunk-
te für den Ort, Zeitraum oder das soziale Umfeld
ihrer ehemaligen Verwendung gewonnen werden.
Diese Aussagemöglichkeiten gilt es anhand der
rund 2.200 rekonstruierten und aufgenommenen
Glasobjekte aus Braunschweig zu nutzen, die bis-
lang nur in sehr geringem Umfang eine wissen-
schaftliche Berücksichtigung in der Glasfor-
schung erfahren haben. Eine zusammenfassende
Bestandsaufnahme des vielfältigen Repertoires an
Formen, Dekoren und Materialarten sowie der
verschiedenen Verwendungsbereiche von Glas in
Verbindung mit der Auswertung des archäologi-
schen Fundkontextes stand vor Arbeitsbeginn
folglich aus. Die Notwendigkeit und Relevanz
einer Bearbeitung gründeten sich weiterhin dar-
auf, als daß gerade der überlieferte Umfang und
die repräsentierte Zeitspanne des Fundus die
Möglichkeit bot, nicht nur den Glasgebrauch ein-
zelner Zeitabschnitte vom Mittelalter bis in die
frühe Neuzeit zu untersuchen, sondern auch ty-
penchronologische Entwicklungslinien zu verfol-
gen. Deutliche Schwerpunkte bildet dabei der
umfangreiche Bestand an Glasfunden des 13./14.
Jahrhunderts mit breiter stilistischer und proveni-
enzieller Spannbreite sowie Artefakte des 15./16.
Jahrhunderts, die vermutlich überwiegend regio-
nalen Glashüttengebieten zuzuweisen sind.
19