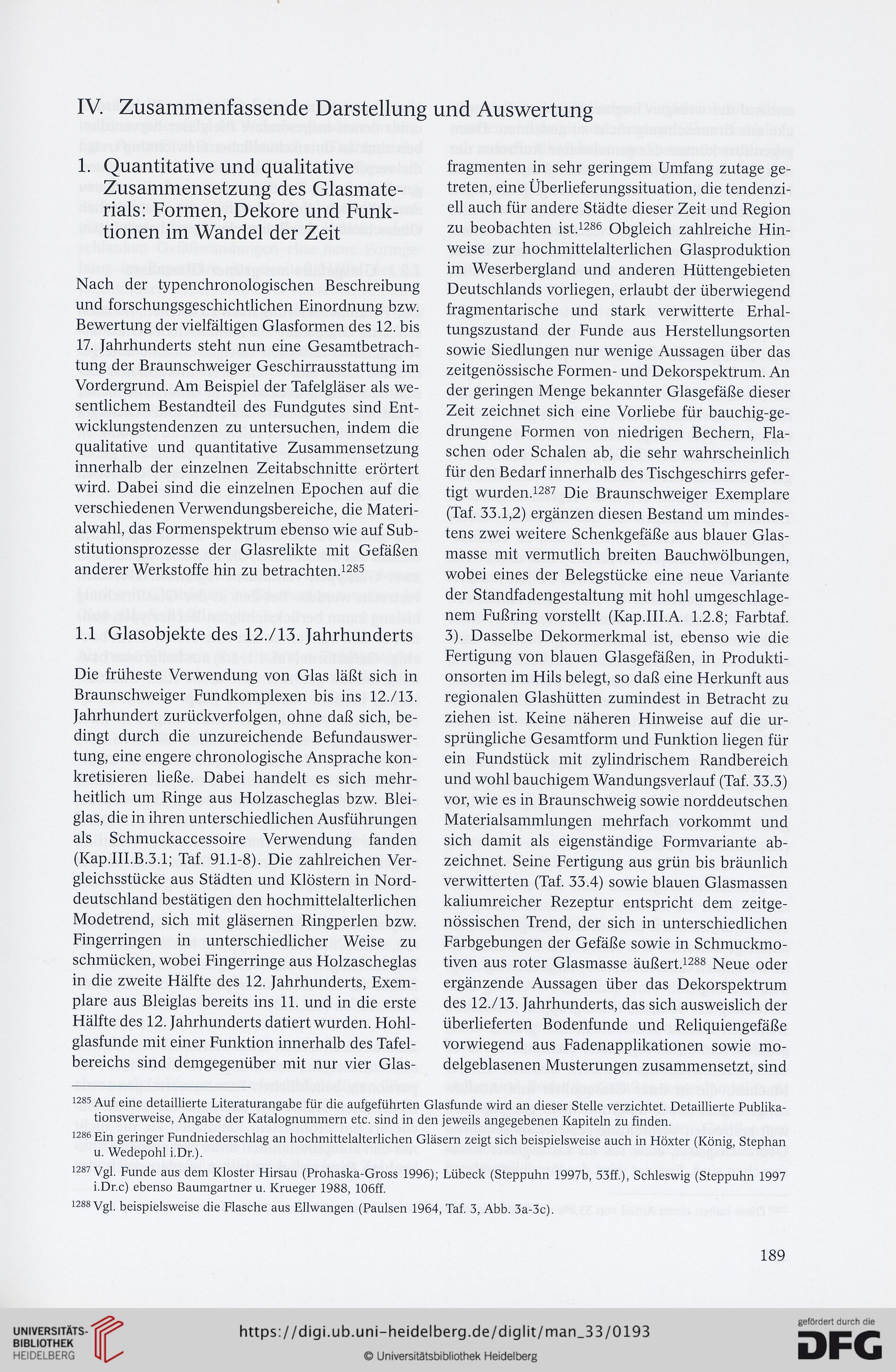IV. Zusammenfassende Darstellung und Auswertung
1. Quantitative und qualitative
Zusammensetzung des Glasmate-
rials: Formen, Dekore und Funk-
tionen im Wandel der Zeit
Nach der typenchronologischen Beschreibung
und forschungsgeschichtlichen Einordnung bzw.
Bewertung der vielfältigen Glasformen des 12. bis
17. Jahrhunderts steht nun eine Gesamtbetrach-
tung der Braunschweiger Geschirrausstattung im
Vordergrund. Am Beispiel der Tafelgläser als we-
sentlichem Bestandteil des Fundgutes sind Ent-
wicklungstendenzen zu untersuchen, indem die
qualitative und quantitative Zusammensetzung
innerhalb der einzelnen Zeitabschnitte erörtert
wird. Dabei sind die einzelnen Epochen auf die
verschiedenen Verwendungsbereiche, die Materi-
alwahl, das Formenspektrum ebenso wie auf Sub-
stitutionsprozesse der Glasrelikte mit Gefäßen
anderer Werkstoffe hin zu betrachten.1285
1.1 Glasobjekte des 12./13. Jahrhunderts
Die früheste Verwendung von Glas läßt sich in
Braunschweiger Fundkomplexen bis ins 12./13.
Jahrhundert zurückverfolgen, ohne daß sich, be-
dingt durch die unzureichende Befundauswer-
tung, eine engere chronologische Ansprache kon-
kretisieren ließe. Dabei handelt es sich mehr-
heitlich um Ringe aus Holzascheglas bzw. Blei-
glas, die in ihren unterschiedlichen Ausführungen
als Schmuckaccessoire Verwendung fanden
(Kap.III.B.3.1; Taf. 91.1-8). Die zahlreichen Ver-
gleichsstücke aus Städten und Klöstern in Nord-
deutschland bestätigen den hochmittelalterlichen
Modetrend, sich mit gläsernen Ringperlen bzw.
Fingerringen in unterschiedlicher Weise zu
schmücken, wobei Fingerringe aus Holzascheglas
in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts, Exem-
plare aus Bleiglas bereits ins 11. und in die erste
Hälfte des 12. Jahrhunderts datiert wurden. Hohl-
glasfunde mit einer Funktion innerhalb des Tafel-
bereichs sind demgegenüber mit nur vier Glas-
fragmenten in sehr geringem Umfang zutage ge-
treten, eine Überlieferungssituation, die tendenzi-
ell auch für andere Städte dieser Zeit und Region
zu beobachten ist.1286 Obgleich zahlreiche Hin-
weise zur hochmittelalterlichen Glasproduktion
im Weserbergland und anderen Hüttengebieten
Deutschlands vorliegen, erlaubt der überwiegend
fragmentarische und stark verwitterte Erhal-
tungszustand der Funde aus Herstellungsorten
sowie Siedlungen nur wenige Aussagen über das
zeitgenössische Formen- und Dekorspektrum. An
der geringen Menge bekannter Glasgefäße dieser
Zeit zeichnet sich eine Vorliebe für bauchig-ge-
drungene Formen von niedrigen Bechern, Fla-
schen oder Schalen ab, die sehr wahrscheinlich
für den Bedarf innerhalb des Tischgeschirrs gefer-
tigt wurden.1287 Die Braunschweiger Exemplare
(Taf. 33.1,2) ergänzen diesen Bestand um mindes-
tens zwei weitere Schenkgefäße aus blauer Glas-
masse mit vermutlich breiten Bauchwölbungen,
wobei eines der Belegstücke eine neue Variante
der Standfadengestaltung mit hohl umgeschlage-
nem Fußring vorstellt (Kap.III.A. 1.2.8; Farbtaf.
3). Dasselbe Dekormerkmal ist, ebenso wie die
Fertigung von blauen Glasgefäßen, in Produkti-
onsorten im Hils belegt, so daß eine Herkunft aus
regionalen Glashütten zumindest in Betracht zu
ziehen ist. Keine näheren Hinweise auf die ur-
sprüngliche Gesamtform und Funktion liegen für
ein Fundstück mit zylindrischem Randbereich
und wohl bauchigem Wandungsverlauf (Taf. 33.3)
vor, wie es in Braunschweig sowie norddeutschen
Materialsammlungen mehrfach vorkommt und
sich damit als eigenständige Formvariante ab-
zeichnet. Seine Fertigung aus grün bis bräunlich
verwitterten (Taf. 33.4) sowie blauen Glasmassen
kaliumreicher Rezeptur entspricht dem zeitge-
nössischen Trend, der sich in unterschiedlichen
Farbgebungen der Gefäße sowie in Schmuckmo-
tiven aus roter Glasmasse äußert.1288 Neue oder
ergänzende Aussagen über das Dekorspektrum
des 12./13. Jahrhunderts, das sich ausweislich der
überlieferten Bodenfunde und Reliquiengefäße
vorwiegend aus Fadenapplikationen sowie mo-
delgeblasenen Musterungen zusammensetzt, sind
1285 Auf eine detaillierte Literaturangabe für die aufgeführten Glasfunde wird an dieser Stelle verzichtet. Detaillierte Publika-
tionsverweise, Angabe der Katalognummern etc. sind in den jeweils angegebenen Kapiteln zu finden.
1286 Ein geringer Fundniederschlag an hochmittelalterlichen Gläsern zeigt sich beispielsweise auch in Höxter (König, Stephan
u. Wedepohl i.Dr.).
1287 Vgi Funde aus dem Kloster Hirsau (Prohaska-Gross 1996); Lübeck (Steppuhn 1997b, 53ff.), Schleswig (Steppuhn 1997
i.Dr.c) ebenso Baumgartner u. Krueger 1988, 106ff.
1288 VgL beispielsweise die Flasche aus Ellwangen (Paulsen 1964, Taf. 3, Abb. 3a-3c).
189
1. Quantitative und qualitative
Zusammensetzung des Glasmate-
rials: Formen, Dekore und Funk-
tionen im Wandel der Zeit
Nach der typenchronologischen Beschreibung
und forschungsgeschichtlichen Einordnung bzw.
Bewertung der vielfältigen Glasformen des 12. bis
17. Jahrhunderts steht nun eine Gesamtbetrach-
tung der Braunschweiger Geschirrausstattung im
Vordergrund. Am Beispiel der Tafelgläser als we-
sentlichem Bestandteil des Fundgutes sind Ent-
wicklungstendenzen zu untersuchen, indem die
qualitative und quantitative Zusammensetzung
innerhalb der einzelnen Zeitabschnitte erörtert
wird. Dabei sind die einzelnen Epochen auf die
verschiedenen Verwendungsbereiche, die Materi-
alwahl, das Formenspektrum ebenso wie auf Sub-
stitutionsprozesse der Glasrelikte mit Gefäßen
anderer Werkstoffe hin zu betrachten.1285
1.1 Glasobjekte des 12./13. Jahrhunderts
Die früheste Verwendung von Glas läßt sich in
Braunschweiger Fundkomplexen bis ins 12./13.
Jahrhundert zurückverfolgen, ohne daß sich, be-
dingt durch die unzureichende Befundauswer-
tung, eine engere chronologische Ansprache kon-
kretisieren ließe. Dabei handelt es sich mehr-
heitlich um Ringe aus Holzascheglas bzw. Blei-
glas, die in ihren unterschiedlichen Ausführungen
als Schmuckaccessoire Verwendung fanden
(Kap.III.B.3.1; Taf. 91.1-8). Die zahlreichen Ver-
gleichsstücke aus Städten und Klöstern in Nord-
deutschland bestätigen den hochmittelalterlichen
Modetrend, sich mit gläsernen Ringperlen bzw.
Fingerringen in unterschiedlicher Weise zu
schmücken, wobei Fingerringe aus Holzascheglas
in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts, Exem-
plare aus Bleiglas bereits ins 11. und in die erste
Hälfte des 12. Jahrhunderts datiert wurden. Hohl-
glasfunde mit einer Funktion innerhalb des Tafel-
bereichs sind demgegenüber mit nur vier Glas-
fragmenten in sehr geringem Umfang zutage ge-
treten, eine Überlieferungssituation, die tendenzi-
ell auch für andere Städte dieser Zeit und Region
zu beobachten ist.1286 Obgleich zahlreiche Hin-
weise zur hochmittelalterlichen Glasproduktion
im Weserbergland und anderen Hüttengebieten
Deutschlands vorliegen, erlaubt der überwiegend
fragmentarische und stark verwitterte Erhal-
tungszustand der Funde aus Herstellungsorten
sowie Siedlungen nur wenige Aussagen über das
zeitgenössische Formen- und Dekorspektrum. An
der geringen Menge bekannter Glasgefäße dieser
Zeit zeichnet sich eine Vorliebe für bauchig-ge-
drungene Formen von niedrigen Bechern, Fla-
schen oder Schalen ab, die sehr wahrscheinlich
für den Bedarf innerhalb des Tischgeschirrs gefer-
tigt wurden.1287 Die Braunschweiger Exemplare
(Taf. 33.1,2) ergänzen diesen Bestand um mindes-
tens zwei weitere Schenkgefäße aus blauer Glas-
masse mit vermutlich breiten Bauchwölbungen,
wobei eines der Belegstücke eine neue Variante
der Standfadengestaltung mit hohl umgeschlage-
nem Fußring vorstellt (Kap.III.A. 1.2.8; Farbtaf.
3). Dasselbe Dekormerkmal ist, ebenso wie die
Fertigung von blauen Glasgefäßen, in Produkti-
onsorten im Hils belegt, so daß eine Herkunft aus
regionalen Glashütten zumindest in Betracht zu
ziehen ist. Keine näheren Hinweise auf die ur-
sprüngliche Gesamtform und Funktion liegen für
ein Fundstück mit zylindrischem Randbereich
und wohl bauchigem Wandungsverlauf (Taf. 33.3)
vor, wie es in Braunschweig sowie norddeutschen
Materialsammlungen mehrfach vorkommt und
sich damit als eigenständige Formvariante ab-
zeichnet. Seine Fertigung aus grün bis bräunlich
verwitterten (Taf. 33.4) sowie blauen Glasmassen
kaliumreicher Rezeptur entspricht dem zeitge-
nössischen Trend, der sich in unterschiedlichen
Farbgebungen der Gefäße sowie in Schmuckmo-
tiven aus roter Glasmasse äußert.1288 Neue oder
ergänzende Aussagen über das Dekorspektrum
des 12./13. Jahrhunderts, das sich ausweislich der
überlieferten Bodenfunde und Reliquiengefäße
vorwiegend aus Fadenapplikationen sowie mo-
delgeblasenen Musterungen zusammensetzt, sind
1285 Auf eine detaillierte Literaturangabe für die aufgeführten Glasfunde wird an dieser Stelle verzichtet. Detaillierte Publika-
tionsverweise, Angabe der Katalognummern etc. sind in den jeweils angegebenen Kapiteln zu finden.
1286 Ein geringer Fundniederschlag an hochmittelalterlichen Gläsern zeigt sich beispielsweise auch in Höxter (König, Stephan
u. Wedepohl i.Dr.).
1287 Vgi Funde aus dem Kloster Hirsau (Prohaska-Gross 1996); Lübeck (Steppuhn 1997b, 53ff.), Schleswig (Steppuhn 1997
i.Dr.c) ebenso Baumgartner u. Krueger 1988, 106ff.
1288 VgL beispielsweise die Flasche aus Ellwangen (Paulsen 1964, Taf. 3, Abb. 3a-3c).
189