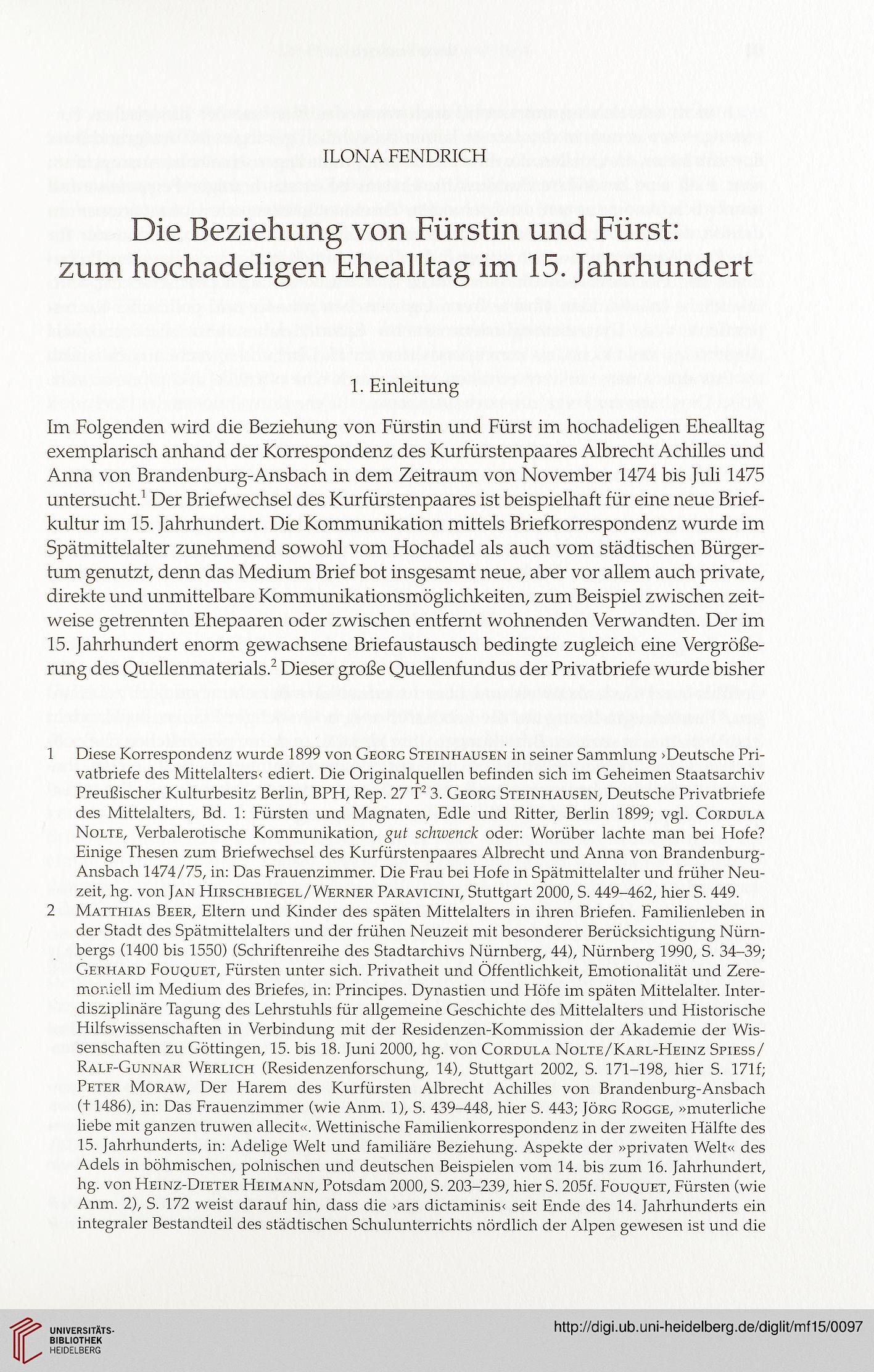ILONA FENDRICH
Die Beziehung von Fürstin und Fürst:
zum hochadeligen Ehealltag im 15. Jahrhundert
1. Einleitung
Im Folgenden wird die Beziehung von Fürstin und Fürst im hochadeligen Ehealltag
exemplarisch anhand der Korrespondenz des Kurfürstenpaares Albrecht Achilles und
Anna von Brandenburg-Ansbach in dem Zeitraum von November 1474 bis Juli 1475
untersucht.1 Der Briefwechsel des Kurfürstenpaares ist beispielhaft für eine neue Brief-
kultur im 15. Jahrhundert. Die Kommunikation mittels Briefkorrespondenz wurde im
Spätmittelalter zunehmend sowohl vom Hochadel als auch vom städtischen Bürger-
tum genutzt, denn das Medium Brief bot insgesamt neue, aber vor allem auch private,
direkte und unmittelbare Kommunikationsmöglichkeiten, zum Beispiel zwischen zeit-
weise getrennten Ehepaaren oder zwischen entfernt wohnenden Verwandten. Der im
15. Jahrhundert enorm gewachsene Briefaustausch bedingte zugleich eine Vergröße-
rung des Quellenmaterials.2 Dieser große Quellenfundus der Privatbriefe wurde bisher
1 Diese Korrespondenz wurde 1899 von Georg Steinhausen in seiner Sammlung > Deutsche Pri-
vatbriefe des Mittelalters« ediert. Die Originalquellen befinden sich im Geheimen Staatsarchiv
Preußischer Kulturbesitz Berlin, BPH, Rep. 27 T2 3. Georg Steinhausen, Deutsche Privatbriefe
des Mittelalters, Bd. 1: Fürsten und Magnaten, Edle und Ritter, Berlin 1899; vgl. Cordula
Nolte, Verbalerotische Kommunikation, gut schiuenck oder: Worüber lachte man bei Hofe?
Einige Thesen zum Briefwechsel des Kurfürstenpaares Albrecht und Anna von Brandenburg-
Ansbach 1474/75, in: Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und früher Neu-
zeit, hg. von Jan Hirschbiegel/Werner Paravicini, Stuttgart 2000, S. 449-462, hier S. 449.
2 Matthias Beer, Eltern und Kinder des späten Mittelalters in ihren Briefen. Familienleben in
der Stadt des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit mit besonderer Berücksichtigung Nürn-
bergs (1400 bis 1550) (Schriftenreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 44), Nürnberg 1990, S. 34-39;
Gerhard Fouquet, Fürsten unter sich. Privatheit und Öffentlichkeit, Emotionalität und Zere-
moniell im Medium des Briefes, in: Principes. Dynastien und Höfe im späten Mittelalter. Inter-
disziplinäre Tagung des Lehrstuhls für allgemeine Geschichte des Mittelalters und Historische
Hilfswissenschaften in Verbindung mit der Residenzen-Kommission der Akademie der Wis-
senschaften zu Göttingen, 15. bis 18. Juni 2000, hg. von Cordula Nolte/Karl-Heinz Spiess/
Ralf-Gunnar Werlich (Residenzenforschung, 14), Stuttgart 2002, S. 171-198, hier S. 171 f;
Peter Moraw, Der Harem des Kurfürsten Albrecht Achilles von Brandenburg-Ansbach
(t 1486), in: Das Frauenzimmer (wie Anm. 1), S. 439-448, hier S. 443; Jörg Rogge, »muterliche
liebe mit ganzen truwen allecit«. Wettinische Familienkorrespondenz in der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts, in: Adelige Welt und familiäre Beziehung. Aspekte der »privaten Welt« des
Adels in böhmischen, polnischen und deutschen Beispielen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert,
hg. von Heinz-Dieter Heimann, Potsdam 2000, S. 203-239, hier S. 205f. Fouquet, Fürsten (wie
Anm. 2), S. 172 weist darauf hin, dass die >ars dictaminis« seit Ende des 14. Jahrhunderts ein
integraler Bestandteil des städtischen Schulunterrichts nördlich der Alpen gewesen ist und die
Die Beziehung von Fürstin und Fürst:
zum hochadeligen Ehealltag im 15. Jahrhundert
1. Einleitung
Im Folgenden wird die Beziehung von Fürstin und Fürst im hochadeligen Ehealltag
exemplarisch anhand der Korrespondenz des Kurfürstenpaares Albrecht Achilles und
Anna von Brandenburg-Ansbach in dem Zeitraum von November 1474 bis Juli 1475
untersucht.1 Der Briefwechsel des Kurfürstenpaares ist beispielhaft für eine neue Brief-
kultur im 15. Jahrhundert. Die Kommunikation mittels Briefkorrespondenz wurde im
Spätmittelalter zunehmend sowohl vom Hochadel als auch vom städtischen Bürger-
tum genutzt, denn das Medium Brief bot insgesamt neue, aber vor allem auch private,
direkte und unmittelbare Kommunikationsmöglichkeiten, zum Beispiel zwischen zeit-
weise getrennten Ehepaaren oder zwischen entfernt wohnenden Verwandten. Der im
15. Jahrhundert enorm gewachsene Briefaustausch bedingte zugleich eine Vergröße-
rung des Quellenmaterials.2 Dieser große Quellenfundus der Privatbriefe wurde bisher
1 Diese Korrespondenz wurde 1899 von Georg Steinhausen in seiner Sammlung > Deutsche Pri-
vatbriefe des Mittelalters« ediert. Die Originalquellen befinden sich im Geheimen Staatsarchiv
Preußischer Kulturbesitz Berlin, BPH, Rep. 27 T2 3. Georg Steinhausen, Deutsche Privatbriefe
des Mittelalters, Bd. 1: Fürsten und Magnaten, Edle und Ritter, Berlin 1899; vgl. Cordula
Nolte, Verbalerotische Kommunikation, gut schiuenck oder: Worüber lachte man bei Hofe?
Einige Thesen zum Briefwechsel des Kurfürstenpaares Albrecht und Anna von Brandenburg-
Ansbach 1474/75, in: Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und früher Neu-
zeit, hg. von Jan Hirschbiegel/Werner Paravicini, Stuttgart 2000, S. 449-462, hier S. 449.
2 Matthias Beer, Eltern und Kinder des späten Mittelalters in ihren Briefen. Familienleben in
der Stadt des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit mit besonderer Berücksichtigung Nürn-
bergs (1400 bis 1550) (Schriftenreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 44), Nürnberg 1990, S. 34-39;
Gerhard Fouquet, Fürsten unter sich. Privatheit und Öffentlichkeit, Emotionalität und Zere-
moniell im Medium des Briefes, in: Principes. Dynastien und Höfe im späten Mittelalter. Inter-
disziplinäre Tagung des Lehrstuhls für allgemeine Geschichte des Mittelalters und Historische
Hilfswissenschaften in Verbindung mit der Residenzen-Kommission der Akademie der Wis-
senschaften zu Göttingen, 15. bis 18. Juni 2000, hg. von Cordula Nolte/Karl-Heinz Spiess/
Ralf-Gunnar Werlich (Residenzenforschung, 14), Stuttgart 2002, S. 171-198, hier S. 171 f;
Peter Moraw, Der Harem des Kurfürsten Albrecht Achilles von Brandenburg-Ansbach
(t 1486), in: Das Frauenzimmer (wie Anm. 1), S. 439-448, hier S. 443; Jörg Rogge, »muterliche
liebe mit ganzen truwen allecit«. Wettinische Familienkorrespondenz in der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts, in: Adelige Welt und familiäre Beziehung. Aspekte der »privaten Welt« des
Adels in böhmischen, polnischen und deutschen Beispielen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert,
hg. von Heinz-Dieter Heimann, Potsdam 2000, S. 203-239, hier S. 205f. Fouquet, Fürsten (wie
Anm. 2), S. 172 weist darauf hin, dass die >ars dictaminis« seit Ende des 14. Jahrhunderts ein
integraler Bestandteil des städtischen Schulunterrichts nördlich der Alpen gewesen ist und die