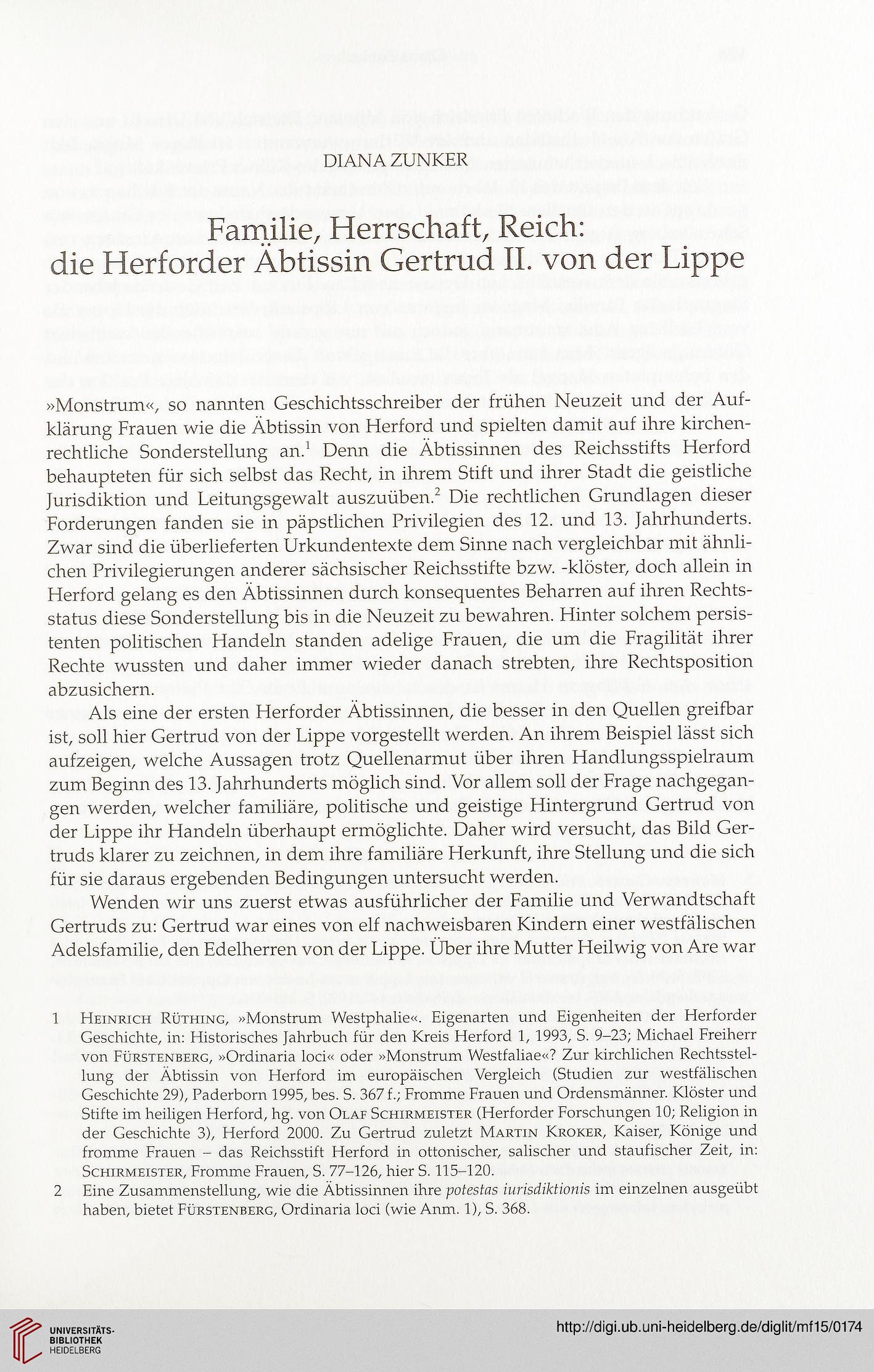DIANA ZUNKER
Familie, Herrschaft, Reich:
die Herforder Äbtissin Gertrud II. von der Lippe
»Monstrum«, so nannten Geschichtsschreiber der frühen Neuzeit und der Auf-
klärung Frauen wie die Äbtissin von Herford und spielten damit auf ihre kirchen-
rechtliche Sonderstellung an.1 Denn die Äbtissinnen des Reichsstifts Herford
behaupteten für sich selbst das Recht, in ihrem Stift und ihrer Stadt die geistliche
Jurisdiktion und Leitungsgewalt auszuüben.2 Die rechtlichen Grundlagen dieser
Forderungen fanden sie in päpstlichen Privilegien des 12. und 13. Jahrhunderts.
Zwar sind die überlieferten Urkundentexte dem Sinne nach vergleichbar mit ähnli-
chen Privilegierungen anderer sächsischer Reichsstifte bzw. -klöster, doch allein in
Herford gelang es den Äbtissinnen durch konsequentes Beharren auf ihren Rechts-
status diese Sonderstellung bis in die Neuzeit zu bewahren. Hinter solchem persis-
tenten politischen Handeln standen adelige Frauen, die um die Fragilität ihrer
Rechte wussten und daher immer wieder danach strebten, ihre Rechtsposition
abzusichern.
Als eine der ersten Herforder Äbtissinnen, die besser in den Quellen greifbar
ist, soll hier Gertrud von der Lippe vorgestellt werden. An ihrem Beispiel lässt sich
aufzeigen, welche Aussagen trotz Quellenarmut über ihren Handlungsspielraum
zum Beginn des 13. Jahrhunderts möglich sind. Vor allem soll der Frage nachgegan-
gen werden, welcher familiäre, politische und geistige Hintergrund Gertrud von
der Lippe ihr Handeln überhaupt ermöglichte. Daher wird versucht, das Bild Ger-
truds klarer zu zeichnen, in dem ihre familiäre Herkunft, ihre Stellung und die sich
für sie daraus ergebenden Bedingungen untersucht werden.
Wenden wir uns zuerst etwas ausführlicher der Familie und Verwandtschaft
Gertruds zu: Gertrud war eines von elf nachweisbaren Kindern einer westfälischen
Adelsfamilie, den Edelherren von der Lippe. Über ihre Mutter Heilwig von Are war
1 Heinrich Rüthing, »Monstrum Westphalie«. Eigenarten und Eigenheiten der Herforder
Geschichte, in: Historisches Jahrbuch für den Kreis Herford 1, 1993, S. 9-23; Michael Freiherr
von Fürstenberg, »Ordinaria loci« oder »Monstrum Westfaliae«? Zur kirchlichen Rechtsstel-
lung der Äbtissin von Herford im europäischen Vergleich (Studien zur westfälischen
Geschichte 29), Paderborn 1995, bes. S. 367 f.; Fromme Frauen und Ordensmänner. Klöster und
Stifte im heiligen Herford, hg. von Olaf Schirmeister (Herforder Forschungen 10; Religion in
der Geschichte 3), Herford 2000. Zu Gertrud zuletzt Martin Kroker, Kaiser, Könige und
fromme Frauen - das Reichsstift Herford in ottonischer, salischer und staufischer Zeit, in:
Schirmeister, Fromme Frauen, S. 77-126, hier S. 115-120.
2 Eine Zusammenstellung, wie die Äbtissinnen ihre potestas iurisdiktionis im einzelnen ausgeübt
haben, bietet Fürstenberg, Ordinaria loci (wie Anm. 1), S. 368.
Familie, Herrschaft, Reich:
die Herforder Äbtissin Gertrud II. von der Lippe
»Monstrum«, so nannten Geschichtsschreiber der frühen Neuzeit und der Auf-
klärung Frauen wie die Äbtissin von Herford und spielten damit auf ihre kirchen-
rechtliche Sonderstellung an.1 Denn die Äbtissinnen des Reichsstifts Herford
behaupteten für sich selbst das Recht, in ihrem Stift und ihrer Stadt die geistliche
Jurisdiktion und Leitungsgewalt auszuüben.2 Die rechtlichen Grundlagen dieser
Forderungen fanden sie in päpstlichen Privilegien des 12. und 13. Jahrhunderts.
Zwar sind die überlieferten Urkundentexte dem Sinne nach vergleichbar mit ähnli-
chen Privilegierungen anderer sächsischer Reichsstifte bzw. -klöster, doch allein in
Herford gelang es den Äbtissinnen durch konsequentes Beharren auf ihren Rechts-
status diese Sonderstellung bis in die Neuzeit zu bewahren. Hinter solchem persis-
tenten politischen Handeln standen adelige Frauen, die um die Fragilität ihrer
Rechte wussten und daher immer wieder danach strebten, ihre Rechtsposition
abzusichern.
Als eine der ersten Herforder Äbtissinnen, die besser in den Quellen greifbar
ist, soll hier Gertrud von der Lippe vorgestellt werden. An ihrem Beispiel lässt sich
aufzeigen, welche Aussagen trotz Quellenarmut über ihren Handlungsspielraum
zum Beginn des 13. Jahrhunderts möglich sind. Vor allem soll der Frage nachgegan-
gen werden, welcher familiäre, politische und geistige Hintergrund Gertrud von
der Lippe ihr Handeln überhaupt ermöglichte. Daher wird versucht, das Bild Ger-
truds klarer zu zeichnen, in dem ihre familiäre Herkunft, ihre Stellung und die sich
für sie daraus ergebenden Bedingungen untersucht werden.
Wenden wir uns zuerst etwas ausführlicher der Familie und Verwandtschaft
Gertruds zu: Gertrud war eines von elf nachweisbaren Kindern einer westfälischen
Adelsfamilie, den Edelherren von der Lippe. Über ihre Mutter Heilwig von Are war
1 Heinrich Rüthing, »Monstrum Westphalie«. Eigenarten und Eigenheiten der Herforder
Geschichte, in: Historisches Jahrbuch für den Kreis Herford 1, 1993, S. 9-23; Michael Freiherr
von Fürstenberg, »Ordinaria loci« oder »Monstrum Westfaliae«? Zur kirchlichen Rechtsstel-
lung der Äbtissin von Herford im europäischen Vergleich (Studien zur westfälischen
Geschichte 29), Paderborn 1995, bes. S. 367 f.; Fromme Frauen und Ordensmänner. Klöster und
Stifte im heiligen Herford, hg. von Olaf Schirmeister (Herforder Forschungen 10; Religion in
der Geschichte 3), Herford 2000. Zu Gertrud zuletzt Martin Kroker, Kaiser, Könige und
fromme Frauen - das Reichsstift Herford in ottonischer, salischer und staufischer Zeit, in:
Schirmeister, Fromme Frauen, S. 77-126, hier S. 115-120.
2 Eine Zusammenstellung, wie die Äbtissinnen ihre potestas iurisdiktionis im einzelnen ausgeübt
haben, bietet Fürstenberg, Ordinaria loci (wie Anm. 1), S. 368.