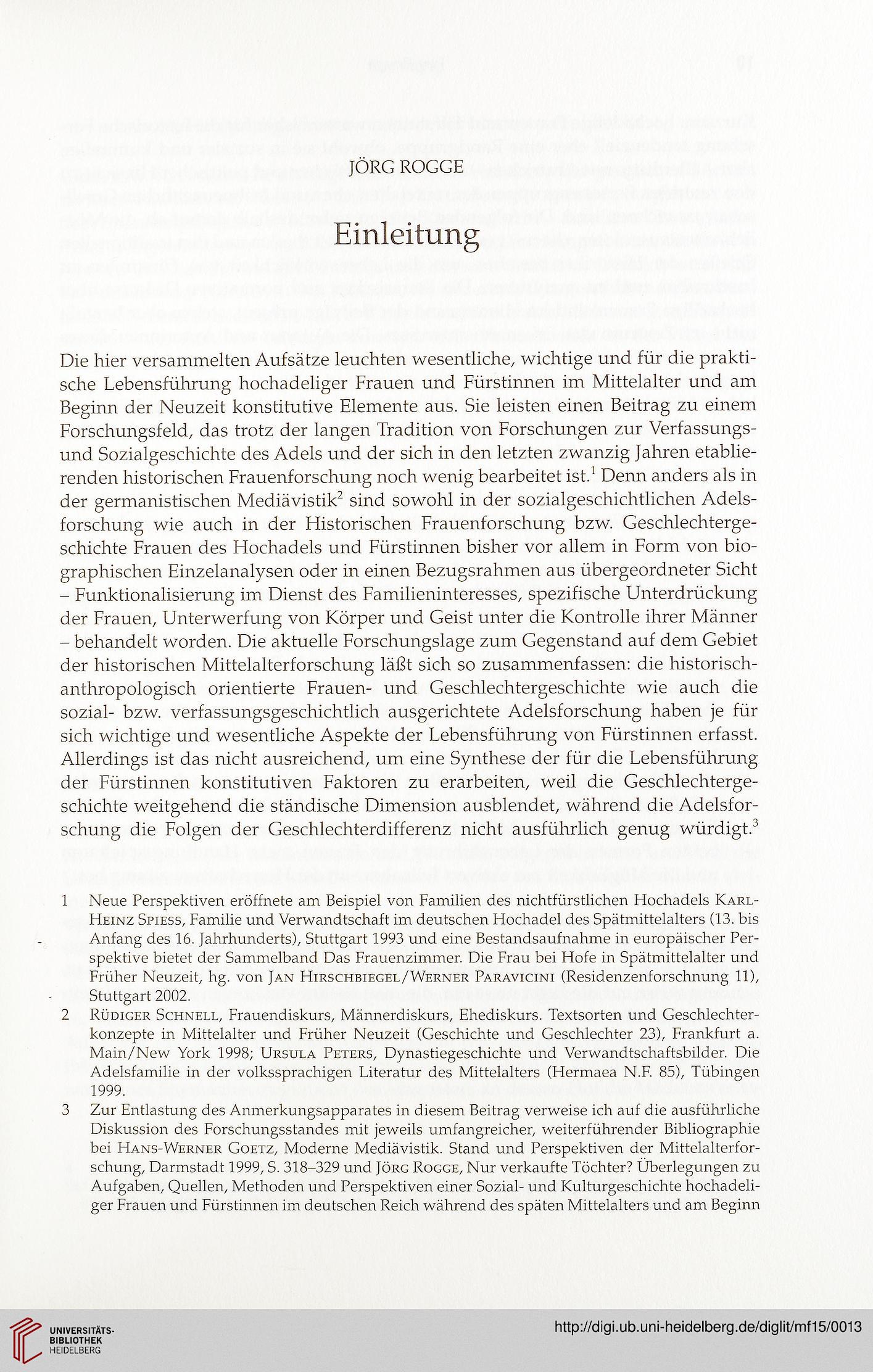JÖRG ROGGE
Einleitung
Die hier versammelten Aufsätze leuchten wesentliche, wichtige und für die prakti-
sche Lebensführung hochadeliger Frauen und Fürstinnen im Mittelalter und am
Beginn der Neuzeit konstitutive Elemente aus. Sie leisten einen Beitrag zu einem
Forschungsfeld, das trotz der langen Tradition von Forschungen zur Verfassungs-
und Sozialgeschichte des Adels und der sich in den letzten zwanzig Jahren etablie-
renden historischen Frauenforschung noch wenig bearbeitet ist.1 Denn anders als in
der germanistischen Mediävistik2 sind sowohl in der sozialgeschichtlichen Adels-
forschung wie auch in der Historischen Frauenforschung bzw. Geschlechterge-
schichte Frauen des Hochadels und Fürstinnen bisher vor allem in Form von bio-
graphischen Einzelanalysen oder in einen Bezugsrahmen aus übergeordneter Sicht
- Funktionalisierung im Dienst des Familieninteresses, spezifische Unterdrückung
der Frauen, Unterwerfung von Körper und Geist unter die Kontrolle ihrer Männer
- behandelt worden. Die aktuelle Forschungslage zum Gegenstand auf dem Gebiet
der historischen Mittelalterforschung läßt sich so zusammenfassen: die historisch-
anthropologisch orientierte Frauen- und Geschlechtergeschichte wie auch die
sozial- bzw. verfassungsgeschichtlich ausgerichtete Adelsforschung haben je für
sich wichtige und wesentliche Aspekte der Lebensführung von Fürstinnen erfasst.
Allerdings ist das nicht ausreichend, um eine Synthese der für die Lebensführung
der Fürstinnen konstitutiven Faktoren zu erarbeiten, weil die Geschlechterge-
schichte weitgehend die ständische Dimension ausblendet, während die Adelsfor-
schung die Folgen der Geschlechterdifferenz nicht ausführlich genug würdigt.3
1 Neue Perspektiven eröffnete am Beispiel von Familien des nichtfürstlichen Hochadels Karl-
Heinz Spiess, Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel des Spätmittelalters (13. bis
Anfang des 16. Jahrhunderts), Stuttgart 1993 und eine Bestandsaufnahme in europäischer Per-
spektive bietet der Sammelband Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und
Früher Neuzeit, hg. von Jan Hirschbiegel/Werner Paravicini (Residenzenforschnung 11),
Stuttgart 2002.
2 Rüdiger Schnell, Frauendiskurs, Männerdiskurs, Ehediskurs. Textsorten und Geschlechter-
konzepte in Mittelalter und Früher Neuzeit (Geschichte und Geschlechter 23), Frankfurt a.
Main/New York 1998; Ursula Peters, Dynastiegeschichte und Verwandtschaftsbilder. Die
Adelsfamilie in der volkssprachigen Literatur des Mittelalters (Hermaea N.F. 85), Tübingen
1999.
3 Zur Entlastung des Anmerkungsapparates in diesem Beitrag verweise ich auf die ausführliche
Diskussion des Forschungsstandes mit jeweils umfangreicher, weiterführender Bibliographie
bei Hans-Werner Goetz, Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterfor-
schung, Darmstadt 1999, S. 318-329 und Jörg Rogge, Nur verkaufte Töchter? Überlegungen zu
Aufgaben, Quellen, Methoden und Perspektiven einer Sozial- und Kulturgeschichte hochadeli-
ger Frauen und Fürstinnen im deutschen Reich während des späten Mittelalters und am Beginn
Einleitung
Die hier versammelten Aufsätze leuchten wesentliche, wichtige und für die prakti-
sche Lebensführung hochadeliger Frauen und Fürstinnen im Mittelalter und am
Beginn der Neuzeit konstitutive Elemente aus. Sie leisten einen Beitrag zu einem
Forschungsfeld, das trotz der langen Tradition von Forschungen zur Verfassungs-
und Sozialgeschichte des Adels und der sich in den letzten zwanzig Jahren etablie-
renden historischen Frauenforschung noch wenig bearbeitet ist.1 Denn anders als in
der germanistischen Mediävistik2 sind sowohl in der sozialgeschichtlichen Adels-
forschung wie auch in der Historischen Frauenforschung bzw. Geschlechterge-
schichte Frauen des Hochadels und Fürstinnen bisher vor allem in Form von bio-
graphischen Einzelanalysen oder in einen Bezugsrahmen aus übergeordneter Sicht
- Funktionalisierung im Dienst des Familieninteresses, spezifische Unterdrückung
der Frauen, Unterwerfung von Körper und Geist unter die Kontrolle ihrer Männer
- behandelt worden. Die aktuelle Forschungslage zum Gegenstand auf dem Gebiet
der historischen Mittelalterforschung läßt sich so zusammenfassen: die historisch-
anthropologisch orientierte Frauen- und Geschlechtergeschichte wie auch die
sozial- bzw. verfassungsgeschichtlich ausgerichtete Adelsforschung haben je für
sich wichtige und wesentliche Aspekte der Lebensführung von Fürstinnen erfasst.
Allerdings ist das nicht ausreichend, um eine Synthese der für die Lebensführung
der Fürstinnen konstitutiven Faktoren zu erarbeiten, weil die Geschlechterge-
schichte weitgehend die ständische Dimension ausblendet, während die Adelsfor-
schung die Folgen der Geschlechterdifferenz nicht ausführlich genug würdigt.3
1 Neue Perspektiven eröffnete am Beispiel von Familien des nichtfürstlichen Hochadels Karl-
Heinz Spiess, Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel des Spätmittelalters (13. bis
Anfang des 16. Jahrhunderts), Stuttgart 1993 und eine Bestandsaufnahme in europäischer Per-
spektive bietet der Sammelband Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und
Früher Neuzeit, hg. von Jan Hirschbiegel/Werner Paravicini (Residenzenforschnung 11),
Stuttgart 2002.
2 Rüdiger Schnell, Frauendiskurs, Männerdiskurs, Ehediskurs. Textsorten und Geschlechter-
konzepte in Mittelalter und Früher Neuzeit (Geschichte und Geschlechter 23), Frankfurt a.
Main/New York 1998; Ursula Peters, Dynastiegeschichte und Verwandtschaftsbilder. Die
Adelsfamilie in der volkssprachigen Literatur des Mittelalters (Hermaea N.F. 85), Tübingen
1999.
3 Zur Entlastung des Anmerkungsapparates in diesem Beitrag verweise ich auf die ausführliche
Diskussion des Forschungsstandes mit jeweils umfangreicher, weiterführender Bibliographie
bei Hans-Werner Goetz, Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterfor-
schung, Darmstadt 1999, S. 318-329 und Jörg Rogge, Nur verkaufte Töchter? Überlegungen zu
Aufgaben, Quellen, Methoden und Perspektiven einer Sozial- und Kulturgeschichte hochadeli-
ger Frauen und Fürstinnen im deutschen Reich während des späten Mittelalters und am Beginn