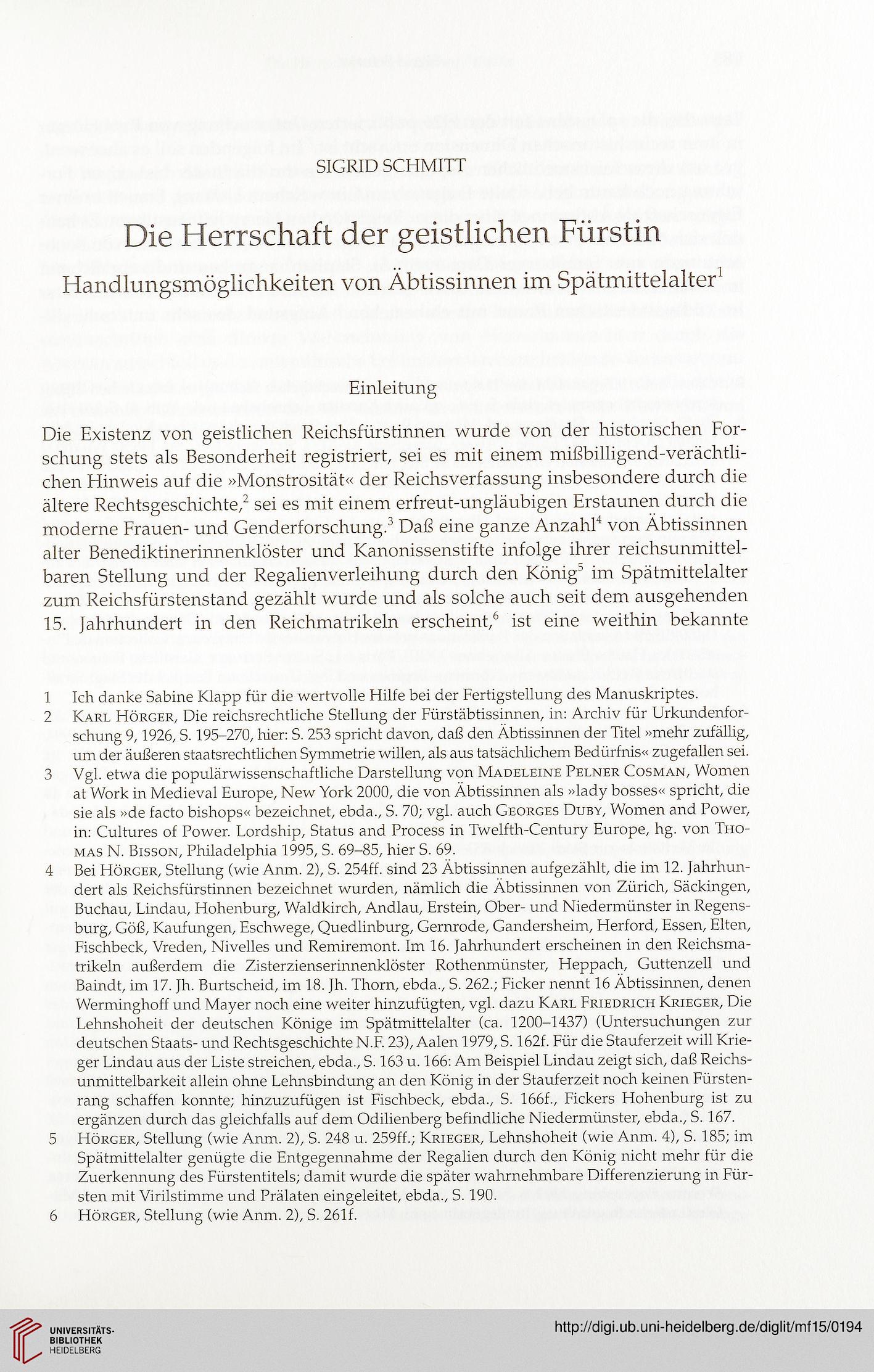SIGRID SCHMITT
Die Herrschaft der geistlichen Fürstin
Handlungsmöglichkeiten von Äbtissinnen im Spätmittelalter1
Einleitung
Die Existenz von geistlichen Reichsfürstinnen wurde von der historischen For-
schung stets als Besonderheit registriert, sei es mit einem mißbilligend-verächtli-
chen Hinweis auf die »Monstrosität« der Reichsverfassung insbesondere durch die
ältere Rechtsgeschichte,2 sei es mit einem erfreut-ungläubigen Erstaunen durch die
moderne Frauen- und Genderforschung.3 Daß eine ganze Anzahl4 von Äbtissinnen
alter Benediktinerinnenklöster und Kanonissenstifte infolge ihrer reichsunmittel-
baren Stellung und der Regalienverleihung durch den König5 im Spätmittelalter
zum Reichsfürstenstand gezählt wurde und als solche auch seit dem ausgehenden
15. Jahrhundert in den Reichmatrikeln erscheint,6 ist eine weithin bekannte
1 Ich danke Sabine Klapp für die wertvolle Hilfe bei der Fertigstellung des Manuskriptes.
2 Karl Hörger, Die reichsrechtliche Stellung der Fürstäbtissinnen, in: Archiv für Urkundenfor-
schung 9,1926, S. 195-270, hier: S. 253 spricht davon, daß den Äbtissinnen der Titel »mehr zufällig,
um der äußeren staatsrechtlichen Symmetrie willen, als aus tatsächlichem Bedürfnis« zugefallen sei.
3 Vgl. etwa die populärwissenschaftliche Darstellung von Madeleine Pelner Cosman, Women
at Work in Medieval Europe, New York 2000, die von Äbtissinnen als »lady bosses« spricht, die
sie als »de facto bishops« bezeichnet, ebda., S. 70; vgl. auch Georges Duby, Women and Power,
in: Cultures of Power. Lordship, Status and Process in Twelfth-Century Europe, hg. von Tho-
mas N. Bisson, Philadelphia 1995, S. 69-85, hier S. 69.
4 Bei Hörger, Stellung (wie Anm. 2), S. 254ff. sind 23 Äbtissinnen aufgezählt, die im 12. Jahrhun-
dert als Reichsfürstinnen bezeichnet wurden, nämlich die Äbtissinnen von Zürich, Säckingen,
Buchau, Lindau, Hohenburg, Waldkirch, Andlau, Erstem, Ober- und Niedermünster in Regens-
burg, Göß, Kaufungen, Eschwege, Quedlinburg, Gernrode, Gandersheim, Herford, Essen, Elten,
Fischbeck, Vreden, Nivelles und Remiremont. Im 16. Jahrhundert erscheinen in den Reichsma-
trikeln außerdem die Zisterzienserinnenklöster Rothenmünster, Heppach, Guttenzell und
Baindt, im 17. Jh. Burtscheid, im 18. Jh. Thorn, ebda., S. 262.; Ficker nennt 16 Äbtissinnen, denen
Werminghoff und Mayer noch eine weiter hinzufügten, vgl. dazu Karl Friedrich Krieger, Die
Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter (ca. 1200-1437) (Untersuchungen zur
deutschen Staats- und Rechtsgeschichte N.F. 23), Aalen 1979, S. 162f. Für die Stauferzeit will Krie-
ger Lindau aus der Liste streichen, ebda., S. 163 u. 166: Am Beispiel Lindau zeigt sich, daß Reichs-
unmittelbarkeit allein ohne Lehnsbindung an den König in der Stauferzeit noch keinen Fürsten-
rang schaffen konnte; hinzuzufügen ist Fischbeck, ebda., S. 166f., Fickers Hohenburg ist zu
ergänzen durch das gleichfalls auf dem Odilienberg befindliche Niedermünster, ebda., S. 167.
5 Hörger, Stellung (wie Anm. 2), S. 248 u. 259ff.; Krieger, Lehnshoheit (wie Anm. 4), S. 185; im
Spätmittelalter genügte die Entgegennahme der Regalien durch den König nicht mehr für die
Zuerkennung des Fürstentitels; damit wurde die später wahrnehmbare Differenzierung in Für-
sten mit Virilstimme und Prälaten eingeleitet, ebda., S. 190.
6 Hörger, Stellung (wie Anm. 2), S. 261 f.
Die Herrschaft der geistlichen Fürstin
Handlungsmöglichkeiten von Äbtissinnen im Spätmittelalter1
Einleitung
Die Existenz von geistlichen Reichsfürstinnen wurde von der historischen For-
schung stets als Besonderheit registriert, sei es mit einem mißbilligend-verächtli-
chen Hinweis auf die »Monstrosität« der Reichsverfassung insbesondere durch die
ältere Rechtsgeschichte,2 sei es mit einem erfreut-ungläubigen Erstaunen durch die
moderne Frauen- und Genderforschung.3 Daß eine ganze Anzahl4 von Äbtissinnen
alter Benediktinerinnenklöster und Kanonissenstifte infolge ihrer reichsunmittel-
baren Stellung und der Regalienverleihung durch den König5 im Spätmittelalter
zum Reichsfürstenstand gezählt wurde und als solche auch seit dem ausgehenden
15. Jahrhundert in den Reichmatrikeln erscheint,6 ist eine weithin bekannte
1 Ich danke Sabine Klapp für die wertvolle Hilfe bei der Fertigstellung des Manuskriptes.
2 Karl Hörger, Die reichsrechtliche Stellung der Fürstäbtissinnen, in: Archiv für Urkundenfor-
schung 9,1926, S. 195-270, hier: S. 253 spricht davon, daß den Äbtissinnen der Titel »mehr zufällig,
um der äußeren staatsrechtlichen Symmetrie willen, als aus tatsächlichem Bedürfnis« zugefallen sei.
3 Vgl. etwa die populärwissenschaftliche Darstellung von Madeleine Pelner Cosman, Women
at Work in Medieval Europe, New York 2000, die von Äbtissinnen als »lady bosses« spricht, die
sie als »de facto bishops« bezeichnet, ebda., S. 70; vgl. auch Georges Duby, Women and Power,
in: Cultures of Power. Lordship, Status and Process in Twelfth-Century Europe, hg. von Tho-
mas N. Bisson, Philadelphia 1995, S. 69-85, hier S. 69.
4 Bei Hörger, Stellung (wie Anm. 2), S. 254ff. sind 23 Äbtissinnen aufgezählt, die im 12. Jahrhun-
dert als Reichsfürstinnen bezeichnet wurden, nämlich die Äbtissinnen von Zürich, Säckingen,
Buchau, Lindau, Hohenburg, Waldkirch, Andlau, Erstem, Ober- und Niedermünster in Regens-
burg, Göß, Kaufungen, Eschwege, Quedlinburg, Gernrode, Gandersheim, Herford, Essen, Elten,
Fischbeck, Vreden, Nivelles und Remiremont. Im 16. Jahrhundert erscheinen in den Reichsma-
trikeln außerdem die Zisterzienserinnenklöster Rothenmünster, Heppach, Guttenzell und
Baindt, im 17. Jh. Burtscheid, im 18. Jh. Thorn, ebda., S. 262.; Ficker nennt 16 Äbtissinnen, denen
Werminghoff und Mayer noch eine weiter hinzufügten, vgl. dazu Karl Friedrich Krieger, Die
Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter (ca. 1200-1437) (Untersuchungen zur
deutschen Staats- und Rechtsgeschichte N.F. 23), Aalen 1979, S. 162f. Für die Stauferzeit will Krie-
ger Lindau aus der Liste streichen, ebda., S. 163 u. 166: Am Beispiel Lindau zeigt sich, daß Reichs-
unmittelbarkeit allein ohne Lehnsbindung an den König in der Stauferzeit noch keinen Fürsten-
rang schaffen konnte; hinzuzufügen ist Fischbeck, ebda., S. 166f., Fickers Hohenburg ist zu
ergänzen durch das gleichfalls auf dem Odilienberg befindliche Niedermünster, ebda., S. 167.
5 Hörger, Stellung (wie Anm. 2), S. 248 u. 259ff.; Krieger, Lehnshoheit (wie Anm. 4), S. 185; im
Spätmittelalter genügte die Entgegennahme der Regalien durch den König nicht mehr für die
Zuerkennung des Fürstentitels; damit wurde die später wahrnehmbare Differenzierung in Für-
sten mit Virilstimme und Prälaten eingeleitet, ebda., S. 190.
6 Hörger, Stellung (wie Anm. 2), S. 261 f.