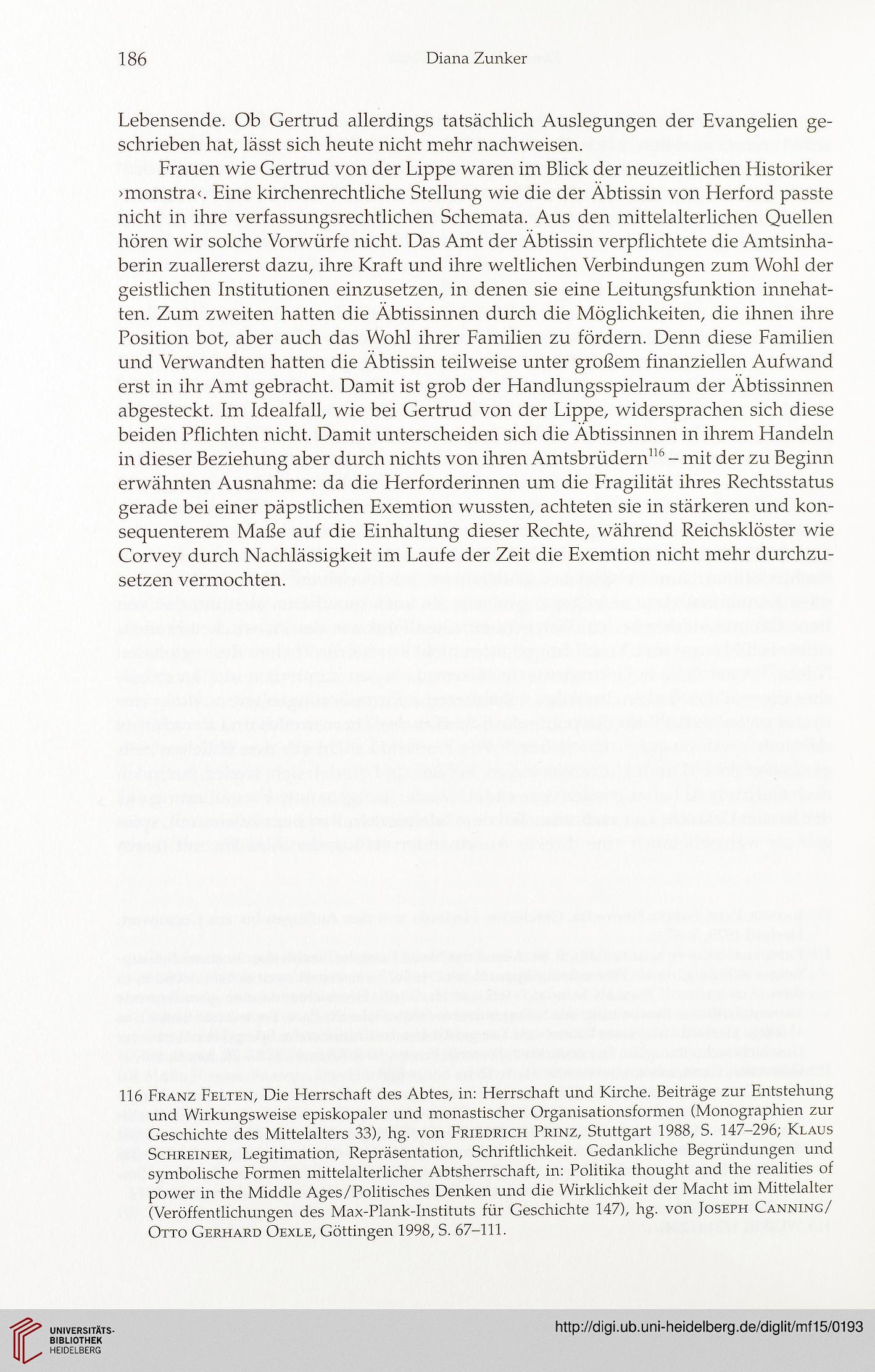186
Diana Zunker
Lebensende. Ob Gertrud allerdings tatsächlich Auslegungen der Evangelien ge-
schrieben hat, lässt sich heute nicht mehr nachweisen.
Frauen wie Gertrud von der Lippe waren im Blick der neuzeitlichen Historiker
>monstra<. Eine kirchenrechtliche Stellung wie die der Äbtissin von Herford passte
nicht in ihre verfassungsrechtlichen Schemata. Aus den mittelalterlichen Quellen
hören wir solche Vorwürfe nicht. Das Amt der Äbtissin verpflichtete die Amtsinha-
berin zuallererst dazu, ihre Kraft und ihre weltlichen Verbindungen zum Wohl der
geistlichen Institutionen einzusetzen, in denen sie eine Leitungsfunktion innehat-
ten. Zum zweiten hatten die Äbtissinnen durch die Möglichkeiten, die ihnen ihre
Position bot, aber auch das Wohl ihrer Familien zu fördern. Denn diese Familien
und Verwandten hatten die Äbtissin teilweise unter großem finanziellen Aufwand
erst in ihr Amt gebracht. Damit ist grob der Handlungsspielraum der Äbtissinnen
abgesteckt. Im Idealfall, wie bei Gertrud von der Lippe, widersprachen sich diese
beiden Pflichten nicht. Damit unterscheiden sich die Äbtissinnen in ihrem Handeln
in dieser Beziehung aber durch nichts von ihren Amtsbrüdern116 - mit der zu Beginn
erwähnten Ausnahme: da die Herforderinnen um die Fragilität ihres Rechtsstatus
gerade bei einer päpstlichen Exemtion wussten, achteten sie in stärkeren und kon-
sequenterem Maße auf die Einhaltung dieser Rechte, während Reichsklöster wie
Corvey durch Nachlässigkeit im Laufe der Zeit die Exemtion nicht mehr durchzu-
setzen vermochten.
116 Franz Felten, Die Herrschaft des Abtes, in: Herrschaft und Kirche. Beiträge zur Entstehung
und Wirkungsweise episkopaler und monastischer Organisationsformen (Monographien zur
Geschichte des Mittelalters 33), hg. von Friedrich Prinz, Stuttgart 1988, S. 147-296; Klaus
Schreiner, Legitimation, Repräsentation, Schriftlichkeit. Gedankliche Begründungen und
symbolische Formen mittelalterlicher Abtsherrschaft, in: Politika thought and the realities of
power in the Middle Ages/Politisches Denken und die Wirklichkeit der Macht im Mittelalter
(Veröffentlichungen des Max-Plank-Instituts für Geschichte 147), hg. von Joseph Canning/
Otto Gerhard Oexle, Göttingen 1998, S. 67-111.
Diana Zunker
Lebensende. Ob Gertrud allerdings tatsächlich Auslegungen der Evangelien ge-
schrieben hat, lässt sich heute nicht mehr nachweisen.
Frauen wie Gertrud von der Lippe waren im Blick der neuzeitlichen Historiker
>monstra<. Eine kirchenrechtliche Stellung wie die der Äbtissin von Herford passte
nicht in ihre verfassungsrechtlichen Schemata. Aus den mittelalterlichen Quellen
hören wir solche Vorwürfe nicht. Das Amt der Äbtissin verpflichtete die Amtsinha-
berin zuallererst dazu, ihre Kraft und ihre weltlichen Verbindungen zum Wohl der
geistlichen Institutionen einzusetzen, in denen sie eine Leitungsfunktion innehat-
ten. Zum zweiten hatten die Äbtissinnen durch die Möglichkeiten, die ihnen ihre
Position bot, aber auch das Wohl ihrer Familien zu fördern. Denn diese Familien
und Verwandten hatten die Äbtissin teilweise unter großem finanziellen Aufwand
erst in ihr Amt gebracht. Damit ist grob der Handlungsspielraum der Äbtissinnen
abgesteckt. Im Idealfall, wie bei Gertrud von der Lippe, widersprachen sich diese
beiden Pflichten nicht. Damit unterscheiden sich die Äbtissinnen in ihrem Handeln
in dieser Beziehung aber durch nichts von ihren Amtsbrüdern116 - mit der zu Beginn
erwähnten Ausnahme: da die Herforderinnen um die Fragilität ihres Rechtsstatus
gerade bei einer päpstlichen Exemtion wussten, achteten sie in stärkeren und kon-
sequenterem Maße auf die Einhaltung dieser Rechte, während Reichsklöster wie
Corvey durch Nachlässigkeit im Laufe der Zeit die Exemtion nicht mehr durchzu-
setzen vermochten.
116 Franz Felten, Die Herrschaft des Abtes, in: Herrschaft und Kirche. Beiträge zur Entstehung
und Wirkungsweise episkopaler und monastischer Organisationsformen (Monographien zur
Geschichte des Mittelalters 33), hg. von Friedrich Prinz, Stuttgart 1988, S. 147-296; Klaus
Schreiner, Legitimation, Repräsentation, Schriftlichkeit. Gedankliche Begründungen und
symbolische Formen mittelalterlicher Abtsherrschaft, in: Politika thought and the realities of
power in the Middle Ages/Politisches Denken und die Wirklichkeit der Macht im Mittelalter
(Veröffentlichungen des Max-Plank-Instituts für Geschichte 147), hg. von Joseph Canning/
Otto Gerhard Oexle, Göttingen 1998, S. 67-111.