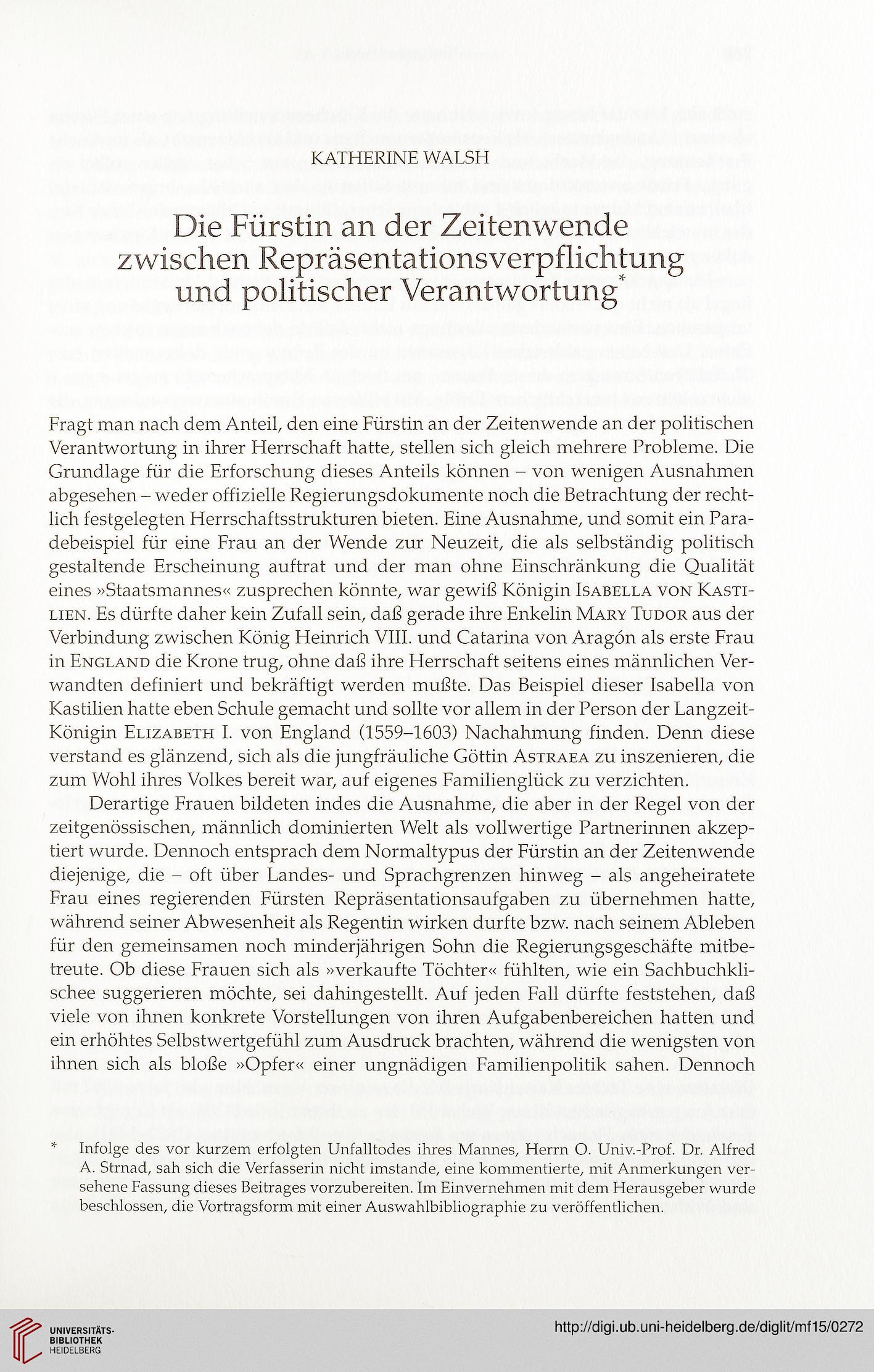KATHERINE WALSH
Die Fürstin an der Zeitenwende
zwischen Repräsentationsverpflichtung
und politischer Verantwortung"
Fragt man nach dem Anteil, den eine Fürstin an der Zeitenwende an der politischen
Verantwortung in ihrer Herrschaft hatte, stellen sich gleich mehrere Probleme. Die
Grundlage für die Erforschung dieses Anteils können - von wenigen Ausnahmen
abgesehen - weder offizielle Regierungsdokumente noch die Betrachtung der recht-
lich festgelegten Herrschaftsstrukturen bieten. Eine Ausnahme, und somit ein Para-
debeispiel für eine Frau an der Wende zur Neuzeit, die als selbständig politisch
gestaltende Erscheinung auftrat und der man ohne Einschränkung die Qualität
eines »Staatsmannes« zusprechen könnte, war gewiß Königin Isabella von Kasti-
lien. Es dürfte daher kein Zufall sein, daß gerade ihre Enkelin Mary Tudor aus der
Verbindung zwischen König Heinrich VIII. und Catarina von Aragon als erste Frau
in England die Krone trug, ohne daß ihre Herrschaft seitens eines männlichen Ver-
wandten definiert und bekräftigt werden mußte. Das Beispiel dieser Isabella von
Kastilien hatte eben Schule gemacht und sollte vor allem in der Person der Langzeit-
Königin Elizabeth I. von England (1559-1603) Nachahmung finden. Denn diese
verstand es glänzend, sich als die jungfräuliche Göttin Astraea zu inszenieren, die
zum Wohl ihres Volkes bereit war, auf eigenes Familienglück zu verzichten.
Derartige Frauen bildeten indes die Ausnahme, die aber in der Regel von der
zeitgenössischen, männlich dominierten Welt als vollwertige Partnerinnen akzep-
tiert wurde. Dennoch entsprach dem Normaltypus der Fürstin an der Zeitenwende
diejenige, die - oft über Landes- und Sprachgrenzen hinweg - als angeheiratete
Frau eines regierenden Fürsten Repräsentationsaufgaben zu übernehmen hatte,
während seiner Abwesenheit als Regentin wirken durfte bzw. nach seinem Ableben
für den gemeinsamen noch minderjährigen Sohn die Regierungsgeschäfte mitbe-
treute. Ob diese Frauen sich als »verkaufte Töchter« fühlten, wie ein Sachbuchkli-
schee suggerieren möchte, sei dahingestellt. Auf jeden Fall dürfte feststehen, daß
viele von ihnen konkrete Vorstellungen von ihren Aufgabenbereichen hatten und
ein erhöhtes Selbstwertgefühl zum Ausdruck brachten, während die wenigsten von
ihnen sich als bloße »Opfer« einer ungnädigen Familienpolitik sahen. Dennoch
* Infolge des vor kurzem erfolgten Unfalltodes ihres Mannes, Herrn O. Univ.-Prof. Dr. Alfred
A. Strnad, sah sich die Verfasserin nicht imstande, eine kommentierte, mit Anmerkungen ver-
sehene Fassung dieses Beitrages vorzubereiten. Im Einvernehmen mit dem Herausgeber wurde
beschlossen, die Vortragsform mit einer Auswahlbibliographie zu veröffentlichen.
Die Fürstin an der Zeitenwende
zwischen Repräsentationsverpflichtung
und politischer Verantwortung"
Fragt man nach dem Anteil, den eine Fürstin an der Zeitenwende an der politischen
Verantwortung in ihrer Herrschaft hatte, stellen sich gleich mehrere Probleme. Die
Grundlage für die Erforschung dieses Anteils können - von wenigen Ausnahmen
abgesehen - weder offizielle Regierungsdokumente noch die Betrachtung der recht-
lich festgelegten Herrschaftsstrukturen bieten. Eine Ausnahme, und somit ein Para-
debeispiel für eine Frau an der Wende zur Neuzeit, die als selbständig politisch
gestaltende Erscheinung auftrat und der man ohne Einschränkung die Qualität
eines »Staatsmannes« zusprechen könnte, war gewiß Königin Isabella von Kasti-
lien. Es dürfte daher kein Zufall sein, daß gerade ihre Enkelin Mary Tudor aus der
Verbindung zwischen König Heinrich VIII. und Catarina von Aragon als erste Frau
in England die Krone trug, ohne daß ihre Herrschaft seitens eines männlichen Ver-
wandten definiert und bekräftigt werden mußte. Das Beispiel dieser Isabella von
Kastilien hatte eben Schule gemacht und sollte vor allem in der Person der Langzeit-
Königin Elizabeth I. von England (1559-1603) Nachahmung finden. Denn diese
verstand es glänzend, sich als die jungfräuliche Göttin Astraea zu inszenieren, die
zum Wohl ihres Volkes bereit war, auf eigenes Familienglück zu verzichten.
Derartige Frauen bildeten indes die Ausnahme, die aber in der Regel von der
zeitgenössischen, männlich dominierten Welt als vollwertige Partnerinnen akzep-
tiert wurde. Dennoch entsprach dem Normaltypus der Fürstin an der Zeitenwende
diejenige, die - oft über Landes- und Sprachgrenzen hinweg - als angeheiratete
Frau eines regierenden Fürsten Repräsentationsaufgaben zu übernehmen hatte,
während seiner Abwesenheit als Regentin wirken durfte bzw. nach seinem Ableben
für den gemeinsamen noch minderjährigen Sohn die Regierungsgeschäfte mitbe-
treute. Ob diese Frauen sich als »verkaufte Töchter« fühlten, wie ein Sachbuchkli-
schee suggerieren möchte, sei dahingestellt. Auf jeden Fall dürfte feststehen, daß
viele von ihnen konkrete Vorstellungen von ihren Aufgabenbereichen hatten und
ein erhöhtes Selbstwertgefühl zum Ausdruck brachten, während die wenigsten von
ihnen sich als bloße »Opfer« einer ungnädigen Familienpolitik sahen. Dennoch
* Infolge des vor kurzem erfolgten Unfalltodes ihres Mannes, Herrn O. Univ.-Prof. Dr. Alfred
A. Strnad, sah sich die Verfasserin nicht imstande, eine kommentierte, mit Anmerkungen ver-
sehene Fassung dieses Beitrages vorzubereiten. Im Einvernehmen mit dem Herausgeber wurde
beschlossen, die Vortragsform mit einer Auswahlbibliographie zu veröffentlichen.