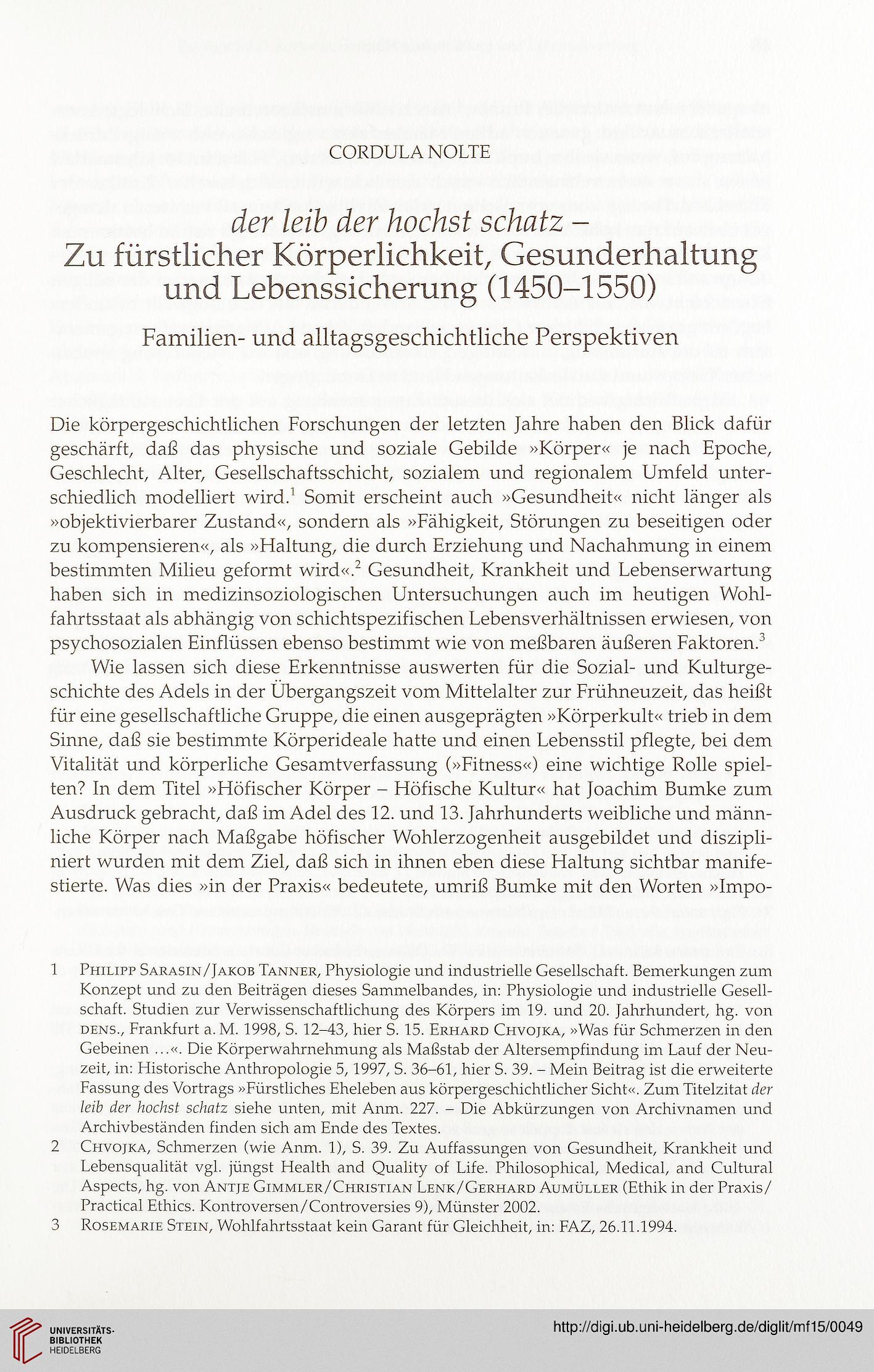CORDULA NOLTE
der leib der höchst schätz -
Zu fürstlicher Körperlichkeit, Gesunderhaltung
und Lebenssicherung (1450-1550)
Familien- und alltagsgeschichtliche Perspektiven
Die körpergeschichtlichen Forschungen der letzten Jahre haben den Blick dafür
geschärft, daß das physische und soziale Gebilde »Körper« je nach Epoche,
Geschlecht, Alter, Gesellschaftsschicht, sozialem und regionalem Umfeld unter-
schiedlich modelliert wird.1 Somit erscheint auch »Gesundheit« nicht länger als
»objektivierbarer Zustand«, sondern als »Fähigkeit, Störungen zu beseitigen oder
zu kompensieren«, als »Flaltung, die durch Erziehung und Nachahmung in einem
bestimmten Milieu geformt wird«.2 Gesundheit, Krankheit und Lebenserwartung
haben sich in medizinsoziologischen Untersuchungen auch im heutigen Wohl-
fahrtsstaat als abhängig von schichtspezifischen Lebensverhältnissen erwiesen, von
psychosozialen Einflüssen ebenso bestimmt wie von meßbaren äußeren Faktoren.3
Wie lassen sich diese Erkenntnisse auswerten für die Sozial- und Kulturge-
schichte des Adels in der Übergangszeit vom Mittelalter zur Frühneuzeit, das heißt
für eine gesellschaftliche Gruppe, die einen ausgeprägten »Körperkult« trieb in dem
Sinne, daß sie bestimmte Körperideale hatte und einen Lebensstil pflegte, bei dem
Vitalität und körperliche Gesamtverfassung (»Fitness«) eine wichtige Rolle spiel-
ten? In dem Titel »Höfischer Körper - Höfische Kultur« hat Joachim Bumke zum
Ausdruck gebracht, daß im Adel des 12. und 13. Jahrhunderts weibliche und männ-
liche Körper nach Maßgabe höfischer Wohlerzogenheit ausgebildet und diszipli-
niert wurden mit dem Ziel, daß sich in ihnen eben diese Haltung sichtbar manife-
stierte. Was dies »in der Praxis« bedeutete, umriß Bumke mit den Worten »Impo-
1 Philipp Sarasin/Jakob Tanner, Physiologie und industrielle Gesellschaft. Bemerkungen zum
Konzept und zu den Beiträgen dieses Sammelbandes, in: Physiologie und industrielle Gesell-
schaft. Studien zur Verwissenschaftlichung des Körpers im 19. und 20. Jahrhundert, hg. von
dens., Frankfurt a. M. 1998, S. 12-43, hier S. 15. Erhard Chvojka, »Was für Schmerzen in den
Gebeinen ...«. Die Körperwahrnehmung als Maßstab der Altersempfindung im Lauf der Neu-
zeit, in: Historische Anthropologie 5,1997, S. 36-61, hier S. 39. - Mein Beitrag ist die erweiterte
Fassung des Vortrags »Fürstliches Eheleben aus körpergeschichtlicher Sicht«. Zum Titelzitat der
leib der höchst schätz siehe unten, mit Anm. 227. - Die Abkürzungen von Archivnamen und
Archivbeständen finden sich am Ende des Textes.
2 Chvojka, Schmerzen (wie Anm. 1), S. 39. Zu Auffassungen von Gesundheit, Krankheit und
Lebensqualität vgl. jüngst Health and Quality of Life. Philosophical, Medical, and Cultural
Aspects, hg. von Antje Gimmler/Christian Lenk/Gerhard Aumüller (Ethik in der Praxis/
Practical Ethics. Kontroversen/Controversies 9), Münster 2002.
3 Rosemarie Stein, Wohlfahrtsstaat kein Garant für Gleichheit, in: FAZ, 26.11.1994.
der leib der höchst schätz -
Zu fürstlicher Körperlichkeit, Gesunderhaltung
und Lebenssicherung (1450-1550)
Familien- und alltagsgeschichtliche Perspektiven
Die körpergeschichtlichen Forschungen der letzten Jahre haben den Blick dafür
geschärft, daß das physische und soziale Gebilde »Körper« je nach Epoche,
Geschlecht, Alter, Gesellschaftsschicht, sozialem und regionalem Umfeld unter-
schiedlich modelliert wird.1 Somit erscheint auch »Gesundheit« nicht länger als
»objektivierbarer Zustand«, sondern als »Fähigkeit, Störungen zu beseitigen oder
zu kompensieren«, als »Flaltung, die durch Erziehung und Nachahmung in einem
bestimmten Milieu geformt wird«.2 Gesundheit, Krankheit und Lebenserwartung
haben sich in medizinsoziologischen Untersuchungen auch im heutigen Wohl-
fahrtsstaat als abhängig von schichtspezifischen Lebensverhältnissen erwiesen, von
psychosozialen Einflüssen ebenso bestimmt wie von meßbaren äußeren Faktoren.3
Wie lassen sich diese Erkenntnisse auswerten für die Sozial- und Kulturge-
schichte des Adels in der Übergangszeit vom Mittelalter zur Frühneuzeit, das heißt
für eine gesellschaftliche Gruppe, die einen ausgeprägten »Körperkult« trieb in dem
Sinne, daß sie bestimmte Körperideale hatte und einen Lebensstil pflegte, bei dem
Vitalität und körperliche Gesamtverfassung (»Fitness«) eine wichtige Rolle spiel-
ten? In dem Titel »Höfischer Körper - Höfische Kultur« hat Joachim Bumke zum
Ausdruck gebracht, daß im Adel des 12. und 13. Jahrhunderts weibliche und männ-
liche Körper nach Maßgabe höfischer Wohlerzogenheit ausgebildet und diszipli-
niert wurden mit dem Ziel, daß sich in ihnen eben diese Haltung sichtbar manife-
stierte. Was dies »in der Praxis« bedeutete, umriß Bumke mit den Worten »Impo-
1 Philipp Sarasin/Jakob Tanner, Physiologie und industrielle Gesellschaft. Bemerkungen zum
Konzept und zu den Beiträgen dieses Sammelbandes, in: Physiologie und industrielle Gesell-
schaft. Studien zur Verwissenschaftlichung des Körpers im 19. und 20. Jahrhundert, hg. von
dens., Frankfurt a. M. 1998, S. 12-43, hier S. 15. Erhard Chvojka, »Was für Schmerzen in den
Gebeinen ...«. Die Körperwahrnehmung als Maßstab der Altersempfindung im Lauf der Neu-
zeit, in: Historische Anthropologie 5,1997, S. 36-61, hier S. 39. - Mein Beitrag ist die erweiterte
Fassung des Vortrags »Fürstliches Eheleben aus körpergeschichtlicher Sicht«. Zum Titelzitat der
leib der höchst schätz siehe unten, mit Anm. 227. - Die Abkürzungen von Archivnamen und
Archivbeständen finden sich am Ende des Textes.
2 Chvojka, Schmerzen (wie Anm. 1), S. 39. Zu Auffassungen von Gesundheit, Krankheit und
Lebensqualität vgl. jüngst Health and Quality of Life. Philosophical, Medical, and Cultural
Aspects, hg. von Antje Gimmler/Christian Lenk/Gerhard Aumüller (Ethik in der Praxis/
Practical Ethics. Kontroversen/Controversies 9), Münster 2002.
3 Rosemarie Stein, Wohlfahrtsstaat kein Garant für Gleichheit, in: FAZ, 26.11.1994.