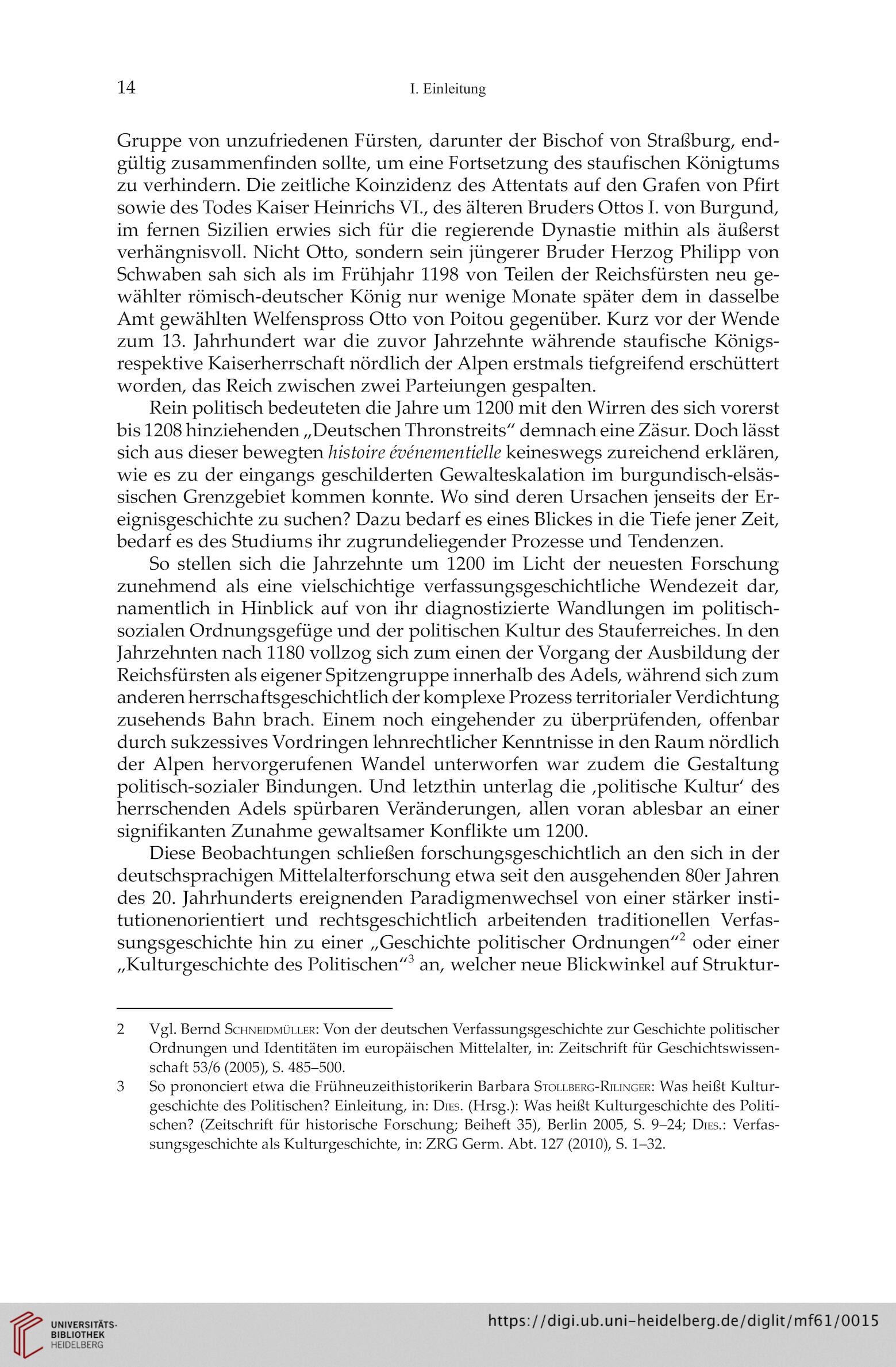14
I. Einleitung
Gruppe von unzufriedenen Fürsten, darunter der Bischof von Straßburg, end-
gültig zusammenfinden sollte, um eine Fortsetzung des staufischen Königtums
zu verhindern. Die zeitliche Koinzidenz des Attentats auf den Grafen von Pfirt
sowie des Todes Kaiser Heinrichs VI., des älteren Bruders Ottos I. von Burgund,
im fernen Sizilien erwies sich für die regierende Dynastie mithin als äußerst
verhängnisvoll. Nicht Otto, sondern sein jüngerer Bruder Herzog Philipp von
Schwaben sah sich als im Frühjahr 1198 von Teilen der Reichsfürsten neu ge-
wählter römisch-deutscher König nur wenige Monate später dem in dasselbe
Amt gewählten Weifenspross Otto von Poitou gegenüber. Kurz vor der Wende
zum 13. Jahrhundert war die zuvor Jahrzehnte währende staufische Königs-
respektive Kaiserherrschaft nördlich der Alpen erstmals tiefgreifend erschüttert
worden, das Reich zwischen zwei Parteiungen gespalten.
Rein politisch bedeuteten die Jahre um 1200 mit den Wirren des sich vorerst
bis 1208 hinziehenden „Deutschen Thronstreits" demnach eine Zäsur. Doch lässt
sich aus dieser bewegten histoire evenementielle keineswegs zureichend erklären,
wie es zu der eingangs geschilderten Gewalteskalation im burgundisch-elsäs-
sischen Grenzgebiet kommen konnte. Wo sind deren Ursachen jenseits der Er-
eignisgeschichte zu suchen? Dazu bedarf es eines Blickes in die Tiefe jener Zeit,
bedarf es des Studiums ihr zugrundeliegender Prozesse und Tendenzen.
So stellen sich die Jahrzehnte um 1200 im Licht der neuesten Forschung
zunehmend als eine vielschichtige verfassungsgeschichtliche Wendezeit dar,
namentlich in Hinblick auf von ihr diagnostizierte Wandlungen im politisch-
sozialen Ordnungsgefüge und der politischen Kultur des Stauferreiches. In den
Jahrzehnten nach 1180 vollzog sich zum einen der Vorgang der Ausbildung der
Reichsfürsten als eigener Spitzengruppe innerhalb des Adels, während sich zum
anderen herrschaftsgeschichtlich der komplexe Prozess territorialer Verdichtung
zusehends Bahn brach. Einem noch eingehender zu überprüfenden, offenbar
durch sukzessives Vordringen lehnrechtlicher Kenntnisse in den Raum nördlich
der Alpen hervorgerufenen Wandel unterworfen war zudem die Gestaltung
politisch-sozialer Bindungen. Und letzthin unterlag die politische Kultur' des
herrschenden Adels spürbaren Veränderungen, allen voran ablesbar an einer
signifikanten Zunahme gewaltsamer Konflikte um 1200.
Diese Beobachtungen schließen forschungsgeschichtlich an den sich in der
deutschsprachigen Mittelalterforschung etwa seit den ausgehenden 80er Jahren
des 20. Jahrhunderts ereignenden Paradigmen wechsel von einer stärker insti-
tutionenorientiert und rechtsgeschichtlich arbeitenden traditionellen Verfas-
sungsgeschichte hin zu einer „Geschichte politischer Ordnungen"2 oder einer
„Kulturgeschichte des Politischen"3 an, welcher neue Blickwinkel auf Struktur-
2 VgL Bernd Schneidmüller: Von der deutschen Verfassungsgeschichte zur Geschichte politischer
Ordnungen und Identitäten im europäischen Mittelalter, in: Zeitschrift für Geschichtswissen-
schaft 53/6 (2005), S. 485-500.
3 So prononciert etwa die Frühneuzeithistorikerin Barbara Stollberg-Rilinger: Was heißt Kultur-
geschichte des Politischen? Einleitung, in: Dies. (Hrsg.): Was heißt Kulturgeschichte des Politi-
schen? (Zeitschrift für historische Forschung; Beiheft 35), Berlin 2005, S. 9-24; Dies.: Verfas-
sungsgeschichte als Kulturgeschichte, in: ZRG Germ. Abt. 127 (2010), S. 1-32.
I. Einleitung
Gruppe von unzufriedenen Fürsten, darunter der Bischof von Straßburg, end-
gültig zusammenfinden sollte, um eine Fortsetzung des staufischen Königtums
zu verhindern. Die zeitliche Koinzidenz des Attentats auf den Grafen von Pfirt
sowie des Todes Kaiser Heinrichs VI., des älteren Bruders Ottos I. von Burgund,
im fernen Sizilien erwies sich für die regierende Dynastie mithin als äußerst
verhängnisvoll. Nicht Otto, sondern sein jüngerer Bruder Herzog Philipp von
Schwaben sah sich als im Frühjahr 1198 von Teilen der Reichsfürsten neu ge-
wählter römisch-deutscher König nur wenige Monate später dem in dasselbe
Amt gewählten Weifenspross Otto von Poitou gegenüber. Kurz vor der Wende
zum 13. Jahrhundert war die zuvor Jahrzehnte währende staufische Königs-
respektive Kaiserherrschaft nördlich der Alpen erstmals tiefgreifend erschüttert
worden, das Reich zwischen zwei Parteiungen gespalten.
Rein politisch bedeuteten die Jahre um 1200 mit den Wirren des sich vorerst
bis 1208 hinziehenden „Deutschen Thronstreits" demnach eine Zäsur. Doch lässt
sich aus dieser bewegten histoire evenementielle keineswegs zureichend erklären,
wie es zu der eingangs geschilderten Gewalteskalation im burgundisch-elsäs-
sischen Grenzgebiet kommen konnte. Wo sind deren Ursachen jenseits der Er-
eignisgeschichte zu suchen? Dazu bedarf es eines Blickes in die Tiefe jener Zeit,
bedarf es des Studiums ihr zugrundeliegender Prozesse und Tendenzen.
So stellen sich die Jahrzehnte um 1200 im Licht der neuesten Forschung
zunehmend als eine vielschichtige verfassungsgeschichtliche Wendezeit dar,
namentlich in Hinblick auf von ihr diagnostizierte Wandlungen im politisch-
sozialen Ordnungsgefüge und der politischen Kultur des Stauferreiches. In den
Jahrzehnten nach 1180 vollzog sich zum einen der Vorgang der Ausbildung der
Reichsfürsten als eigener Spitzengruppe innerhalb des Adels, während sich zum
anderen herrschaftsgeschichtlich der komplexe Prozess territorialer Verdichtung
zusehends Bahn brach. Einem noch eingehender zu überprüfenden, offenbar
durch sukzessives Vordringen lehnrechtlicher Kenntnisse in den Raum nördlich
der Alpen hervorgerufenen Wandel unterworfen war zudem die Gestaltung
politisch-sozialer Bindungen. Und letzthin unterlag die politische Kultur' des
herrschenden Adels spürbaren Veränderungen, allen voran ablesbar an einer
signifikanten Zunahme gewaltsamer Konflikte um 1200.
Diese Beobachtungen schließen forschungsgeschichtlich an den sich in der
deutschsprachigen Mittelalterforschung etwa seit den ausgehenden 80er Jahren
des 20. Jahrhunderts ereignenden Paradigmen wechsel von einer stärker insti-
tutionenorientiert und rechtsgeschichtlich arbeitenden traditionellen Verfas-
sungsgeschichte hin zu einer „Geschichte politischer Ordnungen"2 oder einer
„Kulturgeschichte des Politischen"3 an, welcher neue Blickwinkel auf Struktur-
2 VgL Bernd Schneidmüller: Von der deutschen Verfassungsgeschichte zur Geschichte politischer
Ordnungen und Identitäten im europäischen Mittelalter, in: Zeitschrift für Geschichtswissen-
schaft 53/6 (2005), S. 485-500.
3 So prononciert etwa die Frühneuzeithistorikerin Barbara Stollberg-Rilinger: Was heißt Kultur-
geschichte des Politischen? Einleitung, in: Dies. (Hrsg.): Was heißt Kulturgeschichte des Politi-
schen? (Zeitschrift für historische Forschung; Beiheft 35), Berlin 2005, S. 9-24; Dies.: Verfas-
sungsgeschichte als Kulturgeschichte, in: ZRG Germ. Abt. 127 (2010), S. 1-32.