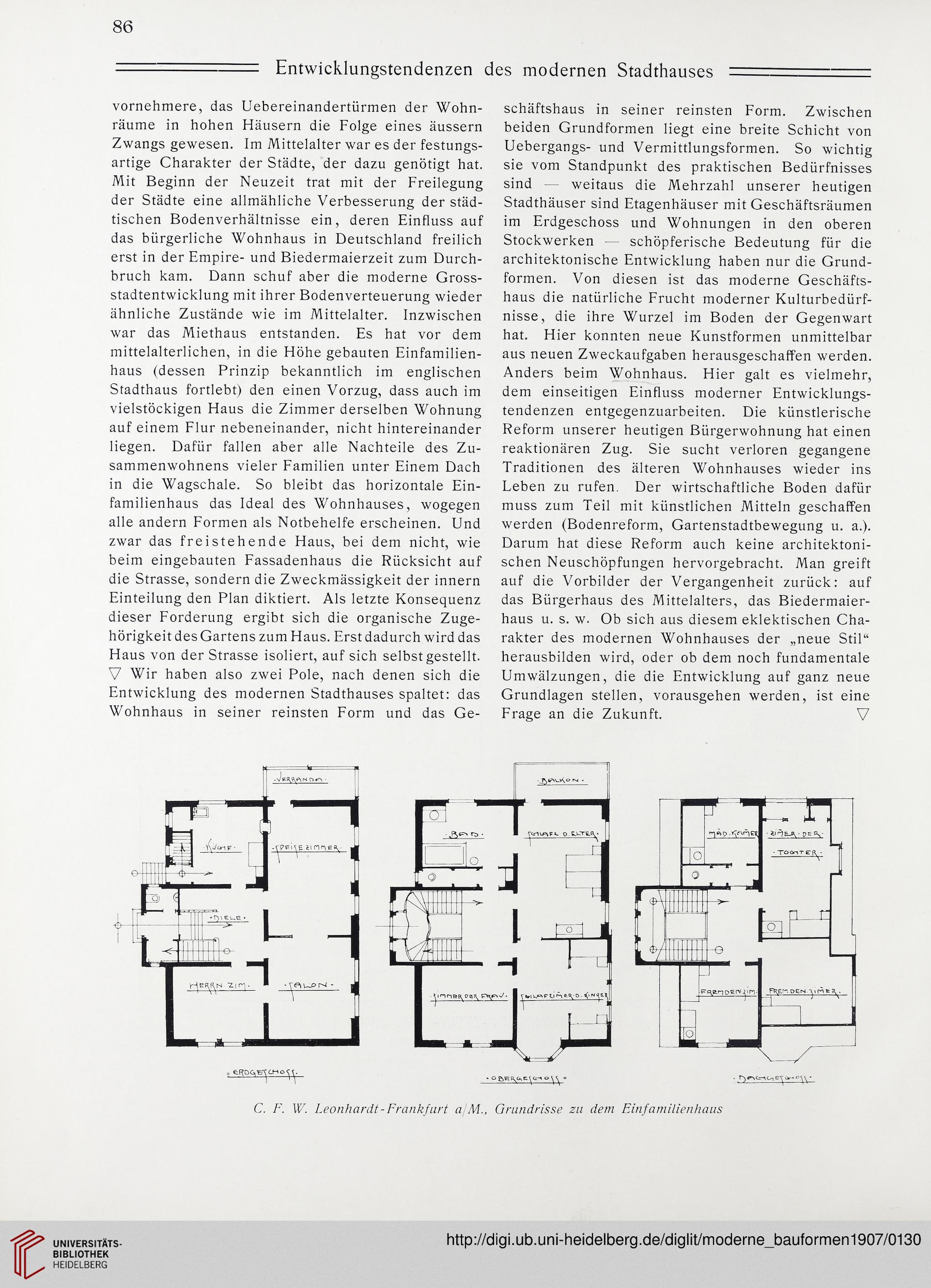86
Entwicklungstendenzen des modernen Stadthauses
vornehmere, das Uebereinandertürmen der Wohn-
räume in hohen Häusern die Folge eines äussern
Zwangs gewesen. Im Mittelalter war es der festungs-
artige Charakter der Städte, der dazu genötigt hat.
Mit Beginn der Neuzeit trat mit der Freilegung
der Städte eine allmähliche Verbesserung der städ-
tischen Bodenverhältnisse ein, deren Einfluss auf
das bürgerliche Wohnhaus in Deutschland freilich
erst in der Empire- und Biedermaierzeit zum Durch-
bruch kam. Dann schuf aber die moderne Gross-
stadtentwicklung mit ihrer Bodenverteuerung wieder
ähnliche Zustände wie im Mittelalter. Inzwischen
war das Miethaus entstanden. Es hat vor dem
mittelalterlichen, in die Höhe gebauten Einfamilien-
haus (dessen Prinzip bekanntlich im englischen
Stadthaus fortlebt) den einen Vorzug, dass auch im
vielstöckigen Haus die Zimmer derselben Wohnung
auf einem Flur nebeneinander, nicht hintereinander
liegen. Dafür fallen aber alle Nachteile des Zu-
sammenwohnens vieler Familien unter Einem Dach
in die Wagschale. So bleibt das horizontale Ein-
familienhaus das Ideal des Wohnhauses, wogegen
alle andern Formen als Notbehelfe erscheinen. Und
zwar das freistehende Haus, bei dem nicht, wie
beim eingebauten Fassadenhaus die Rücksicht auf
die Strasse, sondern die Zweckmässigkeit der innern
Einteilung den Plan diktiert. Als letzte Konsequenz
dieser Forderung ergibt sich die organische Zuge-
hörigkeit des Gartens zum Haus. Erst dadurch wird das
Haus von der Strasse isoliert, auf sich selbstgestellt.
V Wir haben also zwei Pole, nach denen sich die
Entwicklung des modernen Stadthauses spaltet: das
Wohnhaus in seiner reinsten Form und das Ge-
schäftshaus in seiner reinsten Form. Zwischen
beiden Grundformen liegt eine breite Schicht von
Uebergangs- und Vermittlungsformen. So wichtig
sie vom Standpunkt des praktischen Bedürfnisses
sind — weitaus die Mehrzahl unserer heutigen
Stadthäuser sind Etagenhäuser mit Geschäftsräumen
im Erdgeschoss und Wohnungen in den oberen
Stockwerken — schöpferische Bedeutung für die
architektonische Entwicklung haben nur die Grund-
formen. Von diesen ist das moderne Geschäfts-
haus die natürliche Frucht moderner Kulturbedürf-
nisse, die ihre Wurzel im Boden der Gegenwart
hat. Hier konnten neue Kunstformen unmittelbar
aus neuen Zweckaufgaben herausgeschaffen werden.
Anders beim Wohnhaus. Hier galt es vielmehr,
dem einseitigen Einfluss moderner Entwicklungs-
tendenzen entgegenzuarbeiten. Die künstlerische
Reform unserer heutigen Bürgerwohnung hat einen
reaktionären Zug. Sie sucht verloren gegangene
Traditionen des älteren Wohnhauses wieder ins
Leben zu rufen. Der wirtschaftliche Boden dafür
muss zum Teil mit künstlichen Mitteln geschaffen
werden (Bodenreform, Gartenstadtbewegung u. a.).
Darum hat diese Reform auch keine architektoni-
schen Neuschöpfungen hervorgebracht. Man greift
auf die Vorbilder der Vergangenheit zurück: auf
das Bürgerhaus des Mittelalters, das Biedermaier-
haus u. s. w. Ob sich aus diesem eklektischen Cha-
rakter des modernen Wohnhauses der „neue Stil“
herausbilden wird, oder ob dem noch fundamentale
Umwälzungen, die die Entwicklung auf ganz neue
Grundlagen stellen, vorausgehen werden, ist eine
Frage an die Zukunft. V
C. F. W. Leonhardt-Frankfurt a M., Grundrisse zu dem Einfamilienhaus
Entwicklungstendenzen des modernen Stadthauses
vornehmere, das Uebereinandertürmen der Wohn-
räume in hohen Häusern die Folge eines äussern
Zwangs gewesen. Im Mittelalter war es der festungs-
artige Charakter der Städte, der dazu genötigt hat.
Mit Beginn der Neuzeit trat mit der Freilegung
der Städte eine allmähliche Verbesserung der städ-
tischen Bodenverhältnisse ein, deren Einfluss auf
das bürgerliche Wohnhaus in Deutschland freilich
erst in der Empire- und Biedermaierzeit zum Durch-
bruch kam. Dann schuf aber die moderne Gross-
stadtentwicklung mit ihrer Bodenverteuerung wieder
ähnliche Zustände wie im Mittelalter. Inzwischen
war das Miethaus entstanden. Es hat vor dem
mittelalterlichen, in die Höhe gebauten Einfamilien-
haus (dessen Prinzip bekanntlich im englischen
Stadthaus fortlebt) den einen Vorzug, dass auch im
vielstöckigen Haus die Zimmer derselben Wohnung
auf einem Flur nebeneinander, nicht hintereinander
liegen. Dafür fallen aber alle Nachteile des Zu-
sammenwohnens vieler Familien unter Einem Dach
in die Wagschale. So bleibt das horizontale Ein-
familienhaus das Ideal des Wohnhauses, wogegen
alle andern Formen als Notbehelfe erscheinen. Und
zwar das freistehende Haus, bei dem nicht, wie
beim eingebauten Fassadenhaus die Rücksicht auf
die Strasse, sondern die Zweckmässigkeit der innern
Einteilung den Plan diktiert. Als letzte Konsequenz
dieser Forderung ergibt sich die organische Zuge-
hörigkeit des Gartens zum Haus. Erst dadurch wird das
Haus von der Strasse isoliert, auf sich selbstgestellt.
V Wir haben also zwei Pole, nach denen sich die
Entwicklung des modernen Stadthauses spaltet: das
Wohnhaus in seiner reinsten Form und das Ge-
schäftshaus in seiner reinsten Form. Zwischen
beiden Grundformen liegt eine breite Schicht von
Uebergangs- und Vermittlungsformen. So wichtig
sie vom Standpunkt des praktischen Bedürfnisses
sind — weitaus die Mehrzahl unserer heutigen
Stadthäuser sind Etagenhäuser mit Geschäftsräumen
im Erdgeschoss und Wohnungen in den oberen
Stockwerken — schöpferische Bedeutung für die
architektonische Entwicklung haben nur die Grund-
formen. Von diesen ist das moderne Geschäfts-
haus die natürliche Frucht moderner Kulturbedürf-
nisse, die ihre Wurzel im Boden der Gegenwart
hat. Hier konnten neue Kunstformen unmittelbar
aus neuen Zweckaufgaben herausgeschaffen werden.
Anders beim Wohnhaus. Hier galt es vielmehr,
dem einseitigen Einfluss moderner Entwicklungs-
tendenzen entgegenzuarbeiten. Die künstlerische
Reform unserer heutigen Bürgerwohnung hat einen
reaktionären Zug. Sie sucht verloren gegangene
Traditionen des älteren Wohnhauses wieder ins
Leben zu rufen. Der wirtschaftliche Boden dafür
muss zum Teil mit künstlichen Mitteln geschaffen
werden (Bodenreform, Gartenstadtbewegung u. a.).
Darum hat diese Reform auch keine architektoni-
schen Neuschöpfungen hervorgebracht. Man greift
auf die Vorbilder der Vergangenheit zurück: auf
das Bürgerhaus des Mittelalters, das Biedermaier-
haus u. s. w. Ob sich aus diesem eklektischen Cha-
rakter des modernen Wohnhauses der „neue Stil“
herausbilden wird, oder ob dem noch fundamentale
Umwälzungen, die die Entwicklung auf ganz neue
Grundlagen stellen, vorausgehen werden, ist eine
Frage an die Zukunft. V
C. F. W. Leonhardt-Frankfurt a M., Grundrisse zu dem Einfamilienhaus