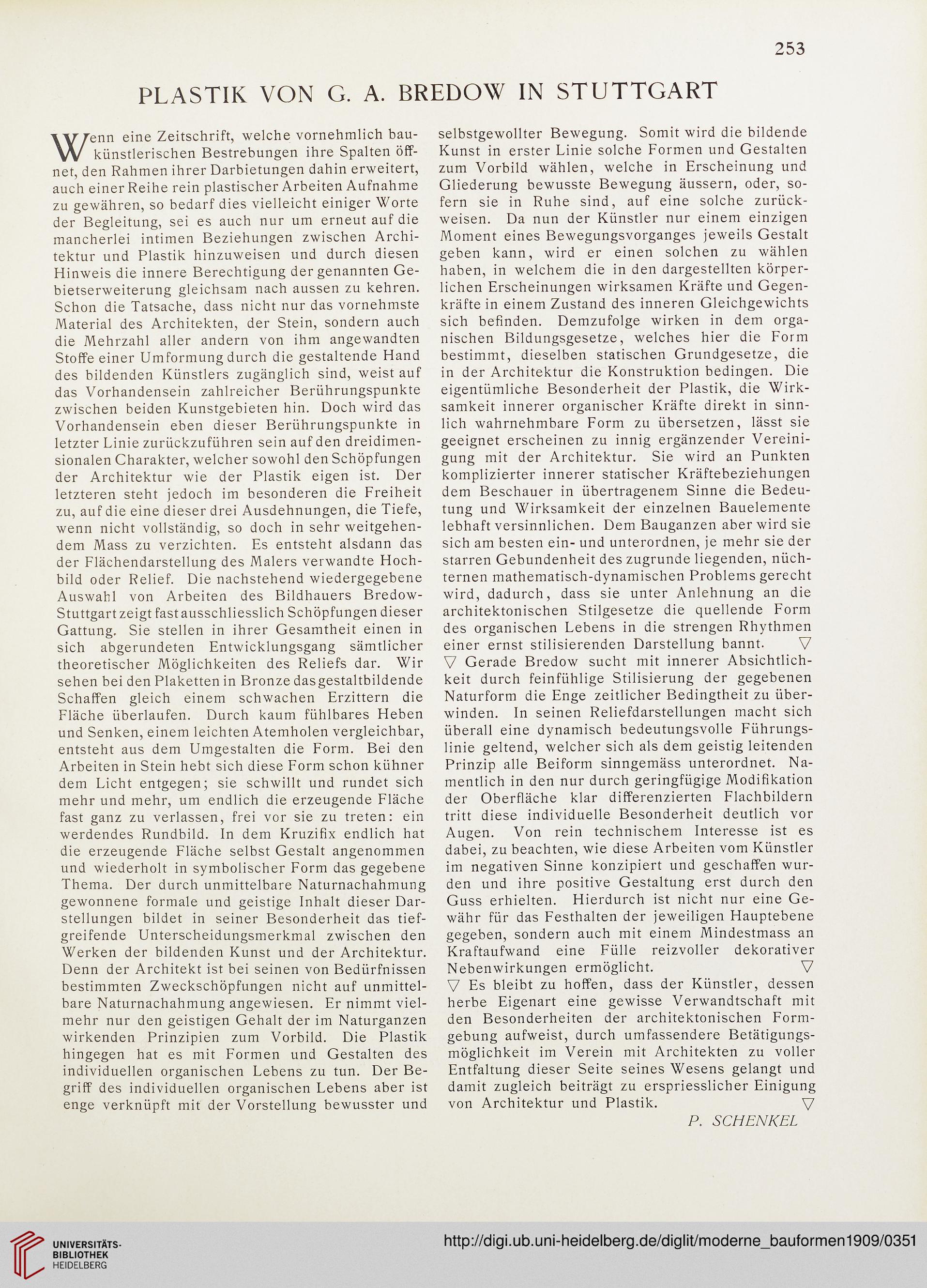253
PLASTIK VON G. A. BREDOW IN STUTTGART
Wenn eine Zeitschrift, welche vornehmlich bau-
künstlerischen Bestrebungen ihre Spalten öff-
net, den Rahmen ihrer Darbietungen dahin erweitert,
auch einer Reihe rein plastischer Arbeiten Aufnahme
zu gewähren, so bedarf dies vielleicht einiger Worte
der Begleitung, sei es auch nur um erneut auf die
mancherlei intimen Beziehungen zwischen Archi-
tektur und Plastik hinzuweisen und durch diesen
Hinweis die innere Berechtigung der genannten Ge-
bietserweiterung gleichsam nach aussen zu kehren.
Schon die Tatsache, dass nicht nur das vornehmste
Material des Architekten, der Stein, sondern auch
die Mehrzahl aller andern von ihm angewandten
Stoffe einer Umformung durch die gestaltende Hand
des bildenden Künstlers zugänglich sind, weist auf
das Vorhandensein zahlreicher Berührungspunkte
zwischen beiden Kunstgebieten hin. Doch wird das
Vorhandensein eben dieser Berührungspunkte in
letzter Linie zurückzuführen sein auf den dreidimen-
sionalen Charakter, welcher sowohl den Schöpfungen
der Architektur wie der Plastik eigen ist. Der
letzteren steht jedoch im besonderen die Freiheit
zu, auf die eine dieser drei Ausdehnungen, die Tiefe,
wenn nicht vollständig, so doch in sehr weitgehen-
dem Mass zu verzichten. Es entsteht alsdann das
der Flächendarstellung des Malers verwandte Hoch-
bild oder Relief. Die nachstehend wiedergegebene
Auswahl von Arbeiten des Bildhauers Bredow-
Stuttgart zeigt fast ausschliesslich Schöpfungen dieser
Gattung. Sie stellen in ihrer Gesamtheit einen in
sich abgerundeten Entwicklungsgang sämtlicher
theoretischer Möglichkeiten des Reliefs dar. Wir
sehen bei den Plaketten in Bronze dasgestaltbildende
Schaffen gleich einem schwachen Erzittern die
Fläche überlaufen. Durch kaum fühlbares Heben
und Senken, einem leichten Atemholen vergleichbar,
entsteht aus dem Umgestalten die Form. Bei den
Arbeiten in Stein hebt sich diese Form schon kühner
dem Licht entgegen; sie schwillt und rundet sich
mehr und mehr, um endlich die erzeugende Fläche
fast ganz zu verlassen, frei vor sie zu treten: ein
werdendes Rundbild. In dem Kruzifix endlich hat
die erzeugende Fläche selbst Gestalt angenommen
und wiederholt in symbolischer Form das gegebene
Thema. Der durch unmittelbare Naturnachahmung
gewonnene formale und geistige Inhalt dieser Dar-
stellungen bildet in seiner Besonderheit das tief-
greifende Unterscheidungsmerkmal zwischen den
Werken der bildenden Kunst und der Architektur.
Denn der Architekt ist bei seinen von Bedürfnissen
bestimmten Zweckschöpfungen nicht auf unmittel-
bare Naturnachahmung angewiesen. Er nimmt viel-
mehr nur den geistigen Gehalt der im Naturganzen
wirkenden Prinzipien zum Vorbild. Die Plastik
hingegen hat es mit Formen und Gestalten des
individuellen organischen Lebens zu tun. Der Be-
griff des individuellen organischen Lebens aber ist
enge verknüpft mit der Vorstellung bewusster und
selbstgewollter Bewegung. Somit wird die bildende
Kunst in erster Linie solche Formen und Gestalten
zum Vorbild wählen, welche in Erscheinung und
Gliederung bewusste Bewegung äussern, oder, so-
fern sie in Ruhe sind, auf eine solche zurück-
weisen. Da nun der Künstler nur einem einzigen
Moment eines Bewegungsvorganges jeweils Gestalt
geben kann, wird er einen solchen zu wählen
haben, in welchem die in den dargestellten körper-
lichen Erscheinungen wirksamen Kräfte und Gegen-
kräfte in einem Zustand des inneren Gleichgewichts
sich befinden. Demzufolge wirken in dem orga-
nischen Bildungsgesetze, welches hier die Form
bestimmt, dieselben statischen Grundgesetze, die
in der Architektur die Konstruktion bedingen. Die
eigentümliche Besonderheit der Plastik, die Wirk-
samkeit innerer organischer Kräfte direkt in sinn-
lich wahrnehmbare Form zu übersetzen, lässt sie
geeignet erscheinen zu innig ergänzender Vereini-
gung mit der Architektur. Sie wird an Punkten
komplizierter innerer statischer Kräftebeziehungen
dem Beschauer in übertragenem Sinne die Bedeu-
tung und Wirksamkeit der einzelnen Bauelemente
lebhaft versinnlichen. Dem Bauganzen aber wird sie
sich am besten ein- und unterordnen, je mehr sie der
starren Gebundenheit des zugrunde liegenden, nüch-
ternen mathematisch-dynamischen Problems gerecht
wird, dadurch, dass sie unter Anlehnung an die
architektonischen Stilgesetze die quellende Form
des organischen Lebens in die strengen Rhythmen
einer ernst stilisierenden Darstellung bannt. V
V Gerade Bredow sucht mit innerer Absichtlich-
keit durch feinfühlige Stilisierung der gegebenen
Naturform die Enge zeitlicher Bedingtheit zu über-
winden. In seinen Reliefdarstellungen macht sich
überall eine dynamisch bedeutungsvolle Führungs-
linie geltend, welcher sich als dem geistig leitenden
Prinzip alle Beiform sinngemäss unterordnet. Na-
mentlich in den nur durch geringfügige Modifikation
der Oberfläche klar differenzierten Flachbildern
tritt diese individuelle Besonderheit deutlich vor
Augen. Von rein technischem Interesse ist es
dabei, zu beachten, wie diese Arbeiten vom Künstler
im negativen Sinne konzipiert und geschaffen wur-
den und ihre positive Gestaltung erst durch den
Guss erhielten. Hierdurch ist nicht nur eine Ge-
währ für das Festhalten der jeweiligen Hauptebene
gegeben, sondern auch mit einem Mindestmass an
Kraftaufwand eine Fülle reizvoller dekorativer
Nebenwirkungen ermöglicht. V
V Es bleibt zu hoffen, dass der Künstler, dessen
herbe Eigenart eine gewisse Verwandtschaft mit
den Besonderheiten der architektonischen Form-
gebung aufweist, durch umfassendere Betätigungs-
möglichkeit im Verein mit Architekten zu voller
Entfaltung dieser Seite seines Wesens gelangt und
damit zugleich beiträgt zu erspriesslicher Einigung
von Architektur und Plastik. \7
P. SCHENKEL
PLASTIK VON G. A. BREDOW IN STUTTGART
Wenn eine Zeitschrift, welche vornehmlich bau-
künstlerischen Bestrebungen ihre Spalten öff-
net, den Rahmen ihrer Darbietungen dahin erweitert,
auch einer Reihe rein plastischer Arbeiten Aufnahme
zu gewähren, so bedarf dies vielleicht einiger Worte
der Begleitung, sei es auch nur um erneut auf die
mancherlei intimen Beziehungen zwischen Archi-
tektur und Plastik hinzuweisen und durch diesen
Hinweis die innere Berechtigung der genannten Ge-
bietserweiterung gleichsam nach aussen zu kehren.
Schon die Tatsache, dass nicht nur das vornehmste
Material des Architekten, der Stein, sondern auch
die Mehrzahl aller andern von ihm angewandten
Stoffe einer Umformung durch die gestaltende Hand
des bildenden Künstlers zugänglich sind, weist auf
das Vorhandensein zahlreicher Berührungspunkte
zwischen beiden Kunstgebieten hin. Doch wird das
Vorhandensein eben dieser Berührungspunkte in
letzter Linie zurückzuführen sein auf den dreidimen-
sionalen Charakter, welcher sowohl den Schöpfungen
der Architektur wie der Plastik eigen ist. Der
letzteren steht jedoch im besonderen die Freiheit
zu, auf die eine dieser drei Ausdehnungen, die Tiefe,
wenn nicht vollständig, so doch in sehr weitgehen-
dem Mass zu verzichten. Es entsteht alsdann das
der Flächendarstellung des Malers verwandte Hoch-
bild oder Relief. Die nachstehend wiedergegebene
Auswahl von Arbeiten des Bildhauers Bredow-
Stuttgart zeigt fast ausschliesslich Schöpfungen dieser
Gattung. Sie stellen in ihrer Gesamtheit einen in
sich abgerundeten Entwicklungsgang sämtlicher
theoretischer Möglichkeiten des Reliefs dar. Wir
sehen bei den Plaketten in Bronze dasgestaltbildende
Schaffen gleich einem schwachen Erzittern die
Fläche überlaufen. Durch kaum fühlbares Heben
und Senken, einem leichten Atemholen vergleichbar,
entsteht aus dem Umgestalten die Form. Bei den
Arbeiten in Stein hebt sich diese Form schon kühner
dem Licht entgegen; sie schwillt und rundet sich
mehr und mehr, um endlich die erzeugende Fläche
fast ganz zu verlassen, frei vor sie zu treten: ein
werdendes Rundbild. In dem Kruzifix endlich hat
die erzeugende Fläche selbst Gestalt angenommen
und wiederholt in symbolischer Form das gegebene
Thema. Der durch unmittelbare Naturnachahmung
gewonnene formale und geistige Inhalt dieser Dar-
stellungen bildet in seiner Besonderheit das tief-
greifende Unterscheidungsmerkmal zwischen den
Werken der bildenden Kunst und der Architektur.
Denn der Architekt ist bei seinen von Bedürfnissen
bestimmten Zweckschöpfungen nicht auf unmittel-
bare Naturnachahmung angewiesen. Er nimmt viel-
mehr nur den geistigen Gehalt der im Naturganzen
wirkenden Prinzipien zum Vorbild. Die Plastik
hingegen hat es mit Formen und Gestalten des
individuellen organischen Lebens zu tun. Der Be-
griff des individuellen organischen Lebens aber ist
enge verknüpft mit der Vorstellung bewusster und
selbstgewollter Bewegung. Somit wird die bildende
Kunst in erster Linie solche Formen und Gestalten
zum Vorbild wählen, welche in Erscheinung und
Gliederung bewusste Bewegung äussern, oder, so-
fern sie in Ruhe sind, auf eine solche zurück-
weisen. Da nun der Künstler nur einem einzigen
Moment eines Bewegungsvorganges jeweils Gestalt
geben kann, wird er einen solchen zu wählen
haben, in welchem die in den dargestellten körper-
lichen Erscheinungen wirksamen Kräfte und Gegen-
kräfte in einem Zustand des inneren Gleichgewichts
sich befinden. Demzufolge wirken in dem orga-
nischen Bildungsgesetze, welches hier die Form
bestimmt, dieselben statischen Grundgesetze, die
in der Architektur die Konstruktion bedingen. Die
eigentümliche Besonderheit der Plastik, die Wirk-
samkeit innerer organischer Kräfte direkt in sinn-
lich wahrnehmbare Form zu übersetzen, lässt sie
geeignet erscheinen zu innig ergänzender Vereini-
gung mit der Architektur. Sie wird an Punkten
komplizierter innerer statischer Kräftebeziehungen
dem Beschauer in übertragenem Sinne die Bedeu-
tung und Wirksamkeit der einzelnen Bauelemente
lebhaft versinnlichen. Dem Bauganzen aber wird sie
sich am besten ein- und unterordnen, je mehr sie der
starren Gebundenheit des zugrunde liegenden, nüch-
ternen mathematisch-dynamischen Problems gerecht
wird, dadurch, dass sie unter Anlehnung an die
architektonischen Stilgesetze die quellende Form
des organischen Lebens in die strengen Rhythmen
einer ernst stilisierenden Darstellung bannt. V
V Gerade Bredow sucht mit innerer Absichtlich-
keit durch feinfühlige Stilisierung der gegebenen
Naturform die Enge zeitlicher Bedingtheit zu über-
winden. In seinen Reliefdarstellungen macht sich
überall eine dynamisch bedeutungsvolle Führungs-
linie geltend, welcher sich als dem geistig leitenden
Prinzip alle Beiform sinngemäss unterordnet. Na-
mentlich in den nur durch geringfügige Modifikation
der Oberfläche klar differenzierten Flachbildern
tritt diese individuelle Besonderheit deutlich vor
Augen. Von rein technischem Interesse ist es
dabei, zu beachten, wie diese Arbeiten vom Künstler
im negativen Sinne konzipiert und geschaffen wur-
den und ihre positive Gestaltung erst durch den
Guss erhielten. Hierdurch ist nicht nur eine Ge-
währ für das Festhalten der jeweiligen Hauptebene
gegeben, sondern auch mit einem Mindestmass an
Kraftaufwand eine Fülle reizvoller dekorativer
Nebenwirkungen ermöglicht. V
V Es bleibt zu hoffen, dass der Künstler, dessen
herbe Eigenart eine gewisse Verwandtschaft mit
den Besonderheiten der architektonischen Form-
gebung aufweist, durch umfassendere Betätigungs-
möglichkeit im Verein mit Architekten zu voller
Entfaltung dieser Seite seines Wesens gelangt und
damit zugleich beiträgt zu erspriesslicher Einigung
von Architektur und Plastik. \7
P. SCHENKEL