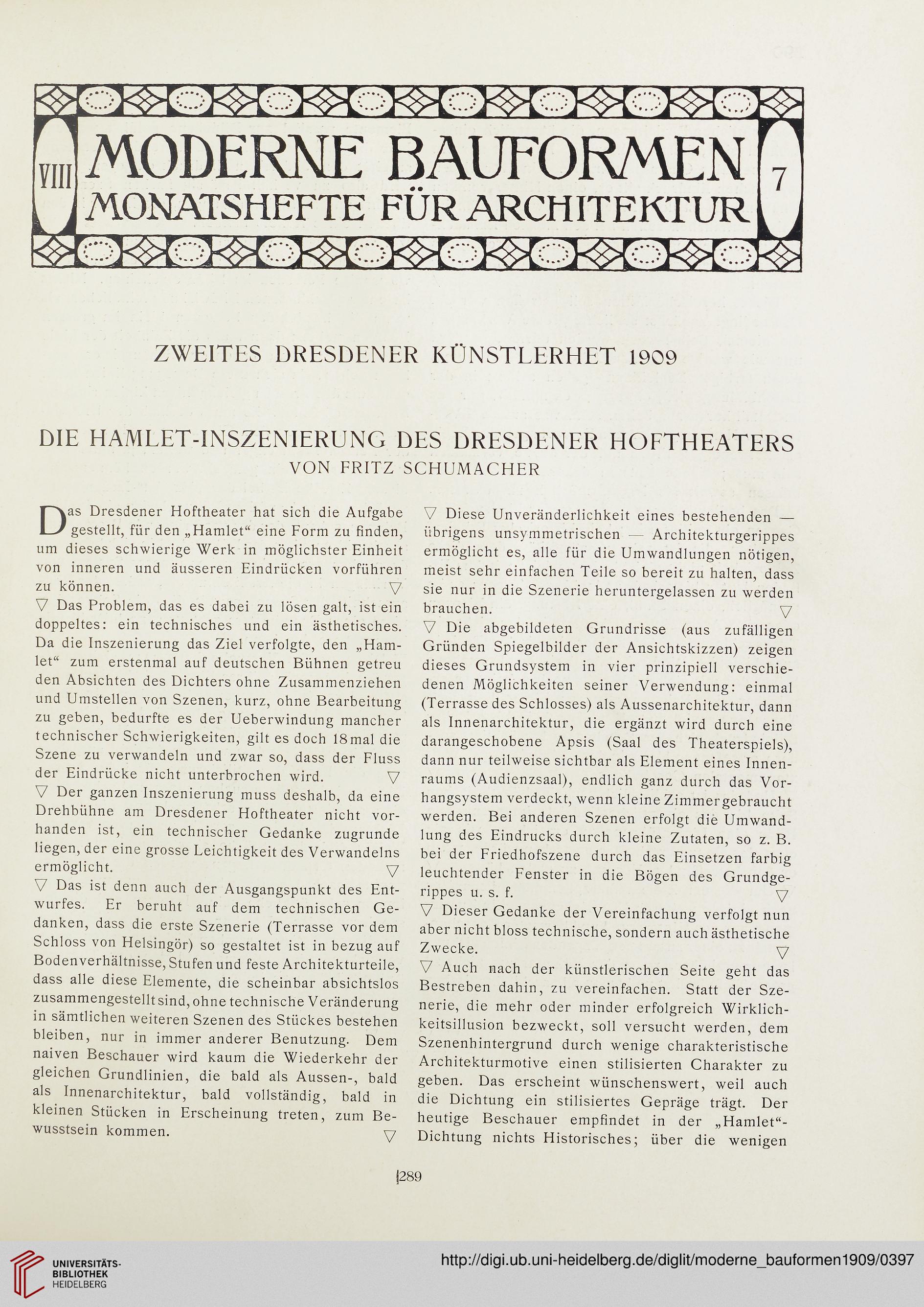m
U MODERNE BAUFORMEN
J MONATSHEFTE FÜR ARCHITEKTUR
n
7
M
«T-VT VT KT. KT KT KX -KXG
ZWEITES DRESDENER KÜNSTLERHET 1909
DIE HAMLET-INSZENIERUNG DES DRESDENER HOFTHEATERS
VON FRITZ SCHUMACHER
Das Dresdener Hoftheater hat sich die Aufgabe
gestellt, für den „Hamlet“ eine Form zu finden,
um dieses schwierige Werk in möglichster Einheit
von inneren und äusseren Eindrücken vorführen
zu können. V
V Das Problem, das es dabei zu lösen galt, ist ein
doppeltes: ein technisches und ein ästhetisches.
Da die Inszenierung das Ziel verfolgte, den „Ham-
let“ zum erstenmal auf deutschen Bühnen getreu
den Absichten des Dichters ohne Zusammenziehen
und Umstellen von Szenen, kurz, ohne Bearbeitung
zu geben, bedurfte es der Ueberwindung mancher
technischer Schwierigkeiten, gilt es doch 18mal die
Szene zu verwandeln und zwar so, dass der Fluss
der Eindrücke nicht unterbrochen wird. V
V Der ganzen Inszenierung muss deshalb, da eine
Drehbühne am Dresdener Hoftheater nicht vor-
handen ist, ein technischer Gedanke zugrunde
liegen, der eine grosse Leichtigkeit des Verwandelns
ermöglicht. V
V Das ist denn auch der Ausgangspunkt des Ent-
wurfes. Er beruht auf dem technischen Ge-
danken, dass die erste Szenerie (Terrasse vor dem
Schloss von Helsingör) so gestaltet ist in bezug auf
Bodenverhältnisse, Stufen und feste Architekturteile,
dass alle diese Elemente, die scheinbar absichtslos
zusammengestelltsind, ohne technische Veränderung
in sämtlichen weiteren Szenen des Stückes bestehen
bleiben, nur in immer anderer Benutzung. Dem
naiven Beschauer wird kaum die Wiederkehr der
gleichen Grundlinien, die bald als Aussen-, bald
als Innenarchitektur, bald vollständig, bald in
kleinen Stücken in Erscheinung treten, zum Be-
wusstsein kommen. y
V Diese Unveränderlichkeit eines bestehenden —
übrigens unsymmetrischen Architekturgerippes
ermöglicht es, alle für die Umwandlungen nötigen,
meist sehr einfachen Teile so bereit zu halten, dass
sie nur in die Szenerie heruntergelassen zu werden
brauchen. V
V Die abgebildeten Grundrisse (aus zufälligen
Gründen Spiegelbilder der Ansichtskizzen) zeigen
dieses Grundsystem in vier prinzipiell verschie-
denen Möglichkeiten seiner Verwendung: einmal
(Terrasse des Schlosses) als Aussenarchitektur, dann
als Innenarchitektur, die ergänzt wird durch eine
darangeschobene Apsis (Saal des Theaterspiels),
dann nur teilweise sichtbar als Element eines Innen-
raums (Audienzsaal), endlich ganz durch das Vor-
hangsystem verdeckt, wenn kleine Zimmer gebraucht
werden. Bei anderen Szenen erfolgt die Umwand-
lung des Eindrucks durch kleine Zutaten, so z. B.
bei der Friedhofszene durch das Einsetzen farbig
leuchtender Fenster in die Bögen des Grundge-
rippes u. s. f. V
V Dieser Gedanke der Vereinfachung verfolgt nun
aber nicht bloss technische, sondern auch ästhetische
Zwecke. V
V Auch nach der künstlerischen Seite geht das
Bestreben dahin, zu vereinfachen. Statt der Sze-
nerie, die mehr oder minder erfolgreich Wirklich-
keitsillusion bezweckt, soll versucht werden, dem
Szenenhintergrund durch wenige charakteristische
Architekturmotive einen stilisierten Charakter zu
geben. Das erscheint wünschenswert, weil auch
die Dichtung ein stilisiertes Gepräge trägt. Der
heutige Beschauer empfindet in der „Hamlet“-
Dichtung nichts Historisches; über die wenigen
1289
U MODERNE BAUFORMEN
J MONATSHEFTE FÜR ARCHITEKTUR
n
7
M
«T-VT VT KT. KT KT KX -KXG
ZWEITES DRESDENER KÜNSTLERHET 1909
DIE HAMLET-INSZENIERUNG DES DRESDENER HOFTHEATERS
VON FRITZ SCHUMACHER
Das Dresdener Hoftheater hat sich die Aufgabe
gestellt, für den „Hamlet“ eine Form zu finden,
um dieses schwierige Werk in möglichster Einheit
von inneren und äusseren Eindrücken vorführen
zu können. V
V Das Problem, das es dabei zu lösen galt, ist ein
doppeltes: ein technisches und ein ästhetisches.
Da die Inszenierung das Ziel verfolgte, den „Ham-
let“ zum erstenmal auf deutschen Bühnen getreu
den Absichten des Dichters ohne Zusammenziehen
und Umstellen von Szenen, kurz, ohne Bearbeitung
zu geben, bedurfte es der Ueberwindung mancher
technischer Schwierigkeiten, gilt es doch 18mal die
Szene zu verwandeln und zwar so, dass der Fluss
der Eindrücke nicht unterbrochen wird. V
V Der ganzen Inszenierung muss deshalb, da eine
Drehbühne am Dresdener Hoftheater nicht vor-
handen ist, ein technischer Gedanke zugrunde
liegen, der eine grosse Leichtigkeit des Verwandelns
ermöglicht. V
V Das ist denn auch der Ausgangspunkt des Ent-
wurfes. Er beruht auf dem technischen Ge-
danken, dass die erste Szenerie (Terrasse vor dem
Schloss von Helsingör) so gestaltet ist in bezug auf
Bodenverhältnisse, Stufen und feste Architekturteile,
dass alle diese Elemente, die scheinbar absichtslos
zusammengestelltsind, ohne technische Veränderung
in sämtlichen weiteren Szenen des Stückes bestehen
bleiben, nur in immer anderer Benutzung. Dem
naiven Beschauer wird kaum die Wiederkehr der
gleichen Grundlinien, die bald als Aussen-, bald
als Innenarchitektur, bald vollständig, bald in
kleinen Stücken in Erscheinung treten, zum Be-
wusstsein kommen. y
V Diese Unveränderlichkeit eines bestehenden —
übrigens unsymmetrischen Architekturgerippes
ermöglicht es, alle für die Umwandlungen nötigen,
meist sehr einfachen Teile so bereit zu halten, dass
sie nur in die Szenerie heruntergelassen zu werden
brauchen. V
V Die abgebildeten Grundrisse (aus zufälligen
Gründen Spiegelbilder der Ansichtskizzen) zeigen
dieses Grundsystem in vier prinzipiell verschie-
denen Möglichkeiten seiner Verwendung: einmal
(Terrasse des Schlosses) als Aussenarchitektur, dann
als Innenarchitektur, die ergänzt wird durch eine
darangeschobene Apsis (Saal des Theaterspiels),
dann nur teilweise sichtbar als Element eines Innen-
raums (Audienzsaal), endlich ganz durch das Vor-
hangsystem verdeckt, wenn kleine Zimmer gebraucht
werden. Bei anderen Szenen erfolgt die Umwand-
lung des Eindrucks durch kleine Zutaten, so z. B.
bei der Friedhofszene durch das Einsetzen farbig
leuchtender Fenster in die Bögen des Grundge-
rippes u. s. f. V
V Dieser Gedanke der Vereinfachung verfolgt nun
aber nicht bloss technische, sondern auch ästhetische
Zwecke. V
V Auch nach der künstlerischen Seite geht das
Bestreben dahin, zu vereinfachen. Statt der Sze-
nerie, die mehr oder minder erfolgreich Wirklich-
keitsillusion bezweckt, soll versucht werden, dem
Szenenhintergrund durch wenige charakteristische
Architekturmotive einen stilisierten Charakter zu
geben. Das erscheint wünschenswert, weil auch
die Dichtung ein stilisiertes Gepräge trägt. Der
heutige Beschauer empfindet in der „Hamlet“-
Dichtung nichts Historisches; über die wenigen
1289