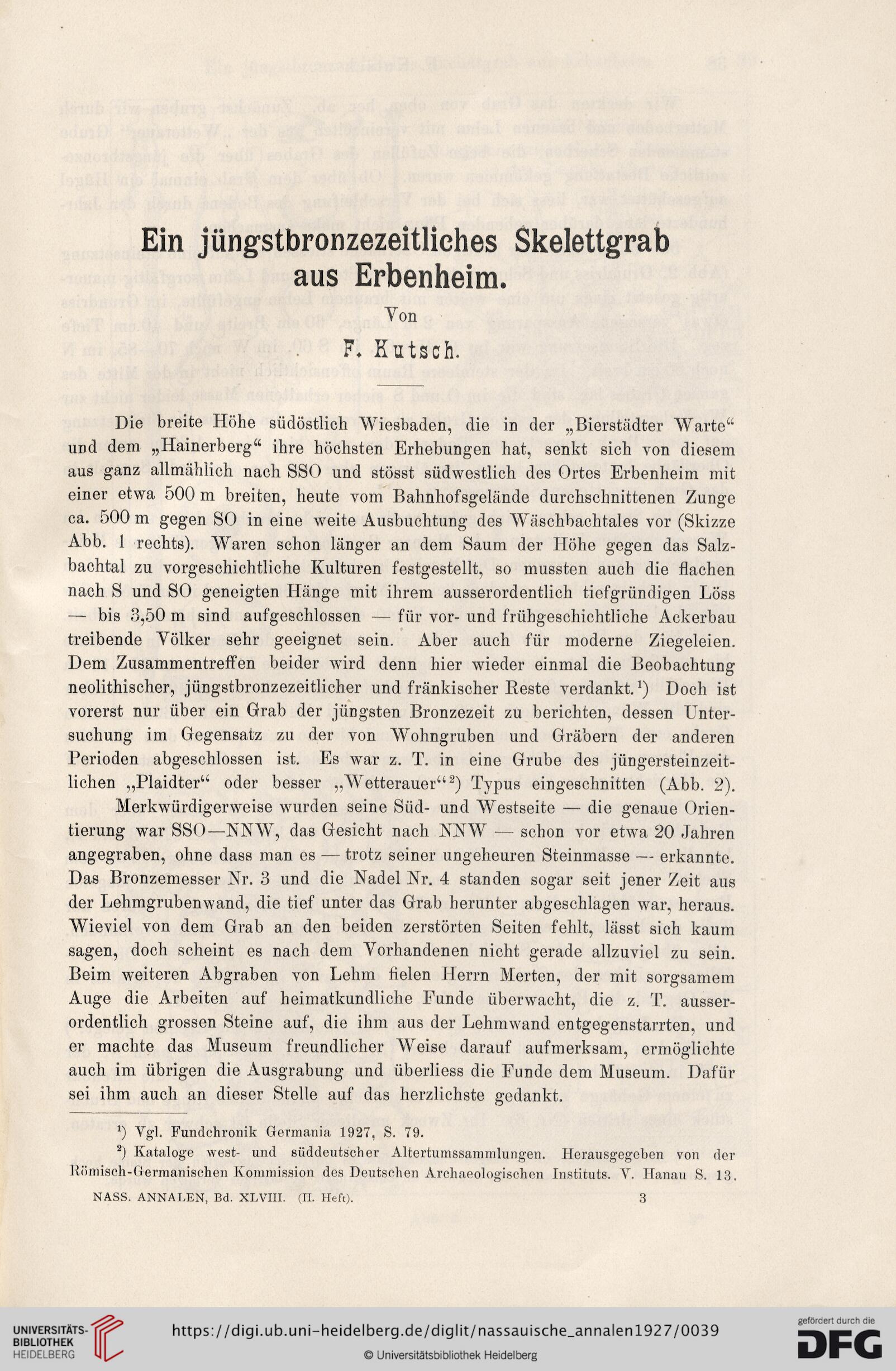Ein jüngstbronzezeitliches Skelettgrab
aus Erbenheim.
Von
F. Kutsch.
Die breite Höhe südöstlich Wiesbaden, die in der „Bierstädter Warte“
und dem „Hainerberg“ ihre höchsten Erhebungen hat, senkt sich von diesem
aus ganz allmählich nach SSO und stösst südwestlich des Ortes Erbenheim mit
einer etwa 500 m breiten, heute vom Bahnhofsgelände durchschnittenen Zunge
ca. 500 m gegen SO in eine weite Ausbuchtung des Wäschbachtales vor (Skizze
Abb. 1 rechts). Waren schon länger an dem Saum der Höhe gegen das Salz-
bachtal zu vorgeschichtliche Kulturen festgestellt, so mussten auch die flachen
nach S und SO geneigten Hänge mit ihrem ausserordentlich tiefgründigen Löss
— bis 3,50 m sind aufgeschlossen — für vor- und frühgeschichtliche Ackerbau
treibende Völker sehr geeignet sein. Aber auch für moderne Ziegeleien.
Dem Zusammentreffen beider wird denn hier wieder einmal die Beobachtung
neolithischer, jüngstbronzezeitlicher und fränkischer Reste verdankt.1) Doch ist
vorerst nur über ein Grab der jüngsten Bronzezeit zu berichten, dessen Unter-
suchung im Gegensatz zu der von Wohngruben und Gräbern der anderen
Perioden abgeschlossen ist. Es war z. T. in eine Grube des jüngersteinzeit-
lichen „Plaidter“ oder besser „Wetterauer“2 *) Typus eingeschnitten (Abb. 2).
Merkwürdigerweise wurden seine Süd- und Westseite — die genaue Orien-
tierung war SSO—NNW, das Gesicht nach NNW — schon vor etwa 20 Jahren
angegraben, ohne dass man es — trotz seiner ungeheuren Steinmasse — erkannte.
Das Bronzemesser Nr. 3 und die Nadel Nr. 4 standen sogar seit jener Zeit aus
der Lehmgrubenwand, die tief unter das Grab herunter abgeschlagen war, heraus.
Wieviel von dem Grab an den beiden zerstörten Seiten fehlt, lässt sich kaum
sagen, doch scheint es nach dem Vorhandenen nicht gerade allzuviel zu sein.
Beim weiteren Abgraben von Lehm fielen Herrn Merten, der mit sorgsamem
Auge die Arbeiten auf heimatkundliche Funde überwacht, die z. T. ausser-
ordentlich grossen Steine auf, die ihm aus der Lehmwand entgegenstarrten, und
er machte das Museum freundlicher Weise darauf aufmerksam, ermöglichte
auch im übrigen die Ausgrabung und überliess die Funde dem Museum. Dafür
sei ihm auch an dieser Stelle auf das herzlichste gedankt.
*) Vgl. Fundchronik Germania 1927, S. 79.
2) Kataloge west- und süddeutscher Altertumssammlungen. Herausgegeben von der
Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archaeologischen Instituts. V. Hanau S. 13.
NASS. ANNALEN, Bd. XLVIII. (II. Heft).
3
aus Erbenheim.
Von
F. Kutsch.
Die breite Höhe südöstlich Wiesbaden, die in der „Bierstädter Warte“
und dem „Hainerberg“ ihre höchsten Erhebungen hat, senkt sich von diesem
aus ganz allmählich nach SSO und stösst südwestlich des Ortes Erbenheim mit
einer etwa 500 m breiten, heute vom Bahnhofsgelände durchschnittenen Zunge
ca. 500 m gegen SO in eine weite Ausbuchtung des Wäschbachtales vor (Skizze
Abb. 1 rechts). Waren schon länger an dem Saum der Höhe gegen das Salz-
bachtal zu vorgeschichtliche Kulturen festgestellt, so mussten auch die flachen
nach S und SO geneigten Hänge mit ihrem ausserordentlich tiefgründigen Löss
— bis 3,50 m sind aufgeschlossen — für vor- und frühgeschichtliche Ackerbau
treibende Völker sehr geeignet sein. Aber auch für moderne Ziegeleien.
Dem Zusammentreffen beider wird denn hier wieder einmal die Beobachtung
neolithischer, jüngstbronzezeitlicher und fränkischer Reste verdankt.1) Doch ist
vorerst nur über ein Grab der jüngsten Bronzezeit zu berichten, dessen Unter-
suchung im Gegensatz zu der von Wohngruben und Gräbern der anderen
Perioden abgeschlossen ist. Es war z. T. in eine Grube des jüngersteinzeit-
lichen „Plaidter“ oder besser „Wetterauer“2 *) Typus eingeschnitten (Abb. 2).
Merkwürdigerweise wurden seine Süd- und Westseite — die genaue Orien-
tierung war SSO—NNW, das Gesicht nach NNW — schon vor etwa 20 Jahren
angegraben, ohne dass man es — trotz seiner ungeheuren Steinmasse — erkannte.
Das Bronzemesser Nr. 3 und die Nadel Nr. 4 standen sogar seit jener Zeit aus
der Lehmgrubenwand, die tief unter das Grab herunter abgeschlagen war, heraus.
Wieviel von dem Grab an den beiden zerstörten Seiten fehlt, lässt sich kaum
sagen, doch scheint es nach dem Vorhandenen nicht gerade allzuviel zu sein.
Beim weiteren Abgraben von Lehm fielen Herrn Merten, der mit sorgsamem
Auge die Arbeiten auf heimatkundliche Funde überwacht, die z. T. ausser-
ordentlich grossen Steine auf, die ihm aus der Lehmwand entgegenstarrten, und
er machte das Museum freundlicher Weise darauf aufmerksam, ermöglichte
auch im übrigen die Ausgrabung und überliess die Funde dem Museum. Dafür
sei ihm auch an dieser Stelle auf das herzlichste gedankt.
*) Vgl. Fundchronik Germania 1927, S. 79.
2) Kataloge west- und süddeutscher Altertumssammlungen. Herausgegeben von der
Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archaeologischen Instituts. V. Hanau S. 13.
NASS. ANNALEN, Bd. XLVIII. (II. Heft).
3