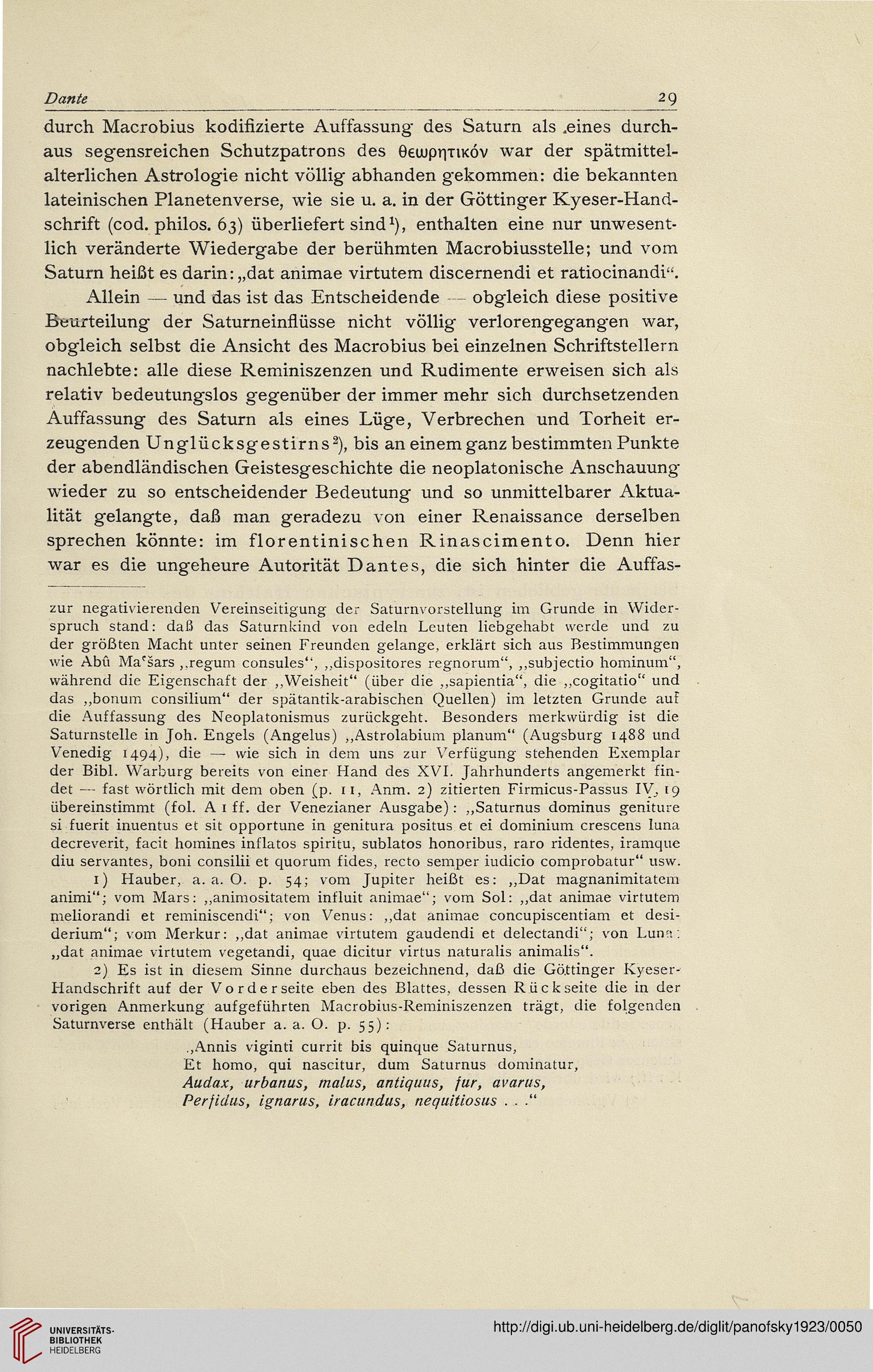Dante
29
durch Macrobius kodifizierte Auffassung des Saturn als .eines durch-
aus segensreichen Schutzpatrons des 0euupr|TiKÖv war der spätmittel-
alterlichen Astrologie nicht völlig abhanden gekommen: die bekannten
lateinischen Planetenverse, wie sie u. a. in der Göttinger Kyeser-Hand-
schrift (cod. philos. 63) überliefert sind* 1), enthalten eine nur unwesent-
lich veränderte Wiedergabe der berühmten Macrobiusstelle; und vom
Saturn heißt es darin:„dat animae virtutem discernendi et ratiocinandi“.
Allein — und das ist das Entscheidende — obgleich diese positive
Beurteilung der Saturneinflüsse nicht völlig verlorengegangen war,
obgleich selbst die Ansicht des Macrobius bei einzelnen Schriftstellern
nachlebte: alle diese Reminiszenzen und Rudimente erweisen sich als
relativ bedeutungslos gegenüber der immer mehr sich durchsetzenden
Auffassung des Saturn als eines Lüge, Verbrechen und Torheit er-
zeugenden Unglücksgestirns2), bis an einem ganz bestimmten Punkte
der abendländischen Geistesgeschichte die neoplatonische Anschauung’
wieder zu so entscheidender Bedeutung und so unmittelbarer Aktua-
lität gelangte, daß man geradezu von einer Renaissance derselben
sprechen könnte: im florentinischen Rinascimento. Denn hier
war es die ungeheure Autorität Dantes, die sich hinter die Auffas-
zur negativierenden Vereinseitigung der Saturnvorstellung im Grunde in Wider-
spruch stand: daß das Saturnkind von edeln Leuten liebgehabt vverde und zu
der größten Macht unter seinen Freunden gelange, erklärt sich aus Bestimmungen
wie Abü Mafsars ,.regum consules“, ,,dispositores regnorum“, ,,subjectio hominum“,
vvährend die Eigenschaft der ,,Weisheit“ (über die „sapientia“, die „cogitatio“ und
das ,,bonum consilium“ der spätantik-arabischen Quellen) im letzten Grunde auf
die Auffassung des Neoplatonismus zurückgeht. Besonders merkvvürdig ist die
Saturnstelle in Joh. Engels (Angelus) „Astrolabium planum“ (Augsburg 1488 und
Venedig 1494), die — vvie sich in dem uns zur Verfügung stehenden Exemplar
der Bibl. Warburg bereits von einer Hand des XVI. Jahrhunderts angemerkt fin-
det — fast wörtlich mit dem oben (p. 11, Anm. 2) zitierten Firmicus-Passus iy.. 19
iibereinstimmt (fol. A 1 ff. der Venezianer Ausgabe): „Saturnus dominus geniture
si fuerit inuentus et sit opportune in genitura positus et ei dominium crescens luna
decreverit, facit homines inflatos spiritu, sublatos honoribus, raro l'identes, iramque
diu servantes, boni consilii et quorum fides, recto seniper iudicio comprobatur“ usw.
1) Flauber, a. a. O. p. 54; vom Jupiter heißt es: ,,Dat magnanimitatem
animi“; vom Mars: „animositatem influit animae“; vom Sol: ,,dat animae virtutem
meliorandi et reminiscendi“; von Venus: ,,dat animae concupiscentiam et desi-
derium“; vom Merkur: ,,dat animae virtutem gaudendi et delectandi“; von Luna:
,,dat animae virtutem vegetandi, quae dicitur virtus naturalis animalis“.
2) Es ist in diesem Sinne durchaus bezeichnend, daß die Gö.ttinger Kyeser-
Iiandschrift auf der Vorderseite eben des Blattes, dessen Rückseite die in der
vorigen Anmerkung aufgeführten Macrobius-Reminiszenzen trägt, die folgenden
Saturnverse enthält (Hauber a. a. O. p. 55):
„Annis viginti currit bis quinque Saturnus,
Et homo, qui nascitur, dum Saturnus dominatur,
Audax, urbanus, tnalus, antiquus, fur, avarus,
Perfidus, ignarus, iracundus, nequitiosus . . .“
29
durch Macrobius kodifizierte Auffassung des Saturn als .eines durch-
aus segensreichen Schutzpatrons des 0euupr|TiKÖv war der spätmittel-
alterlichen Astrologie nicht völlig abhanden gekommen: die bekannten
lateinischen Planetenverse, wie sie u. a. in der Göttinger Kyeser-Hand-
schrift (cod. philos. 63) überliefert sind* 1), enthalten eine nur unwesent-
lich veränderte Wiedergabe der berühmten Macrobiusstelle; und vom
Saturn heißt es darin:„dat animae virtutem discernendi et ratiocinandi“.
Allein — und das ist das Entscheidende — obgleich diese positive
Beurteilung der Saturneinflüsse nicht völlig verlorengegangen war,
obgleich selbst die Ansicht des Macrobius bei einzelnen Schriftstellern
nachlebte: alle diese Reminiszenzen und Rudimente erweisen sich als
relativ bedeutungslos gegenüber der immer mehr sich durchsetzenden
Auffassung des Saturn als eines Lüge, Verbrechen und Torheit er-
zeugenden Unglücksgestirns2), bis an einem ganz bestimmten Punkte
der abendländischen Geistesgeschichte die neoplatonische Anschauung’
wieder zu so entscheidender Bedeutung und so unmittelbarer Aktua-
lität gelangte, daß man geradezu von einer Renaissance derselben
sprechen könnte: im florentinischen Rinascimento. Denn hier
war es die ungeheure Autorität Dantes, die sich hinter die Auffas-
zur negativierenden Vereinseitigung der Saturnvorstellung im Grunde in Wider-
spruch stand: daß das Saturnkind von edeln Leuten liebgehabt vverde und zu
der größten Macht unter seinen Freunden gelange, erklärt sich aus Bestimmungen
wie Abü Mafsars ,.regum consules“, ,,dispositores regnorum“, ,,subjectio hominum“,
vvährend die Eigenschaft der ,,Weisheit“ (über die „sapientia“, die „cogitatio“ und
das ,,bonum consilium“ der spätantik-arabischen Quellen) im letzten Grunde auf
die Auffassung des Neoplatonismus zurückgeht. Besonders merkvvürdig ist die
Saturnstelle in Joh. Engels (Angelus) „Astrolabium planum“ (Augsburg 1488 und
Venedig 1494), die — vvie sich in dem uns zur Verfügung stehenden Exemplar
der Bibl. Warburg bereits von einer Hand des XVI. Jahrhunderts angemerkt fin-
det — fast wörtlich mit dem oben (p. 11, Anm. 2) zitierten Firmicus-Passus iy.. 19
iibereinstimmt (fol. A 1 ff. der Venezianer Ausgabe): „Saturnus dominus geniture
si fuerit inuentus et sit opportune in genitura positus et ei dominium crescens luna
decreverit, facit homines inflatos spiritu, sublatos honoribus, raro l'identes, iramque
diu servantes, boni consilii et quorum fides, recto seniper iudicio comprobatur“ usw.
1) Flauber, a. a. O. p. 54; vom Jupiter heißt es: ,,Dat magnanimitatem
animi“; vom Mars: „animositatem influit animae“; vom Sol: ,,dat animae virtutem
meliorandi et reminiscendi“; von Venus: ,,dat animae concupiscentiam et desi-
derium“; vom Merkur: ,,dat animae virtutem gaudendi et delectandi“; von Luna:
,,dat animae virtutem vegetandi, quae dicitur virtus naturalis animalis“.
2) Es ist in diesem Sinne durchaus bezeichnend, daß die Gö.ttinger Kyeser-
Iiandschrift auf der Vorderseite eben des Blattes, dessen Rückseite die in der
vorigen Anmerkung aufgeführten Macrobius-Reminiszenzen trägt, die folgenden
Saturnverse enthält (Hauber a. a. O. p. 55):
„Annis viginti currit bis quinque Saturnus,
Et homo, qui nascitur, dum Saturnus dominatur,
Audax, urbanus, tnalus, antiquus, fur, avarus,
Perfidus, ignarus, iracundus, nequitiosus . . .“