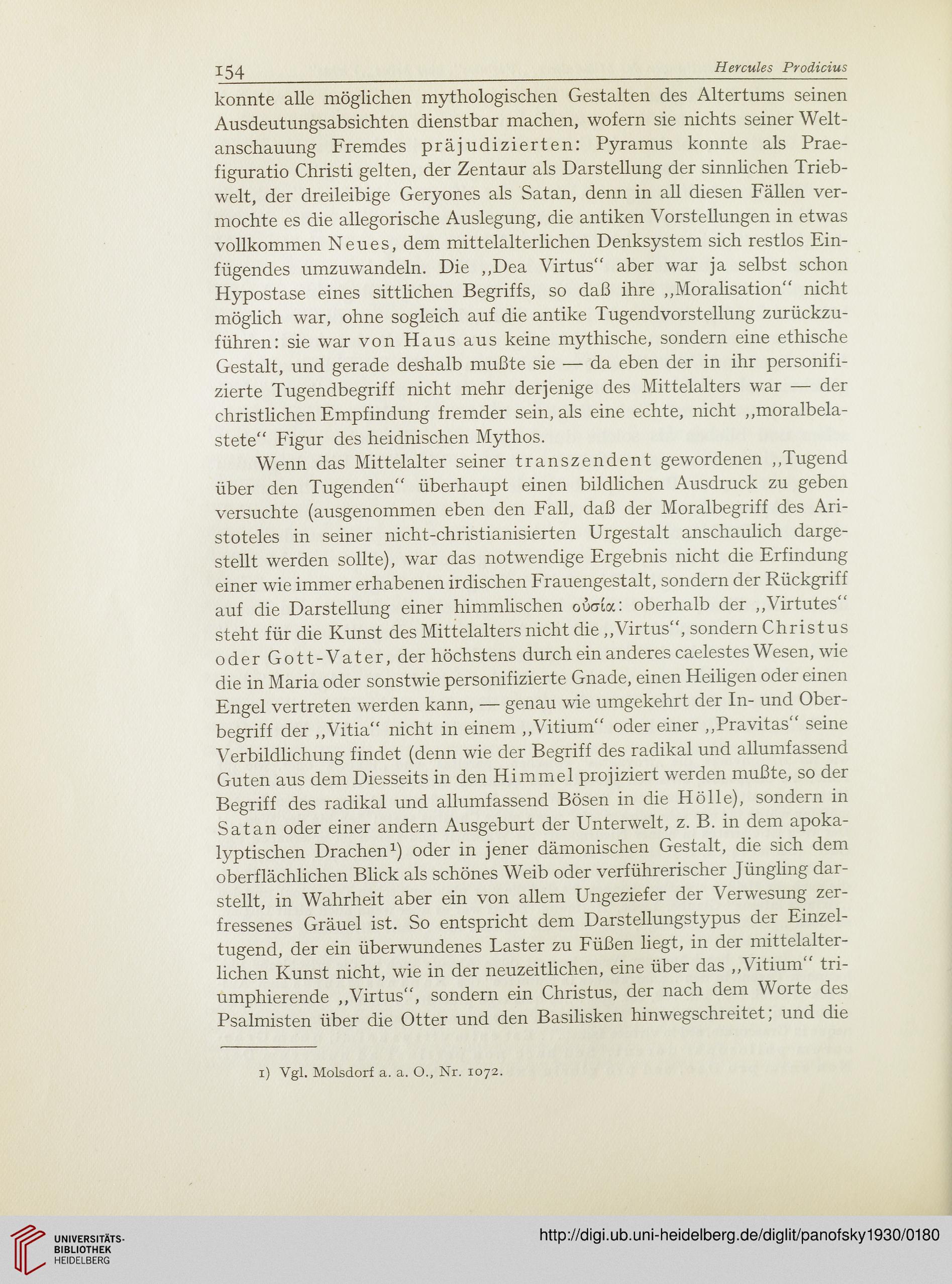154
Hercules Prodicius
konnte alle möglichen mythologischen Gestalten des Altertums seinen
Ausdeutungsabsichten dienstbar machen, wofern sie nichts seiner Welt-
anschauung Fremdes präjudizierten: Pyramus konnte als Prae-
figuratio Christi gelten, der Zentaur als Darstellung der sinnlichen Trieb-
welt, der dreileibige Geryones als Satan, denn in all diesen Fällen ver-
mochte es die allegorische Auslegung, die antiken Vorstellungen in etwas
vollkommen Neues, dem mittelalterlichen Denksystem sich restlos Ein-
fügendes umzuwandeln. Die ,,Dea Virtus“ aber war ja selbst schon
Hypostase eines sittlichen Begriffs, so daß ihre „Moralisation“ nicht
möglich war, ohne sogleich auf die antike Tugend Vorstellung zurückzu-
führen: sie war von Haus aus keine mythische, sondern eine ethische
Gestalt, und gerade deshalb mußte sie — da eben der in ihr personifi-
zierte Tugendbegriff nicht mehr derjenige des Mittelalters war — der
christlichen Empfindung fremder sein, als eine echte, nicht „moralbela-
stete“ Figur des heidnischen Mythos.
Wenn das Mittelalter seiner transzendent gewordenen „Tugend
über den Tugenden“ überhaupt einen bildlichen Ausdruck zu geben
versuchte (ausgenommen eben den Fall, daß der Moralbegriff des Ari-
stoteles in seiner nicht-christianisierten Urgestalt anschaulich darge-
stellt werden sollte), war das notwendige Ergebnis nicht die Erfindung
einer wie immer erhabenen irdischen Frauengestalt, sondern der Rückgriff
auf die Darstellung einer himmlischen oucna: oberhalb der „Virtutes“
steht für die Kunst des Mittelalters nicht die „Virtus“, sondern Christus
oder Gott-Vater, der höchstens durch ein anderes caelestes Wesen, wie
die in Maria oder sonstwie personifizierte Gnade, einen Heiligen oder einen
Engel vertreten werden kann, — genau wie umgekehrt der In- und Ober-
begriff der „Vitia“ nicht in einem „Vitium“ oder einer „Pravitas“ seine
Verbildlichung findet (denn wie der Begriff des radikal und allumfassend
Guten aus dem Diesseits in den Himmel projiziert werden mußte, so der
Begriff des radikal und allumfassend Bösen in die Hölle), sondern in
Satan oder einer andern Ausgeburt der Unterwelt, z. B. in dem apoka-
lyptischen Drachen1) oder in jener dämonischen Gestalt, die sich dem
oberflächlichen Blick als schönes Weib oder verführerischer Jüngling dar-
stellt, in Wahrheit aber ein von allem Ungeziefer der Verwesung zer-
fressenes Gräuel ist. So entspricht dem Darstellungstypus der Einzel-
tugend, der ein überwundenes Laster zu Füßen liegt, in der mittelalter-
lichen Kunst nicht, wie in der neuzeitlichen, eine über das „Vitium“ tri-
umphierende „Virtus“, sondern ein Christus, der nach dem Worte des
Psalmisten über die Otter und den Basilisken hinwegschreitet; und die
i) Vgl. Molsdorf a. a. O., Nr. 1072.
Hercules Prodicius
konnte alle möglichen mythologischen Gestalten des Altertums seinen
Ausdeutungsabsichten dienstbar machen, wofern sie nichts seiner Welt-
anschauung Fremdes präjudizierten: Pyramus konnte als Prae-
figuratio Christi gelten, der Zentaur als Darstellung der sinnlichen Trieb-
welt, der dreileibige Geryones als Satan, denn in all diesen Fällen ver-
mochte es die allegorische Auslegung, die antiken Vorstellungen in etwas
vollkommen Neues, dem mittelalterlichen Denksystem sich restlos Ein-
fügendes umzuwandeln. Die ,,Dea Virtus“ aber war ja selbst schon
Hypostase eines sittlichen Begriffs, so daß ihre „Moralisation“ nicht
möglich war, ohne sogleich auf die antike Tugend Vorstellung zurückzu-
führen: sie war von Haus aus keine mythische, sondern eine ethische
Gestalt, und gerade deshalb mußte sie — da eben der in ihr personifi-
zierte Tugendbegriff nicht mehr derjenige des Mittelalters war — der
christlichen Empfindung fremder sein, als eine echte, nicht „moralbela-
stete“ Figur des heidnischen Mythos.
Wenn das Mittelalter seiner transzendent gewordenen „Tugend
über den Tugenden“ überhaupt einen bildlichen Ausdruck zu geben
versuchte (ausgenommen eben den Fall, daß der Moralbegriff des Ari-
stoteles in seiner nicht-christianisierten Urgestalt anschaulich darge-
stellt werden sollte), war das notwendige Ergebnis nicht die Erfindung
einer wie immer erhabenen irdischen Frauengestalt, sondern der Rückgriff
auf die Darstellung einer himmlischen oucna: oberhalb der „Virtutes“
steht für die Kunst des Mittelalters nicht die „Virtus“, sondern Christus
oder Gott-Vater, der höchstens durch ein anderes caelestes Wesen, wie
die in Maria oder sonstwie personifizierte Gnade, einen Heiligen oder einen
Engel vertreten werden kann, — genau wie umgekehrt der In- und Ober-
begriff der „Vitia“ nicht in einem „Vitium“ oder einer „Pravitas“ seine
Verbildlichung findet (denn wie der Begriff des radikal und allumfassend
Guten aus dem Diesseits in den Himmel projiziert werden mußte, so der
Begriff des radikal und allumfassend Bösen in die Hölle), sondern in
Satan oder einer andern Ausgeburt der Unterwelt, z. B. in dem apoka-
lyptischen Drachen1) oder in jener dämonischen Gestalt, die sich dem
oberflächlichen Blick als schönes Weib oder verführerischer Jüngling dar-
stellt, in Wahrheit aber ein von allem Ungeziefer der Verwesung zer-
fressenes Gräuel ist. So entspricht dem Darstellungstypus der Einzel-
tugend, der ein überwundenes Laster zu Füßen liegt, in der mittelalter-
lichen Kunst nicht, wie in der neuzeitlichen, eine über das „Vitium“ tri-
umphierende „Virtus“, sondern ein Christus, der nach dem Worte des
Psalmisten über die Otter und den Basilisken hinwegschreitet; und die
i) Vgl. Molsdorf a. a. O., Nr. 1072.