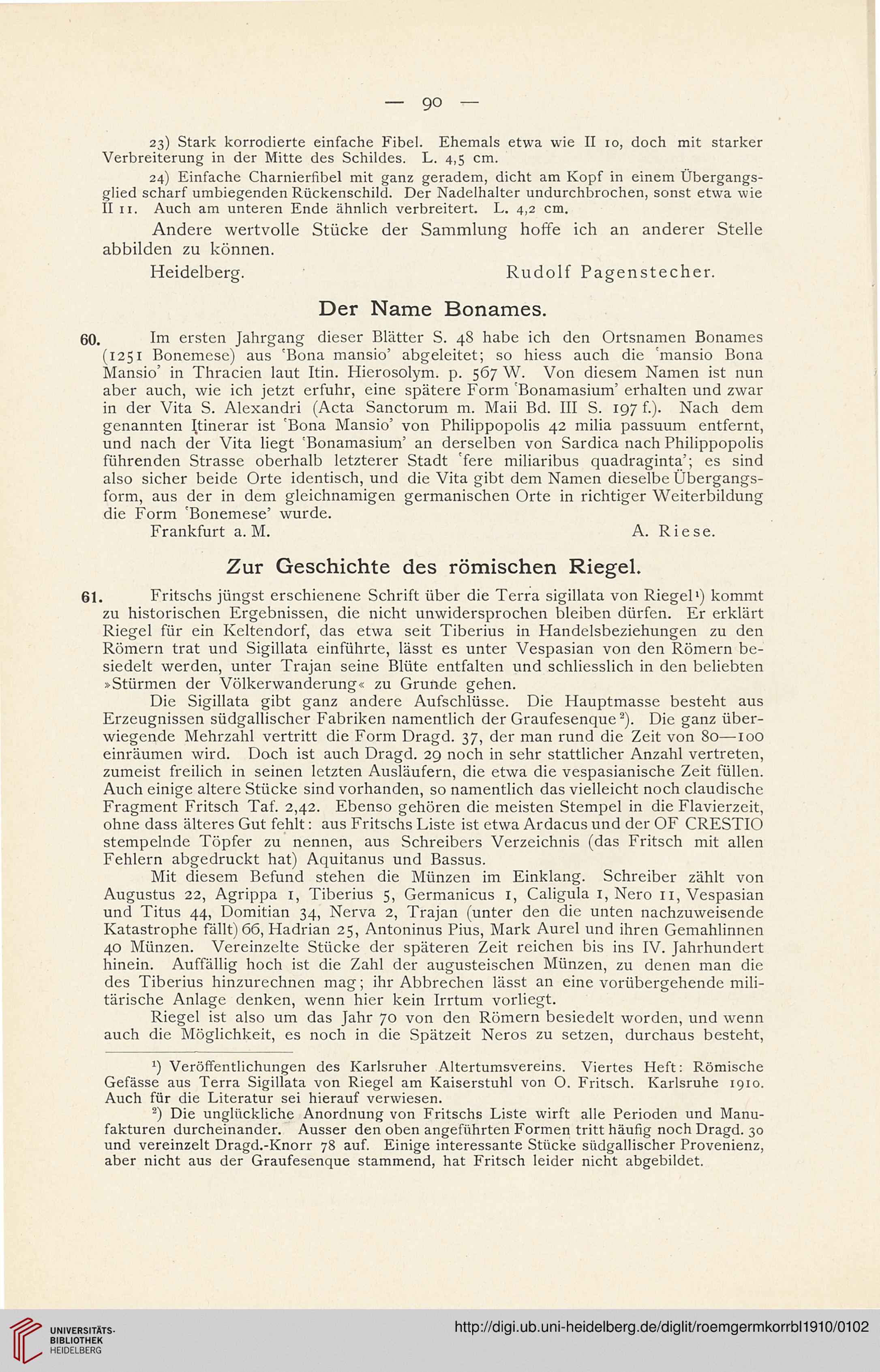go
23) Stark korrodierte einfache Fibel. Ehemals etwa wie II 10, doch mit starker
Verbreiterung in der Mitte des Schildes. L. 4,5 cm.
24) Einfache Charnierfibel mit ganz geradem, dicht am Kopf in einem Übergangs-
glied scharf umbiegenden Rückenschild. Der Nadelhalter undurchbrochen, sonst etwa wie
II 11. Auch am unteren Ende ähnlich verbreitert. L. 4,2 cm.
Andere wertvolle Stücke der Sammlung hoffe ich an anderer Stelle
abbilden zu können.
Heidelberg. Rudolf Pagenstecher.
Der Name Bonames.
60. Im ersten Jahrgang dieser Blätter S. 48 habe ich den Ortsnamen Bonames
(1251 Bonemese) aus 'Bona mansio’ abgeleitet; so hiess auch die 'mansio Bona
Mansio’ in Thracien laut Itin. Hierosolym. p. 567 W. Von diesem Namen ist nun
aber auch, wie ich jetzt erfuhr, eine spätere Form 'Bonamasium’ erhalten und zwar
in der Vita S. Alexandri (Acta Sanctorum m. Maii Bd. III S. 197 f.). Nach dem
genannten Jtinerar ist 'Bona Mansio’ von Philippopolis 42 milia passuum entfernt,
und nach der Vita liegt 'Bonamasium’ an derselben von Sardica nach Philippopolis
führenden Strasse oberhalb letzterer Stadt 'fere miliaribus quadraginta’; es sind
also sicher beide Orte identisch, und die Vita gibt dem Namen dieselbe Übergangs-
form, aus der in dem gleichnamigen germanischen Orte in richtiger Weiterbildung
die Form 'Bonemese’ wurde.
Frankfurt a. M. A. Riese.
Zur Geschichte des römischen Riegel.
61. Fritschs jüngst erschienene Schrift über die Terra sigillata von Riegel 1) kommt
zu historischen Ergebnissen, die nicht unwidersprochen bleiben dürfen. Er erklärt
Riegel für ein Keltendorf, das etwa seit Tiberius in Handelsbeziehungen zu den
Römern trat und Sigillata einführte, lässt es unter Vespasian von den Römern be-
siedelt werden, unter Trajan seine Blüte entfalten und schliesslich in den beliebten
»Stürmen der Völkerwanderung« zu Grunde gehen.
Die Sigillata gibt ganz andere Aufschlüsse. Die Hauptmasse besteht aus
Erzeugnissen südgallischer Fabriken namentlich der Graufesenque 2). Die ganz über-
wiegende Mehrzahl vertritt die Form Dragd. 37, der man rund die Zeit von 80—100
einräumen wird. Doch ist auch Dragd. 29 noch in sehr stattlicher Anzahl vertreten,
zumeist freilich in seinen letzten Ausläufern, die etwa die vespasianische Zeit füllen.
Auch einige altere Stücke sind vorhanden, so namentlich das vielleicht noch claudische
Fragment Fritsch Taf. 2,42. Ebenso gehören die meisten Stempel in die Flavierzeit,
ohne dass älteres Gut fehlt: aus Fritschs Liste ist etwa Ardacus und der OF CRESTIO
stempelnde Töpfer zu nennen, aus Schreibers Verzeichnis (das Fritsch mit allen
Fehlern abgedruckt hat) Aquitanus und Bassus.
Mit diesem Befund stehen die Münzen im Einklang. Schreiber zählt von
Augustus 22, Agrippa 1, Tiberius 5, Germanicus I, Caligula 1, Nero 11, Vespasian
und Titus 44, Domitian 34, Nerva 2, Trajan (unter den die unten nachzuweisende
Katastrophe fällt) 66, Hadrian 25, Antoninus Pius, Mark Aurel und ihren Gemahlinnen
40 Münzen. Vereinzelte Stücke der späteren Zeit reichen bis ins IV. Jahrhundert
hinein. Auffällig hoch ist die Zahl der augusteischen Münzen, zu denen man die
des Tiberius hinzurechnen mag; ihr Abbrechen lässt an eine vorübergehende mili-
tärische Anlage denken, wenn hier kein Irrtum vorliegt.
Riegel ist also um das Jahr 70 von den Römern besiedelt worden, und wenn
auch die Möglichkeit, es noch in die Spätzeit Neros zu setzen, durchaus besteht,
') Veröffentlichungen des Karlsruher Altertumsvereins. Viertes Heft: Römische
Gefässe aus Terra Sigillata von Riegel am Kaiserstuhl von O. Fritsch. Karlsruhe 1910.
Auch für die Literatur sei hierauf verwiesen.
2) Die ungltickliche Anordnung von Fritschs Liste wirft alle Perioden und Manu-
fakturen durcheinander. Ausser den oben angeführten Formen tritt häufig noch Dragd. 30
und vereinzelt Dragd.-Knorr 78 auf. Einige interessante Stücke südgallischer Provenienz,
aber nicht aus der Graufesenque stammend, hat Fritsch leider nicht abgebildet.
23) Stark korrodierte einfache Fibel. Ehemals etwa wie II 10, doch mit starker
Verbreiterung in der Mitte des Schildes. L. 4,5 cm.
24) Einfache Charnierfibel mit ganz geradem, dicht am Kopf in einem Übergangs-
glied scharf umbiegenden Rückenschild. Der Nadelhalter undurchbrochen, sonst etwa wie
II 11. Auch am unteren Ende ähnlich verbreitert. L. 4,2 cm.
Andere wertvolle Stücke der Sammlung hoffe ich an anderer Stelle
abbilden zu können.
Heidelberg. Rudolf Pagenstecher.
Der Name Bonames.
60. Im ersten Jahrgang dieser Blätter S. 48 habe ich den Ortsnamen Bonames
(1251 Bonemese) aus 'Bona mansio’ abgeleitet; so hiess auch die 'mansio Bona
Mansio’ in Thracien laut Itin. Hierosolym. p. 567 W. Von diesem Namen ist nun
aber auch, wie ich jetzt erfuhr, eine spätere Form 'Bonamasium’ erhalten und zwar
in der Vita S. Alexandri (Acta Sanctorum m. Maii Bd. III S. 197 f.). Nach dem
genannten Jtinerar ist 'Bona Mansio’ von Philippopolis 42 milia passuum entfernt,
und nach der Vita liegt 'Bonamasium’ an derselben von Sardica nach Philippopolis
führenden Strasse oberhalb letzterer Stadt 'fere miliaribus quadraginta’; es sind
also sicher beide Orte identisch, und die Vita gibt dem Namen dieselbe Übergangs-
form, aus der in dem gleichnamigen germanischen Orte in richtiger Weiterbildung
die Form 'Bonemese’ wurde.
Frankfurt a. M. A. Riese.
Zur Geschichte des römischen Riegel.
61. Fritschs jüngst erschienene Schrift über die Terra sigillata von Riegel 1) kommt
zu historischen Ergebnissen, die nicht unwidersprochen bleiben dürfen. Er erklärt
Riegel für ein Keltendorf, das etwa seit Tiberius in Handelsbeziehungen zu den
Römern trat und Sigillata einführte, lässt es unter Vespasian von den Römern be-
siedelt werden, unter Trajan seine Blüte entfalten und schliesslich in den beliebten
»Stürmen der Völkerwanderung« zu Grunde gehen.
Die Sigillata gibt ganz andere Aufschlüsse. Die Hauptmasse besteht aus
Erzeugnissen südgallischer Fabriken namentlich der Graufesenque 2). Die ganz über-
wiegende Mehrzahl vertritt die Form Dragd. 37, der man rund die Zeit von 80—100
einräumen wird. Doch ist auch Dragd. 29 noch in sehr stattlicher Anzahl vertreten,
zumeist freilich in seinen letzten Ausläufern, die etwa die vespasianische Zeit füllen.
Auch einige altere Stücke sind vorhanden, so namentlich das vielleicht noch claudische
Fragment Fritsch Taf. 2,42. Ebenso gehören die meisten Stempel in die Flavierzeit,
ohne dass älteres Gut fehlt: aus Fritschs Liste ist etwa Ardacus und der OF CRESTIO
stempelnde Töpfer zu nennen, aus Schreibers Verzeichnis (das Fritsch mit allen
Fehlern abgedruckt hat) Aquitanus und Bassus.
Mit diesem Befund stehen die Münzen im Einklang. Schreiber zählt von
Augustus 22, Agrippa 1, Tiberius 5, Germanicus I, Caligula 1, Nero 11, Vespasian
und Titus 44, Domitian 34, Nerva 2, Trajan (unter den die unten nachzuweisende
Katastrophe fällt) 66, Hadrian 25, Antoninus Pius, Mark Aurel und ihren Gemahlinnen
40 Münzen. Vereinzelte Stücke der späteren Zeit reichen bis ins IV. Jahrhundert
hinein. Auffällig hoch ist die Zahl der augusteischen Münzen, zu denen man die
des Tiberius hinzurechnen mag; ihr Abbrechen lässt an eine vorübergehende mili-
tärische Anlage denken, wenn hier kein Irrtum vorliegt.
Riegel ist also um das Jahr 70 von den Römern besiedelt worden, und wenn
auch die Möglichkeit, es noch in die Spätzeit Neros zu setzen, durchaus besteht,
') Veröffentlichungen des Karlsruher Altertumsvereins. Viertes Heft: Römische
Gefässe aus Terra Sigillata von Riegel am Kaiserstuhl von O. Fritsch. Karlsruhe 1910.
Auch für die Literatur sei hierauf verwiesen.
2) Die ungltickliche Anordnung von Fritschs Liste wirft alle Perioden und Manu-
fakturen durcheinander. Ausser den oben angeführten Formen tritt häufig noch Dragd. 30
und vereinzelt Dragd.-Knorr 78 auf. Einige interessante Stücke südgallischer Provenienz,
aber nicht aus der Graufesenque stammend, hat Fritsch leider nicht abgebildet.