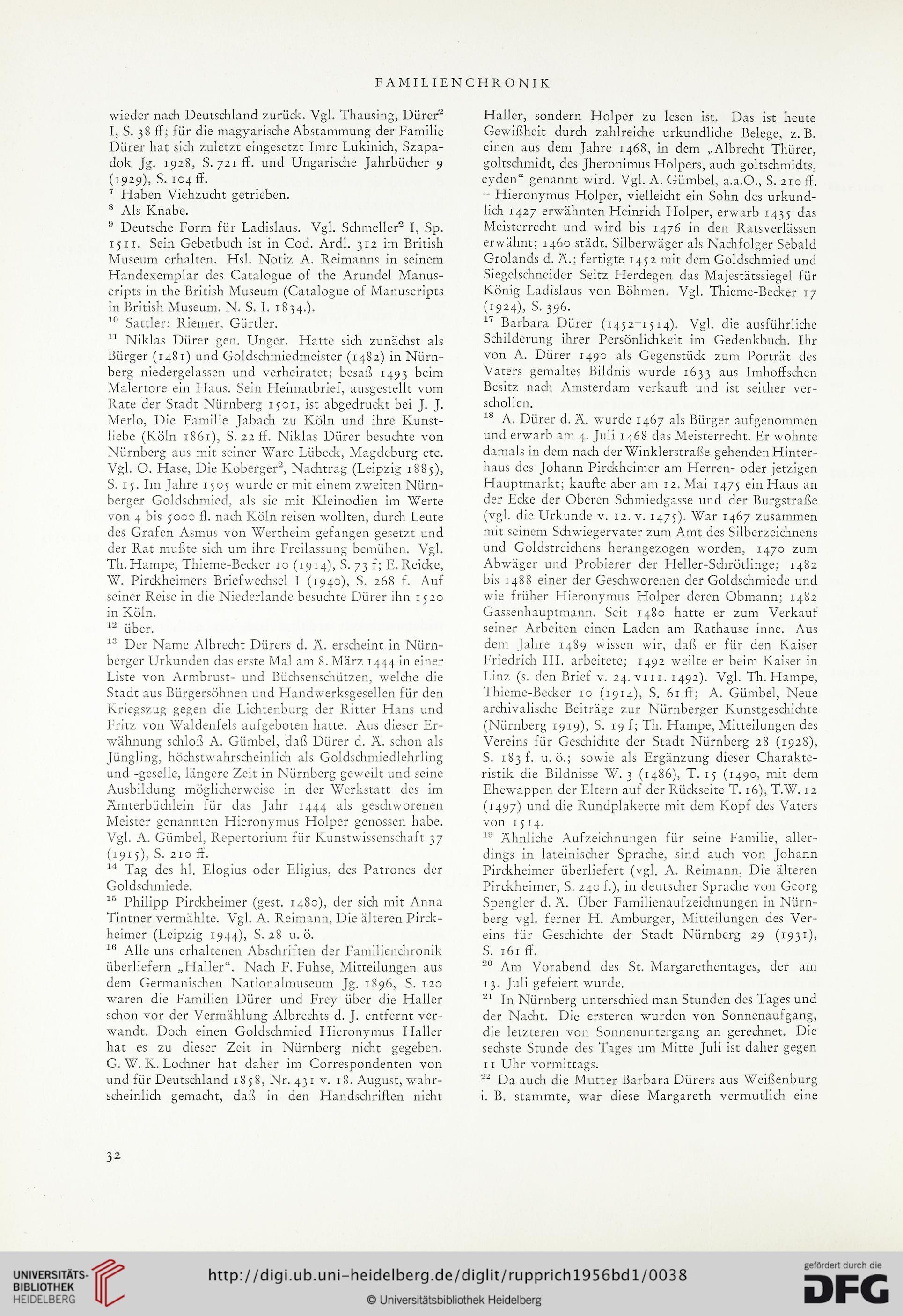FAMILIENCHRONIK
wieder nach Deutschland zurück. Vgl. Thausing, Dürer2
I, S. 38 ff; für die magyarische Abstammung der Familie
Dürer hat sich zuletzt eingesetzt Imre Lukinich, Szapa-
dok Jg. 1928, S. 721 ff. und Ungarische Jahrbücher 9
(1929), S. 104 ff.
7 Flaben Viehzucht getrieben.
8 Als Knabe.
9 Deutsche Form für Ladislaus. Vgl. Schmeller2 I, Sp.
1511. Sein Gebetbuch ist in Cod. Ardl. 312 im British
Museum erhalten. Hsl. Notiz A. Reimanns in seinem
Handexemplar des Catalogue of the Arundel Manus-
cripts in the British Museum (Catalogue of Manuscripts
in British Museum. N. S. I. 1834.).
10 Sattler; Riemer, Gürtler.
11 Niklas Dürer gen. Unger. Hatte sich zunächst als
Bürger (1481) und Goldschmiedmeister (1482) in Nürn-
berg niedergelassen und verheiratet; besaß 1493 beim
Malertore ein Haus. Sein Heimatbrief, ausgestellt vom
Rate der Stadt Nürnberg 1501, ist abgedruckt bei J. J.
Merlo, Die Familie Jabach zu Köln und ihre Kunst-
liebe (Köln 1861), S. 22 ff. Niklas Dürer besuchte von
Nürnberg aus mit seiner Ware Lübeck, Magdeburg etc.
Vgl. O. Hase, Die Koberger2, Nachtrag (Leipzig 1885),
S. 15. Im Jahre 1505 wurde er mit einem zweiten Nürn-
berger Goldschmied, als sie mit Kleinodien im Werte
von 4 bis 5000 fl. nach Köln reisen wollten, durch Leute
des Grafen Asmus von Wertheim gefangen gesetzt und
der Rat mußte sich um ihre Freilassung bemühen. Vgl.
Th. Hampe, Thieme-Becker 10 (1914), S. 73 f; E. Reicke,
W. Pirckheimers Briefwechsel I (1940), S. 268 f. Auf
seiner Reise in die Niederlande besuchte Dürer ihn 1520
in Köln.
12 über.
13 Der Name Albrecht Dürers d. Ä. erscheint in Nürn-
berger Urkunden das erste Mal am 8. März 1444 in einer
Liste von Armbrust- und Büchsenschützen, welche die
Stadt aus Bürgersöhnen und Handwerksgesellen für den
Kriegszug gegen die Lichtenburg der Ritter Hans und
Fritz von Waldenfels aufgeboten hatte. Aus dieser Er-
wähnung schloß A. Gümbel, daß Dürer d. Ä. schon als
Jüngling, höchstwahrscheinlich als Goldschmiedlehrling
und -geselle, längere Zeit in Nürnberg geweilt und seine
Ausbildung möglicherweise in der Werkstatt des im
Ämterbüchlein für das Jahr 1444 als geschworenen
Meister genannten Hieronymus Holper genossen habe.
Vgl. A. Gümbel, Repertorium für Kunstwissenschaft 37
(1915), S. 210 ff.
14 Tag des hl. Elogius oder Eligius, des Patrones der
Goldschmiede.
15 Philipp Pirckheimer (gest. 1480), der sich mit Anna
Tintner vermählte. Vgl. A. Reimann, Die älteren Pirck-
heimer (Leipzig 1944), S. 28 u. ö.
16 Alle uns erhaltenen Abschriften der Familienchronik
überliefern „Haller“. Nach F. Fuhse, Mitteilungen aus
dem Germanischen Nationalmuseum Jg. 1896, S. 120
waren die Familien Dürer und Frey über die Haller
schon vor der Vermählung Albrechts d. J. entfernt ver-
wandt. Doch einen Goldschmied Hieronymus Haller
hat es zu dieser Zeit in Nürnberg nicht gegeben.
G. W. K. Lochner hat daher im Correspondenten von
und für Deutschland 1858, Nr. 431 v. 18. August, wahr-
scheinlich gemacht, daß in den Handschriften nicht
Haller, sondern Holper zu lesen ist. Das ist heute
Gewißheit durch zahlreiche urkundliche Belege, z. B.
einen aus dem Jahre 1468, in dem „Albrecht Thürer,
goltschmidt, des Jheronimus Holpers, auch goltschmidts,
eyden“ genannt wird. Vgl. A. Gümbel, a.a.O., S. 210 ff.
- Hieronymus Holper, vielleicht ein Sohn des urkund-
lich 1427 erwähnten Heinrich Holper, erwarb 1435 das
Meisterrecht und wird bis 1476 in den Ratsverlässen
erwähnt; 1460 städt. Silberwäger als Nachfolger Sebald
Grolands d. Ä.; fertigte 1452 mit dem Goldschmied und
Siegelschneider Seitz Herdegen das Majestätssiegel für
König Ladislaus von Böhmen. Vgl. Thieme-Becker 17
(1924), S. 396.
17 Barbara Dürer (1452-1514). Vgl. die ausführliche
Schilderung ihrer Persönlichkeit im Gedenkbuch. Ihr
von A. Dürer 1490 als Gegenstück zum Porträt des
Vaters gemaltes Bildnis wurde 1633 aus Imhoffschen
Besitz nach Amsterdam verkauft und ist seither ver-
schollen.
18 A. Dürer d. Ä. wurde 1467 als Bürger aufgenommen
und erwarb am 4. Juli 1468 das Meisterrecht. Er wohnte
damals in dem nach der Winklerstraße gehenden Hinter-
haus des Johann Pirckheimer am Herren- oder jetzigen
Hauptmarkt; kaufte aber am 12. Mai 1475 ein Haus an
der Ecke der Oberen Schmiedgasse und der Burgstraße
(vgl. die Urkunde v. 12. v. 1475). War 1467 zusammen
mit seinem Schwiegervater zum Amt des Silberzeichnens
und Goldstreichens herangezogen worden, 1470 zum
Abwäger und Probierer der Heller-Schrötlinge; 1482
bis 1488 einer der Geschworenen der Goldschmiede und
wie früher Hieronymus Holper deren Obmann; 1482
Gassenhauptmann. Seit 1480 hatte er zum Verkauf
seiner Arbeiten einen Laden am Rathause inne. Aus
dem Jahre 1489 wissen wir, daß er für den Kaiser
Friedrich III. arbeitete; 1492 weilte er beim Kaiser in
Linz (s. den Brief v. 24. vm. 1492). Vgl. Th. Hampe,
Thieme-Becker 10 (1914), S. 61 ff; A. Gümbel, Neue
archivalische Beiträge zur Nürnberger Kunstgeschichte
(Nürnberg 1919), S. 19 f; Th. Hampe, Mitteilungen des
Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 28 (1928),
S. 183 f. u. ö.; sowie als Ergänzung dieser Charakte-
ristik die Bildnisse W. 3 (i486), T. 15 (1490, mit dem
Ehewappen der Eltern auf der Rückseite T. 16), T.W. 12
(1497) und die Rundplakette mit dem Kopf des Vaters
von 1514.
19 Ähnliche Aufzeichnungen für seine Familie, aller-
dings in lateinischer Sprache, sind auch von Johann
Pirckheimer überliefert (vgl. A. Reimann, Die älteren
Pirckheimer, S. 240 f.), in deutscher Sprache von Georg
Spengler d. Ä. Über Familienaufzeichnungen in Nürn-
berg vgl. ferner H. Amburger, Mitteilungen des Ver-
eins für Geschichte der Stadt Nürnberg 29 (1931),
S. 161 ff.
20 Am Vorabend des St. Margarethentages, der am
13. Juli gefeiert wurde.
21 In Nürnberg unterschied man Stunden des Tages und
der Nacht. Die ersteren wurden von Sonnenaufgang,
die letzteren von Sonnenuntergang an gerechnet. Die
sechste Stunde des Tages um Mitte Juli ist daher gegen
11 Uhr vormittags.
22 Da auch die Mutter Barbara Dürers aus Weißenburg
i. B. stammte, war diese Margareth vermutlich eine
32
wieder nach Deutschland zurück. Vgl. Thausing, Dürer2
I, S. 38 ff; für die magyarische Abstammung der Familie
Dürer hat sich zuletzt eingesetzt Imre Lukinich, Szapa-
dok Jg. 1928, S. 721 ff. und Ungarische Jahrbücher 9
(1929), S. 104 ff.
7 Flaben Viehzucht getrieben.
8 Als Knabe.
9 Deutsche Form für Ladislaus. Vgl. Schmeller2 I, Sp.
1511. Sein Gebetbuch ist in Cod. Ardl. 312 im British
Museum erhalten. Hsl. Notiz A. Reimanns in seinem
Handexemplar des Catalogue of the Arundel Manus-
cripts in the British Museum (Catalogue of Manuscripts
in British Museum. N. S. I. 1834.).
10 Sattler; Riemer, Gürtler.
11 Niklas Dürer gen. Unger. Hatte sich zunächst als
Bürger (1481) und Goldschmiedmeister (1482) in Nürn-
berg niedergelassen und verheiratet; besaß 1493 beim
Malertore ein Haus. Sein Heimatbrief, ausgestellt vom
Rate der Stadt Nürnberg 1501, ist abgedruckt bei J. J.
Merlo, Die Familie Jabach zu Köln und ihre Kunst-
liebe (Köln 1861), S. 22 ff. Niklas Dürer besuchte von
Nürnberg aus mit seiner Ware Lübeck, Magdeburg etc.
Vgl. O. Hase, Die Koberger2, Nachtrag (Leipzig 1885),
S. 15. Im Jahre 1505 wurde er mit einem zweiten Nürn-
berger Goldschmied, als sie mit Kleinodien im Werte
von 4 bis 5000 fl. nach Köln reisen wollten, durch Leute
des Grafen Asmus von Wertheim gefangen gesetzt und
der Rat mußte sich um ihre Freilassung bemühen. Vgl.
Th. Hampe, Thieme-Becker 10 (1914), S. 73 f; E. Reicke,
W. Pirckheimers Briefwechsel I (1940), S. 268 f. Auf
seiner Reise in die Niederlande besuchte Dürer ihn 1520
in Köln.
12 über.
13 Der Name Albrecht Dürers d. Ä. erscheint in Nürn-
berger Urkunden das erste Mal am 8. März 1444 in einer
Liste von Armbrust- und Büchsenschützen, welche die
Stadt aus Bürgersöhnen und Handwerksgesellen für den
Kriegszug gegen die Lichtenburg der Ritter Hans und
Fritz von Waldenfels aufgeboten hatte. Aus dieser Er-
wähnung schloß A. Gümbel, daß Dürer d. Ä. schon als
Jüngling, höchstwahrscheinlich als Goldschmiedlehrling
und -geselle, längere Zeit in Nürnberg geweilt und seine
Ausbildung möglicherweise in der Werkstatt des im
Ämterbüchlein für das Jahr 1444 als geschworenen
Meister genannten Hieronymus Holper genossen habe.
Vgl. A. Gümbel, Repertorium für Kunstwissenschaft 37
(1915), S. 210 ff.
14 Tag des hl. Elogius oder Eligius, des Patrones der
Goldschmiede.
15 Philipp Pirckheimer (gest. 1480), der sich mit Anna
Tintner vermählte. Vgl. A. Reimann, Die älteren Pirck-
heimer (Leipzig 1944), S. 28 u. ö.
16 Alle uns erhaltenen Abschriften der Familienchronik
überliefern „Haller“. Nach F. Fuhse, Mitteilungen aus
dem Germanischen Nationalmuseum Jg. 1896, S. 120
waren die Familien Dürer und Frey über die Haller
schon vor der Vermählung Albrechts d. J. entfernt ver-
wandt. Doch einen Goldschmied Hieronymus Haller
hat es zu dieser Zeit in Nürnberg nicht gegeben.
G. W. K. Lochner hat daher im Correspondenten von
und für Deutschland 1858, Nr. 431 v. 18. August, wahr-
scheinlich gemacht, daß in den Handschriften nicht
Haller, sondern Holper zu lesen ist. Das ist heute
Gewißheit durch zahlreiche urkundliche Belege, z. B.
einen aus dem Jahre 1468, in dem „Albrecht Thürer,
goltschmidt, des Jheronimus Holpers, auch goltschmidts,
eyden“ genannt wird. Vgl. A. Gümbel, a.a.O., S. 210 ff.
- Hieronymus Holper, vielleicht ein Sohn des urkund-
lich 1427 erwähnten Heinrich Holper, erwarb 1435 das
Meisterrecht und wird bis 1476 in den Ratsverlässen
erwähnt; 1460 städt. Silberwäger als Nachfolger Sebald
Grolands d. Ä.; fertigte 1452 mit dem Goldschmied und
Siegelschneider Seitz Herdegen das Majestätssiegel für
König Ladislaus von Böhmen. Vgl. Thieme-Becker 17
(1924), S. 396.
17 Barbara Dürer (1452-1514). Vgl. die ausführliche
Schilderung ihrer Persönlichkeit im Gedenkbuch. Ihr
von A. Dürer 1490 als Gegenstück zum Porträt des
Vaters gemaltes Bildnis wurde 1633 aus Imhoffschen
Besitz nach Amsterdam verkauft und ist seither ver-
schollen.
18 A. Dürer d. Ä. wurde 1467 als Bürger aufgenommen
und erwarb am 4. Juli 1468 das Meisterrecht. Er wohnte
damals in dem nach der Winklerstraße gehenden Hinter-
haus des Johann Pirckheimer am Herren- oder jetzigen
Hauptmarkt; kaufte aber am 12. Mai 1475 ein Haus an
der Ecke der Oberen Schmiedgasse und der Burgstraße
(vgl. die Urkunde v. 12. v. 1475). War 1467 zusammen
mit seinem Schwiegervater zum Amt des Silberzeichnens
und Goldstreichens herangezogen worden, 1470 zum
Abwäger und Probierer der Heller-Schrötlinge; 1482
bis 1488 einer der Geschworenen der Goldschmiede und
wie früher Hieronymus Holper deren Obmann; 1482
Gassenhauptmann. Seit 1480 hatte er zum Verkauf
seiner Arbeiten einen Laden am Rathause inne. Aus
dem Jahre 1489 wissen wir, daß er für den Kaiser
Friedrich III. arbeitete; 1492 weilte er beim Kaiser in
Linz (s. den Brief v. 24. vm. 1492). Vgl. Th. Hampe,
Thieme-Becker 10 (1914), S. 61 ff; A. Gümbel, Neue
archivalische Beiträge zur Nürnberger Kunstgeschichte
(Nürnberg 1919), S. 19 f; Th. Hampe, Mitteilungen des
Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 28 (1928),
S. 183 f. u. ö.; sowie als Ergänzung dieser Charakte-
ristik die Bildnisse W. 3 (i486), T. 15 (1490, mit dem
Ehewappen der Eltern auf der Rückseite T. 16), T.W. 12
(1497) und die Rundplakette mit dem Kopf des Vaters
von 1514.
19 Ähnliche Aufzeichnungen für seine Familie, aller-
dings in lateinischer Sprache, sind auch von Johann
Pirckheimer überliefert (vgl. A. Reimann, Die älteren
Pirckheimer, S. 240 f.), in deutscher Sprache von Georg
Spengler d. Ä. Über Familienaufzeichnungen in Nürn-
berg vgl. ferner H. Amburger, Mitteilungen des Ver-
eins für Geschichte der Stadt Nürnberg 29 (1931),
S. 161 ff.
20 Am Vorabend des St. Margarethentages, der am
13. Juli gefeiert wurde.
21 In Nürnberg unterschied man Stunden des Tages und
der Nacht. Die ersteren wurden von Sonnenaufgang,
die letzteren von Sonnenuntergang an gerechnet. Die
sechste Stunde des Tages um Mitte Juli ist daher gegen
11 Uhr vormittags.
22 Da auch die Mutter Barbara Dürers aus Weißenburg
i. B. stammte, war diese Margareth vermutlich eine
32