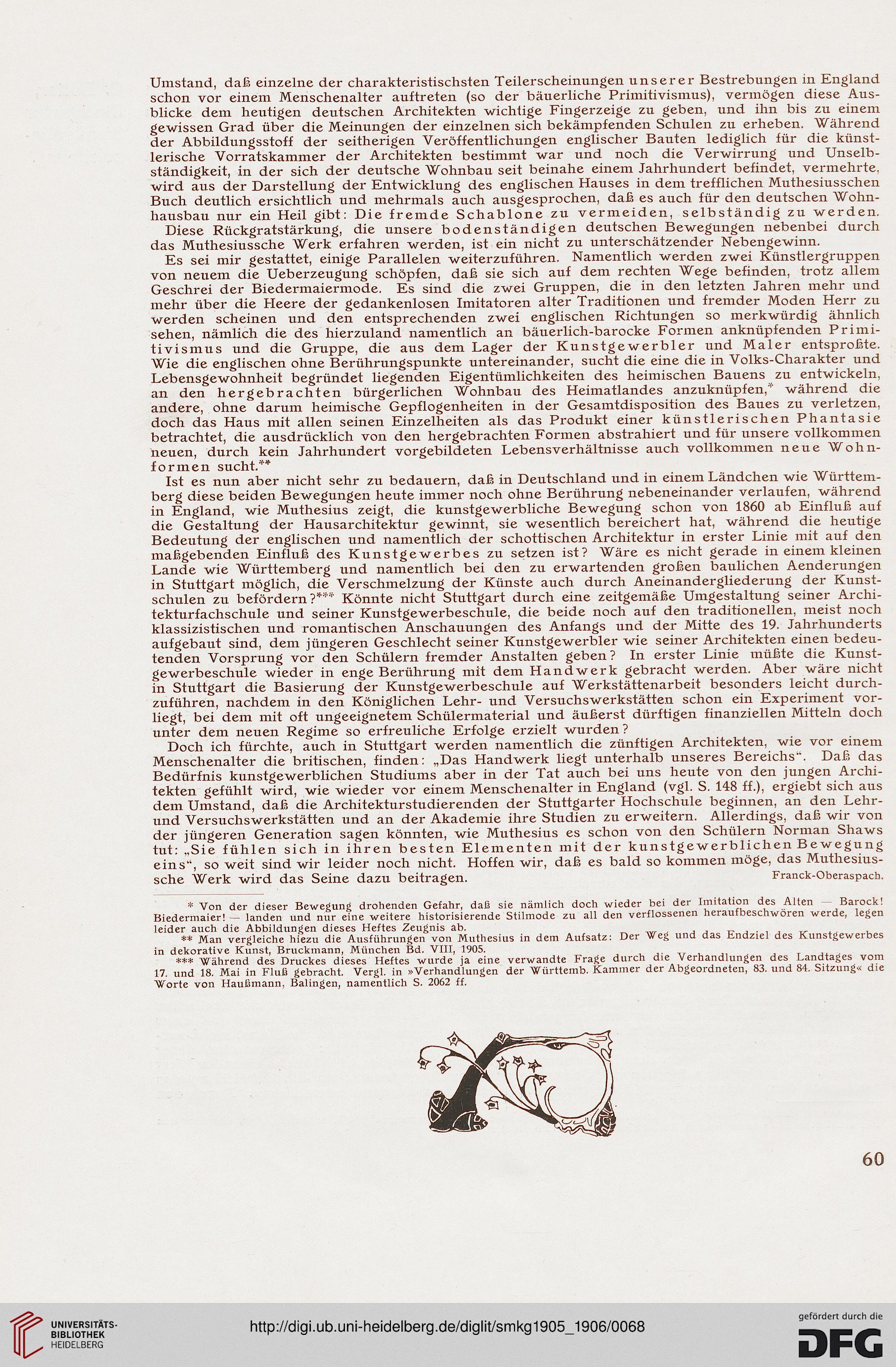Umstand, daß einzelne der charakteristischsten Teilerscheinungen unserer Bestrebungen in England
schon vor einem Menschenalter auftreten (so der bäuerliche Primitivismus), vermögen diese Aus-
blicke dem heutigen deutschen Architekten wichtige Fingerzeige zu geben, und ihn bis zu einem
gewissen Grad über die Meinungen der einzelnen sich bekämpfenden Schulen zu erheben. Während
der Abbildungsstoff der seitherigen Veröffentlichungen englischer Bauten lediglich für die künst-
lerische Vorratskammer der Architekten bestimmt war und noch die Verwirrung und Unselb-
ständigkeit, in der sich der deutsche Wohnbau seit beinahe einem Jahrhundert befindet, vermehrte,
wird aus der Darstellung der Entwicklung des englischen Hauses in dem trefflichen Muthesiusschen
Buch deutlich ersichtlich und mehrmals auch ausgesprochen, daß es auch für den deutschen Wohn-
hausbau nur ein Heil gibt: Die fremde Schablone zu vermeiden, selbständig zu werden.
Diese Rückgratstärkung, die unsere bodenständigen deutschen Bewegungen nebenbei durch
das Muthesiussche Werk erfahren werden, ist ein nicht zu unterschätzender Nebengewinn.
Es sei mir gestattet, einige Parallelen weiterzuführen. Namentlich werden zwei Künstlergruppen
von neuem die Ueberzeugung schöpfen, daß sie sich auf dem rechten Wege befinden, trotz allem
Geschrei der Biedermaiermode. Es sind die zwei Gruppen, die in den letzten Jahren mehr und
mehr über die Heere der gedankenlosen Imitatoren alter Traditionen und fremder Moden Herr zu
werden scheinen und den entsprechenden zwei englischen Richtungen so merkwürdig ähnlich
sehen, nämlich die des hierzuland namentlich an bäuerlich-barocke Formen anknüpfenden Primi-
tivismus und die Gruppe, die aus dem Lager der Kunstgewerbler und Maler entsproßte.
Wie die englischen ohne Berührungspunkte untereinander, sucht die eine die in Volks-Charakter und
Lebensgewohnheit begründet liegenden Eigentümlichkeiten des heimischen Bauens zu entwickeln,
an den hergebrachten bürgerlichen Wohnbau des Heimatlandes anzuknüpfen,* während die
andere, ohne darum heimische Gepflogenheiten in der Gesamtdisposition des Baues zu verletzen,
doch das Haus mit allen seinen Einzelheiten als das Produkt einer künstlerischen Phantasie
betrachtet, die ausdrücklich von den hergebrachten Formen abstrahiert und für unsere vollkommen
neuen, durch kein Jahrhundert vorgebildeten Lebensverhältnisse auch vollkommen neue Wohn-
formen sucht.**
Ist es nun aber nicht sehr zu bedauern, daß in Deutschland und in einem Ländchen wie Württem-
berg diese beiden Bewegungen heute immer noch ohne Berührung nebeneinander verlaufen, während
in England, wie Muthesius zeigt, die kunstgewerbliche Bewegung schon von 1860 ab Einfluß auf
die Gestaltung der Hausarchitektur gewinnt, sie wesentlich bereichert hat, während die heutige
Bedeutung der englischen und namentlich der schottischen Architektur in erster Linie mit auf den
maßgebenden Einfluß des Kunstgewerbes zu setzen ist? Wäre es nicht gerade in einem kleinen
Lande wie Württemberg und namentlich bei den zu erwartenden großen baulichen Aenderungen
in Stuttgart möglich, die Verschmelzung der Künste auch durch Aneinandergliederung der Kunst-
schulen zu befördern?*'* Könnte nicht Stuttgart durch eine zeitgemäße Umgestaltung seiner Archi-
tekturfachschule und seiner Kunstgewerbeschule, die beide noch auf den traditionellen, meist noch
klassizistischen und romantischen Anschauungen des Anfangs und der Mitte des 19. Jahrhunderts
aufgebaut sind, dem jüngeren Geschlecht seiner Kunstgewerbler wie seiner Architekten einen bedeu-
tenden Vorsprung vor den Schülern fremder Anstalten geben ? In erster Linie müßte die Kunst-
gewerbeschule wieder in enge Berührung mit dem Handwerk gebracht werden. Aber wäre nicht
in Stuttgart die Basierung der Kunstgewerbeschule auf Werkstättenarbeit besonders leicht durch-
zuführen, nachdem in den Königlichen Lehr- und Versuchswerkstätten schon ein Experiment vor-
liegt, bei dem mit oft ungeeignetem Schülermaterial und äußerst dürftigen finanziellen Mitteln doch
unter dem neuen Regime so erfreuliche Erfolge erzielt wurden ?
Doch ich fürchte, auch in Stuttgart werden namentlich die zünftigen Architekten, wie vor einem
Menschenalter die britischen, finden: „Das Handwerk liegt unterhalb unseres Bereichs". Daß das
Bedürfnis kunstgewerblichen Studiums aber in der Tat auch bei uns heute von den jungen Archi-
tekten gefühlt wird, wie wieder vor einem Menschenalter in England (vgl. S. 148 ff.), ergiebt sich aus
dem Umstand, daß die Architekturstudierenden der Stuttgarter Hochschule beginnen, an den Lehr-
und Versuchswerkstätten und an der Akademie ihre Studien zu erweitern. Allerdings, daß wir von
der jüngeren Generation sagen könnten, wie Muthesius es schon von den Schülern Norman Shaws
tut: „Sie fühlen sich in ihren besten Elementen mit der kunstgewerblichen Bewegung
eins", so weit sind wir leider noch nicht. Hoffen wir, daß es bald so kommen möge, das Muthesius-
sche Werk wird das Seine dazu beitragen. Franck-Oberaspach.
* Von der dieser Bewegung drohenden Gefahr, daß sie nämlich doch wieder bei der Imitation des Alten - Barock!
Biedermaier! — landen und nur eine weitere historisierende Stilmode zu all den verflossenen heraufbeschwören werde, legen
leider auch die Abbildungen dieses Heftes Zeugnis ab.
** Man vergleiche hiezu die Ausführungen von Muthesius in dem Aufsatz: Der "Weg und das Endziel des Kunstgewerbes
in dekorative Kunst, Bruckmann, München Bd. VIII, 1905.
*** "Während des Druckes dieses Heftes wurde ja eine verwandte Frage durch die Verhandlungen des Landtages vom
17. und 18. Mai in Fluß gebracht. Vergl. in »Verhandlungen der "Wurttemb. Kammer der Abgeordneten, 83. und 84. Sitzung« die
Worte von Haußmann. Balingen, namentlich S. 2062 ff.
60
schon vor einem Menschenalter auftreten (so der bäuerliche Primitivismus), vermögen diese Aus-
blicke dem heutigen deutschen Architekten wichtige Fingerzeige zu geben, und ihn bis zu einem
gewissen Grad über die Meinungen der einzelnen sich bekämpfenden Schulen zu erheben. Während
der Abbildungsstoff der seitherigen Veröffentlichungen englischer Bauten lediglich für die künst-
lerische Vorratskammer der Architekten bestimmt war und noch die Verwirrung und Unselb-
ständigkeit, in der sich der deutsche Wohnbau seit beinahe einem Jahrhundert befindet, vermehrte,
wird aus der Darstellung der Entwicklung des englischen Hauses in dem trefflichen Muthesiusschen
Buch deutlich ersichtlich und mehrmals auch ausgesprochen, daß es auch für den deutschen Wohn-
hausbau nur ein Heil gibt: Die fremde Schablone zu vermeiden, selbständig zu werden.
Diese Rückgratstärkung, die unsere bodenständigen deutschen Bewegungen nebenbei durch
das Muthesiussche Werk erfahren werden, ist ein nicht zu unterschätzender Nebengewinn.
Es sei mir gestattet, einige Parallelen weiterzuführen. Namentlich werden zwei Künstlergruppen
von neuem die Ueberzeugung schöpfen, daß sie sich auf dem rechten Wege befinden, trotz allem
Geschrei der Biedermaiermode. Es sind die zwei Gruppen, die in den letzten Jahren mehr und
mehr über die Heere der gedankenlosen Imitatoren alter Traditionen und fremder Moden Herr zu
werden scheinen und den entsprechenden zwei englischen Richtungen so merkwürdig ähnlich
sehen, nämlich die des hierzuland namentlich an bäuerlich-barocke Formen anknüpfenden Primi-
tivismus und die Gruppe, die aus dem Lager der Kunstgewerbler und Maler entsproßte.
Wie die englischen ohne Berührungspunkte untereinander, sucht die eine die in Volks-Charakter und
Lebensgewohnheit begründet liegenden Eigentümlichkeiten des heimischen Bauens zu entwickeln,
an den hergebrachten bürgerlichen Wohnbau des Heimatlandes anzuknüpfen,* während die
andere, ohne darum heimische Gepflogenheiten in der Gesamtdisposition des Baues zu verletzen,
doch das Haus mit allen seinen Einzelheiten als das Produkt einer künstlerischen Phantasie
betrachtet, die ausdrücklich von den hergebrachten Formen abstrahiert und für unsere vollkommen
neuen, durch kein Jahrhundert vorgebildeten Lebensverhältnisse auch vollkommen neue Wohn-
formen sucht.**
Ist es nun aber nicht sehr zu bedauern, daß in Deutschland und in einem Ländchen wie Württem-
berg diese beiden Bewegungen heute immer noch ohne Berührung nebeneinander verlaufen, während
in England, wie Muthesius zeigt, die kunstgewerbliche Bewegung schon von 1860 ab Einfluß auf
die Gestaltung der Hausarchitektur gewinnt, sie wesentlich bereichert hat, während die heutige
Bedeutung der englischen und namentlich der schottischen Architektur in erster Linie mit auf den
maßgebenden Einfluß des Kunstgewerbes zu setzen ist? Wäre es nicht gerade in einem kleinen
Lande wie Württemberg und namentlich bei den zu erwartenden großen baulichen Aenderungen
in Stuttgart möglich, die Verschmelzung der Künste auch durch Aneinandergliederung der Kunst-
schulen zu befördern?*'* Könnte nicht Stuttgart durch eine zeitgemäße Umgestaltung seiner Archi-
tekturfachschule und seiner Kunstgewerbeschule, die beide noch auf den traditionellen, meist noch
klassizistischen und romantischen Anschauungen des Anfangs und der Mitte des 19. Jahrhunderts
aufgebaut sind, dem jüngeren Geschlecht seiner Kunstgewerbler wie seiner Architekten einen bedeu-
tenden Vorsprung vor den Schülern fremder Anstalten geben ? In erster Linie müßte die Kunst-
gewerbeschule wieder in enge Berührung mit dem Handwerk gebracht werden. Aber wäre nicht
in Stuttgart die Basierung der Kunstgewerbeschule auf Werkstättenarbeit besonders leicht durch-
zuführen, nachdem in den Königlichen Lehr- und Versuchswerkstätten schon ein Experiment vor-
liegt, bei dem mit oft ungeeignetem Schülermaterial und äußerst dürftigen finanziellen Mitteln doch
unter dem neuen Regime so erfreuliche Erfolge erzielt wurden ?
Doch ich fürchte, auch in Stuttgart werden namentlich die zünftigen Architekten, wie vor einem
Menschenalter die britischen, finden: „Das Handwerk liegt unterhalb unseres Bereichs". Daß das
Bedürfnis kunstgewerblichen Studiums aber in der Tat auch bei uns heute von den jungen Archi-
tekten gefühlt wird, wie wieder vor einem Menschenalter in England (vgl. S. 148 ff.), ergiebt sich aus
dem Umstand, daß die Architekturstudierenden der Stuttgarter Hochschule beginnen, an den Lehr-
und Versuchswerkstätten und an der Akademie ihre Studien zu erweitern. Allerdings, daß wir von
der jüngeren Generation sagen könnten, wie Muthesius es schon von den Schülern Norman Shaws
tut: „Sie fühlen sich in ihren besten Elementen mit der kunstgewerblichen Bewegung
eins", so weit sind wir leider noch nicht. Hoffen wir, daß es bald so kommen möge, das Muthesius-
sche Werk wird das Seine dazu beitragen. Franck-Oberaspach.
* Von der dieser Bewegung drohenden Gefahr, daß sie nämlich doch wieder bei der Imitation des Alten - Barock!
Biedermaier! — landen und nur eine weitere historisierende Stilmode zu all den verflossenen heraufbeschwören werde, legen
leider auch die Abbildungen dieses Heftes Zeugnis ab.
** Man vergleiche hiezu die Ausführungen von Muthesius in dem Aufsatz: Der "Weg und das Endziel des Kunstgewerbes
in dekorative Kunst, Bruckmann, München Bd. VIII, 1905.
*** "Während des Druckes dieses Heftes wurde ja eine verwandte Frage durch die Verhandlungen des Landtages vom
17. und 18. Mai in Fluß gebracht. Vergl. in »Verhandlungen der "Wurttemb. Kammer der Abgeordneten, 83. und 84. Sitzung« die
Worte von Haußmann. Balingen, namentlich S. 2062 ff.
60