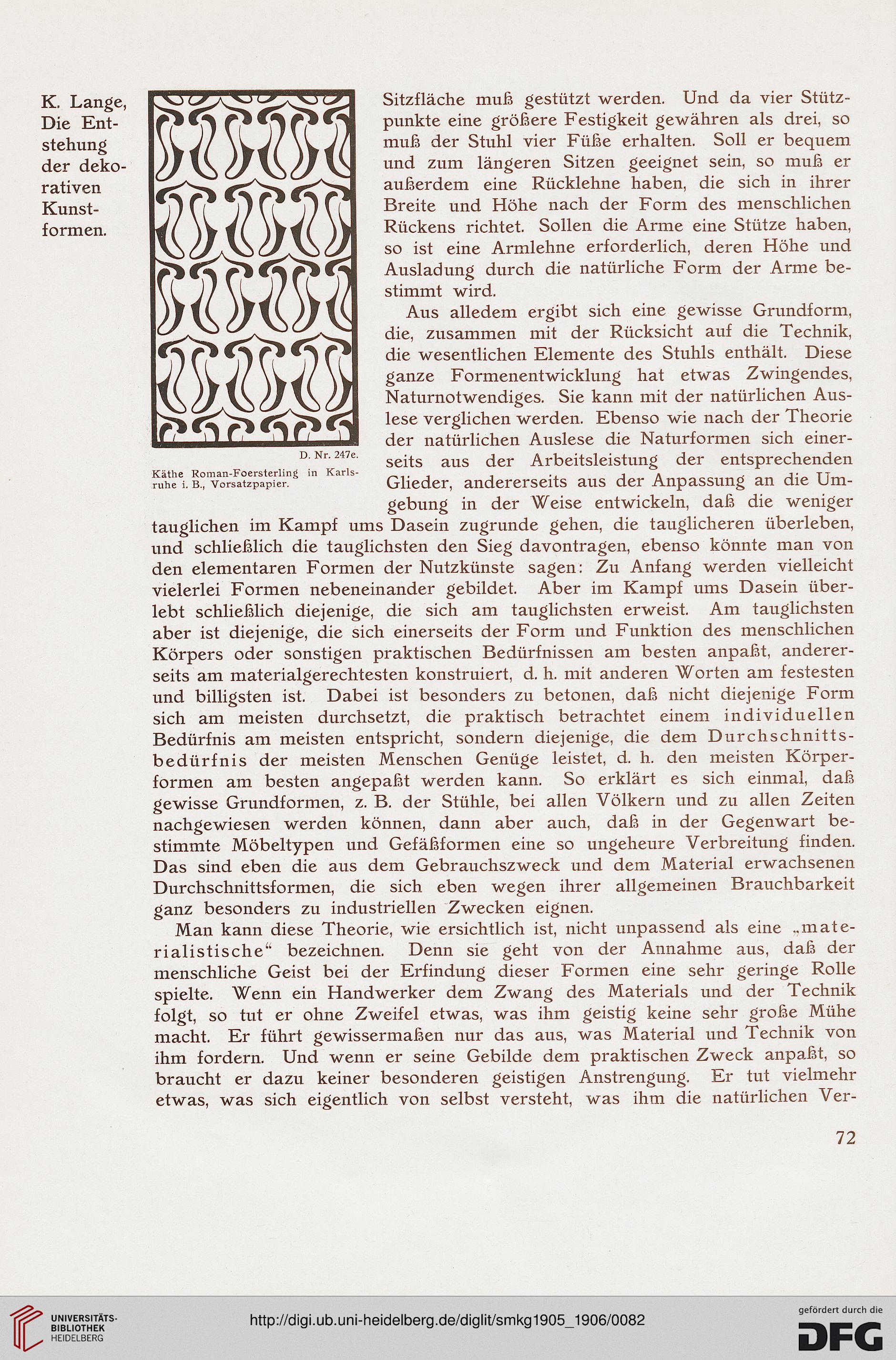Sitzfläche muß gestützt werden. Und da vier Stütz-
punkte eine größere Festigkeit gewähren als drei, so
muß der Stuhl vier Füße erhalten. Soll er bequem
und zum längeren Sitzen geeignet sein, so muß er
außerdem eine Rücklehne haben, die sich in ihrer
Breite und Höhe nach der Form des menschlichen
Rückens richtet. Sollen die Arme eine Stütze haben,
so ist eine Armlehne erforderlich, deren Höhe und
Ausladung durch die natürliche Form der Arme be-
stimmt wird.
Aus alledem ergibt sich eine gewisse Grundform,
die, zusammen mit der Rücksicht auf die Technik,
die wesentlichen Elemente des Stuhls enthält. Diese
ganze Formenentwicklung hat etwas Zwingendes,
Naturnotwendiges. Sie kann mit der natürlichen Aus-
lese verglichen werden. Ebenso wie nach der Theorie
der natürlichen Auslese die Naturformen sich einer-
seits aus der Arbeitsleistung der entsprechenden
Glieder, andererseits aus der Anpassung an die Um-
gebung in der Weise entwickeln, daß die weniger
tauglichen im Kampf ums Dasein zugrunde gehen, die tauglicheren überleben,
und schließlich die tauglichsten den Sieg davontragen, ebenso könnte man von
den elementaren Formen der Nutzkünste sagen: Zu Anfang werden vielleicht
vielerlei Formen nebeneinander gebildet. Aber im Kampf ums Dasein über-
lebt schließlich diejenige, die sich am tauglichsten erweist. Am tauglichsten
aber ist diejenige, die sich einerseits der Form und Funktion des menschlichen
Körpers oder sonstigen praktischen Bedürfnissen am besten anpaßt, anderer-
seits am materialgerechtesten konstruiert, d. h. mit anderen Worten am festesten
und billigsten ist. Dabei ist besonders zu betonen, daß nicht diejenige Form
sich am meisten durchsetzt, die praktisch betrachtet einem individuellen
Bedürfnis am meisten entspricht, sondern diejenige, die dem Durchschnitts-
bedürfnis der meisten Menschen Genüge leistet, d. h. den meisten Körper-
formen am besten angepaßt werden kann. So erklärt es sich einmal, daß
gewisse Grundformen, z. B. der Stühle, bei allen Völkern und zu allen Zeiten
nachgewiesen werden können, dann aber auch, daß in der Gegenwart be-
stimmte Möbeltypen und Gefäßformen eine so ungeheure Verbreitung finden.
Das sind eben die aus dem Gebrauchszweck und dem Material erwachsenen
Durchschnittsformen, die sich eben wegen ihrer allgemeinen Brauchbarkeit
ganz besonders zu industriellen Zwecken eignen.
Man kann diese Theorie, wie ersichtlich ist, nicht unpassend als eine ..mate-
rialistische" bezeichnen. Denn sie geht von der Annahme aus, daß der
menschliche Geist bei der Erfindung dieser Formen eine sehr geringe Rolle
spielte. Wenn ein Handwerker dem Zwang des Materials und der Technik
folgt, so tut er ohne Zweifel etwas, was ihm geistig keine sehr große Mühe
macht. Er führt gewissermaßen nur das aus, was Material und Technik von
ihm fordern. Und wenn er seine Gebilde dem praktischen Zweck anpaßt, so
braucht er dazu keiner besonderen geistigen Anstrengung. Er tut vielmehr
etwas, was sich eigentlich von selbst versteht, was ihm die natürlichen Ver-
K. Lange,
Die Ent-
stehung
der deko-
rativen
Kunst-
formen.
D. Nr. 247e.
Käthe Roman-Foersterling in Karls-
ruhe i. B., Vorsatzpapier.
72
punkte eine größere Festigkeit gewähren als drei, so
muß der Stuhl vier Füße erhalten. Soll er bequem
und zum längeren Sitzen geeignet sein, so muß er
außerdem eine Rücklehne haben, die sich in ihrer
Breite und Höhe nach der Form des menschlichen
Rückens richtet. Sollen die Arme eine Stütze haben,
so ist eine Armlehne erforderlich, deren Höhe und
Ausladung durch die natürliche Form der Arme be-
stimmt wird.
Aus alledem ergibt sich eine gewisse Grundform,
die, zusammen mit der Rücksicht auf die Technik,
die wesentlichen Elemente des Stuhls enthält. Diese
ganze Formenentwicklung hat etwas Zwingendes,
Naturnotwendiges. Sie kann mit der natürlichen Aus-
lese verglichen werden. Ebenso wie nach der Theorie
der natürlichen Auslese die Naturformen sich einer-
seits aus der Arbeitsleistung der entsprechenden
Glieder, andererseits aus der Anpassung an die Um-
gebung in der Weise entwickeln, daß die weniger
tauglichen im Kampf ums Dasein zugrunde gehen, die tauglicheren überleben,
und schließlich die tauglichsten den Sieg davontragen, ebenso könnte man von
den elementaren Formen der Nutzkünste sagen: Zu Anfang werden vielleicht
vielerlei Formen nebeneinander gebildet. Aber im Kampf ums Dasein über-
lebt schließlich diejenige, die sich am tauglichsten erweist. Am tauglichsten
aber ist diejenige, die sich einerseits der Form und Funktion des menschlichen
Körpers oder sonstigen praktischen Bedürfnissen am besten anpaßt, anderer-
seits am materialgerechtesten konstruiert, d. h. mit anderen Worten am festesten
und billigsten ist. Dabei ist besonders zu betonen, daß nicht diejenige Form
sich am meisten durchsetzt, die praktisch betrachtet einem individuellen
Bedürfnis am meisten entspricht, sondern diejenige, die dem Durchschnitts-
bedürfnis der meisten Menschen Genüge leistet, d. h. den meisten Körper-
formen am besten angepaßt werden kann. So erklärt es sich einmal, daß
gewisse Grundformen, z. B. der Stühle, bei allen Völkern und zu allen Zeiten
nachgewiesen werden können, dann aber auch, daß in der Gegenwart be-
stimmte Möbeltypen und Gefäßformen eine so ungeheure Verbreitung finden.
Das sind eben die aus dem Gebrauchszweck und dem Material erwachsenen
Durchschnittsformen, die sich eben wegen ihrer allgemeinen Brauchbarkeit
ganz besonders zu industriellen Zwecken eignen.
Man kann diese Theorie, wie ersichtlich ist, nicht unpassend als eine ..mate-
rialistische" bezeichnen. Denn sie geht von der Annahme aus, daß der
menschliche Geist bei der Erfindung dieser Formen eine sehr geringe Rolle
spielte. Wenn ein Handwerker dem Zwang des Materials und der Technik
folgt, so tut er ohne Zweifel etwas, was ihm geistig keine sehr große Mühe
macht. Er führt gewissermaßen nur das aus, was Material und Technik von
ihm fordern. Und wenn er seine Gebilde dem praktischen Zweck anpaßt, so
braucht er dazu keiner besonderen geistigen Anstrengung. Er tut vielmehr
etwas, was sich eigentlich von selbst versteht, was ihm die natürlichen Ver-
K. Lange,
Die Ent-
stehung
der deko-
rativen
Kunst-
formen.
D. Nr. 247e.
Käthe Roman-Foersterling in Karls-
ruhe i. B., Vorsatzpapier.
72