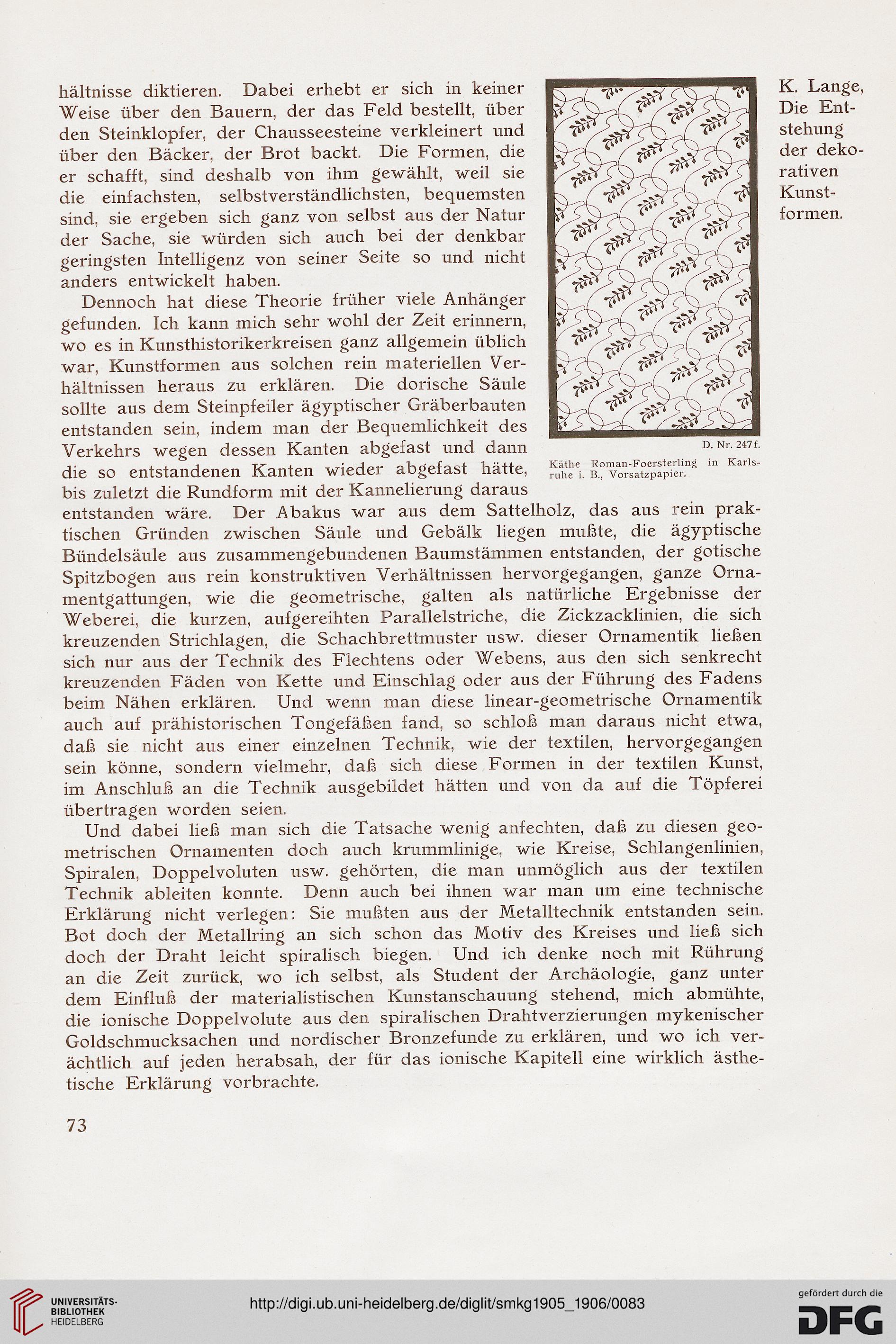D. Nr. 2471
Käthe Roman-Foersterling in Karls-
ruhe i. B., Vorsatzpapier.
hältnisse diktieren. Dabei erhebt er sich in keiner
Weise über den Bauern, der das Feld bestellt, über
den Steinklopfer, der Chausseesteine verkleinert und
über den Bäcker, der Brot backt. Die Formen, die
er schafft, sind deshalb von ihm gewählt, weil sie
die einfachsten, selbstverständlichsten, bequemsten
sind, sie ergeben sich ganz von selbst aus der Natur
der Sache, sie würden sich auch bei der denkbar
geringsten Intelligenz von seiner Seite so und nicht
anders entwickelt haben.
Dennoch hat diese Theorie früher viele Anhänger
gefunden. Ich kann mich sehr wohl der Zeit erinnern,
wo es in Kunsthistorikerkreisen ganz allgemein üblich
war, Kunstformen aus solchen rein materiellen Ver-
hältnissen heraus zu erklären. Die dorische Säule
sollte aus dem Steinpfeiler ägyptischer Gräberbauten
entstanden sein, indem man der Bequemlichkeit des
Verkehrs wegen dessen Kanten abgefast und dann
die so entstandenen Kanten wieder abgefast hätte,
bis zuletzt die Rundform mit der Kannelierung daraus
entstanden wäre. Der Abakus war aus dem Sattelholz, das aus rein prak-
tischen Gründen zwischen Säule und Gebälk liegen mußte, die ägyptische
Bündelsäule aus zusammengebundenen Baumstämmen entstanden, der gotische
Spitzbogen aus rein konstruktiven Verhältnissen hervorgegangen, ganze Orna-
mentgattungen, wie die geometrische, galten als natürliche Ergebnisse der
Weberei, die kurzen, aufgereihten Parallelstriche, die Zickzacklinien, die sich
kreuzenden Strichlagen, die Schachbrettmuster usw. dieser Ornamentik ließen
sich nur aus der Technik des Flechtens oder Webens, aus den sich senkrecht
kreuzenden Fäden von Kette und Einschlag oder aus der Führung des Fadens
beim Nähen erklären. Und wenn man diese linear-geometrische Ornamentik
auch auf prähistorischen Tongefäßen fand, so schloß man daraus nicht etwa,
daß sie nicht aus einer einzelnen Technik, wie der textilen, hervorgegangen
sein könne, sondern vielmehr, daß sich diese Formen in der textilen Kunst,
im Anschluß an die Technik ausgebildet hätten und von da auf die Töpferei
übertragen worden seien.
Und dabei ließ man sich die Tatsache wenig anfechten, daß zu diesen geo-
metrischen Ornamenten doch auch krummlinige, wie Kreise, Schlangenlinien,
Spiralen, Doppelvoluten usw. gehörten, die man unmöglich aus der textilen
Technik ableiten konnte. Denn auch bei ihnen war man um eine technische
Erklärung nicht verlegen: Sie mußten aus der Metalltechnik entstanden sein.
Bot doch der Metallring an sich schon das Motiv des Kreises und ließ sich
doch der Draht leicht spiralisch biegen. Und ich denke noch mit Rührung
an die Zeit zurück, wo ich selbst, als Student der Archäologie, ganz unter
dem Einfluß der materialistischen Kunstanschauung stehend, mich abmühte,
die ionische Doppelvolute aus den spiralischen Drahtverzierungen mykenischer
Goldschmucksachen und nordischer Bronzefunde zu erklären, und wo ich ver-
ächtlich auf jeden herabsah, der für das ionische Kapitell eine wirklich ästhe-
tische Erklärung vorbrachte.
K. Lange,
Die Ent-
stehung
der deko-
rativen
Kunst-
formen.
73
Käthe Roman-Foersterling in Karls-
ruhe i. B., Vorsatzpapier.
hältnisse diktieren. Dabei erhebt er sich in keiner
Weise über den Bauern, der das Feld bestellt, über
den Steinklopfer, der Chausseesteine verkleinert und
über den Bäcker, der Brot backt. Die Formen, die
er schafft, sind deshalb von ihm gewählt, weil sie
die einfachsten, selbstverständlichsten, bequemsten
sind, sie ergeben sich ganz von selbst aus der Natur
der Sache, sie würden sich auch bei der denkbar
geringsten Intelligenz von seiner Seite so und nicht
anders entwickelt haben.
Dennoch hat diese Theorie früher viele Anhänger
gefunden. Ich kann mich sehr wohl der Zeit erinnern,
wo es in Kunsthistorikerkreisen ganz allgemein üblich
war, Kunstformen aus solchen rein materiellen Ver-
hältnissen heraus zu erklären. Die dorische Säule
sollte aus dem Steinpfeiler ägyptischer Gräberbauten
entstanden sein, indem man der Bequemlichkeit des
Verkehrs wegen dessen Kanten abgefast und dann
die so entstandenen Kanten wieder abgefast hätte,
bis zuletzt die Rundform mit der Kannelierung daraus
entstanden wäre. Der Abakus war aus dem Sattelholz, das aus rein prak-
tischen Gründen zwischen Säule und Gebälk liegen mußte, die ägyptische
Bündelsäule aus zusammengebundenen Baumstämmen entstanden, der gotische
Spitzbogen aus rein konstruktiven Verhältnissen hervorgegangen, ganze Orna-
mentgattungen, wie die geometrische, galten als natürliche Ergebnisse der
Weberei, die kurzen, aufgereihten Parallelstriche, die Zickzacklinien, die sich
kreuzenden Strichlagen, die Schachbrettmuster usw. dieser Ornamentik ließen
sich nur aus der Technik des Flechtens oder Webens, aus den sich senkrecht
kreuzenden Fäden von Kette und Einschlag oder aus der Führung des Fadens
beim Nähen erklären. Und wenn man diese linear-geometrische Ornamentik
auch auf prähistorischen Tongefäßen fand, so schloß man daraus nicht etwa,
daß sie nicht aus einer einzelnen Technik, wie der textilen, hervorgegangen
sein könne, sondern vielmehr, daß sich diese Formen in der textilen Kunst,
im Anschluß an die Technik ausgebildet hätten und von da auf die Töpferei
übertragen worden seien.
Und dabei ließ man sich die Tatsache wenig anfechten, daß zu diesen geo-
metrischen Ornamenten doch auch krummlinige, wie Kreise, Schlangenlinien,
Spiralen, Doppelvoluten usw. gehörten, die man unmöglich aus der textilen
Technik ableiten konnte. Denn auch bei ihnen war man um eine technische
Erklärung nicht verlegen: Sie mußten aus der Metalltechnik entstanden sein.
Bot doch der Metallring an sich schon das Motiv des Kreises und ließ sich
doch der Draht leicht spiralisch biegen. Und ich denke noch mit Rührung
an die Zeit zurück, wo ich selbst, als Student der Archäologie, ganz unter
dem Einfluß der materialistischen Kunstanschauung stehend, mich abmühte,
die ionische Doppelvolute aus den spiralischen Drahtverzierungen mykenischer
Goldschmucksachen und nordischer Bronzefunde zu erklären, und wo ich ver-
ächtlich auf jeden herabsah, der für das ionische Kapitell eine wirklich ästhe-
tische Erklärung vorbrachte.
K. Lange,
Die Ent-
stehung
der deko-
rativen
Kunst-
formen.
73