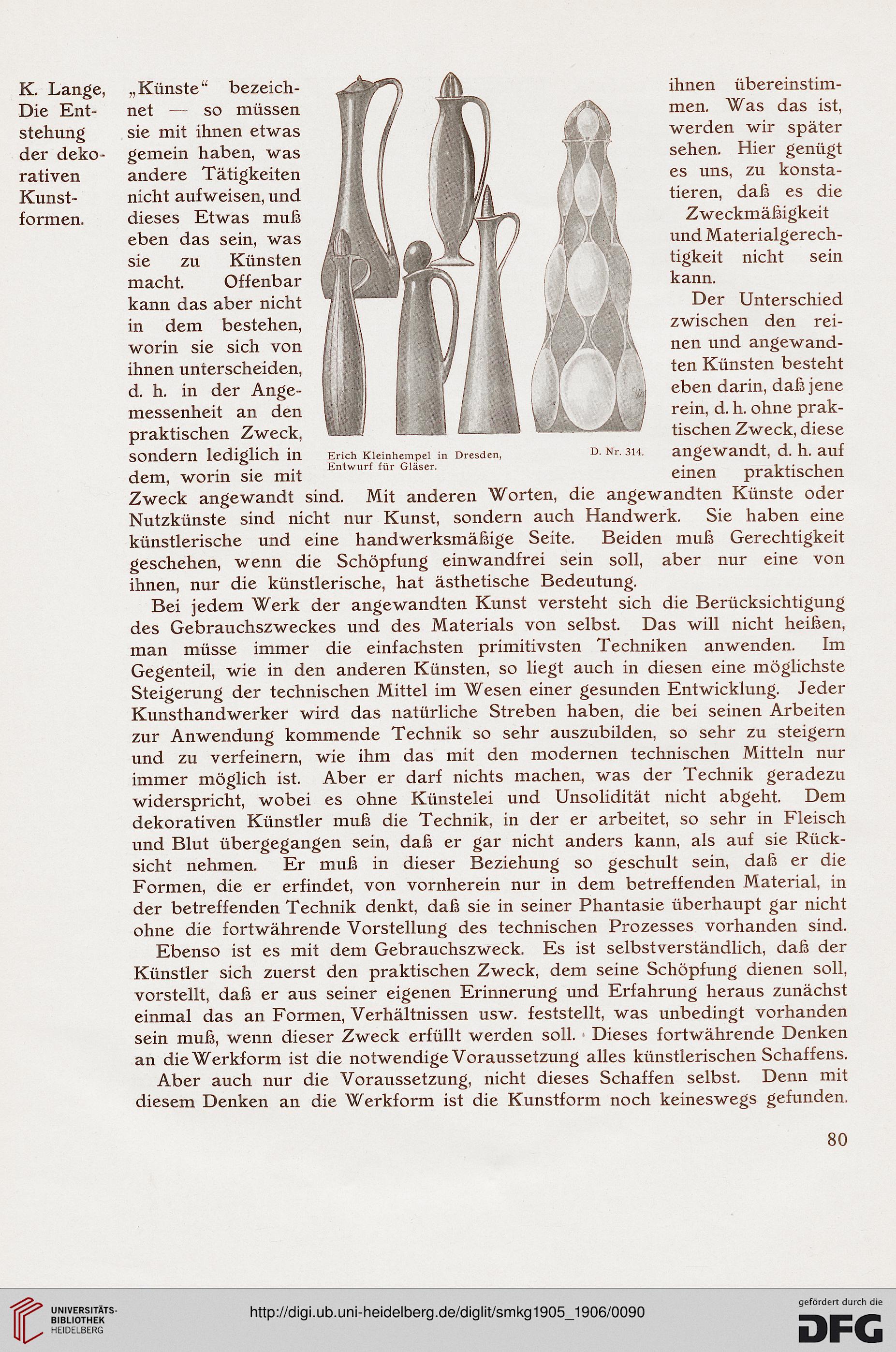K. Lange, Künste" bezeich-
Die Ent- net — so müssen
stehung sie mit ihnen etwas
der deko- gemein haben, was
rativen andere Tätigkeiten
Kunst- nicht aufweisen, und
formen. dieses Etwas muß
eben das sein, was
sie zu Künsten
macht. Offenbar
kann das aber nicht
in dem bestehen,
worin sie sich von
ihnen unterscheiden,
d. h. in der Ange-
messenheit an den
praktischen Zweck,
sondern lediglich in
dem, worin sie mit
ihnen übereinstim-
men. Was das ist,
werden wir später
sehen. Hier genügt
es uns, zu konsta-
tieren, daß es die
Zweckmäßigkeit
und Materialgerech-
tigkeit nicht sein
kann.
Der Unterschied
zwischen den rei-
nen und angewand-
ten Künsten besteht
eben darin, daß jene
rein, d. h. ohne prak-
tischen Zweck, diese
angewandt, d. h. auf
einen praktischen
Erich Kleinhempel in Dresden,
Entwurf für Gläser.
D. Nr. 314.
Zweck angewandt sind. Mit anderen Worten, die angewandten Künste oder
Nutzkünste sind nicht nur Kunst, sondern auch Handwerk. Sie haben eine
künstlerische und eine handwerksmäßige Seite. Beiden muß Gerechtigkeit
geschehen, wenn die Schöpfung einwandfrei sein soll, aber nur eine von
ihnen, nur die künstlerische, hat ästhetische Bedeutung.
Bei jedem Werk der angewandten Kunst versteht sich die Berücksichtigung
des Gebrauchszweckes und des Materials von selbst. Das will nicht heißen,
man müsse immer die einfachsten primitivsten Techniken anwenden. Im
Gegenteil, wie in den anderen Künsten, so liegt auch in diesen eine möglichste
Steigerung der technischen Mittel im Wesen einer gesunden Entwicklung. Jeder
Kunsthandwerker wird das natürliche Streben haben, die bei seinen Arbeiten
zur Anwendung kommende Technik so sehr auszubilden, so sehr zu steigern
und zu verfeinern, wie ihm das mit den modernen technischen Mitteln nur
immer möglich ist. Aber er darf nichts machen, was der Technik geradezu
widerspricht, wobei es ohne Künstelei und Unsolidität nicht abgeht. Dem
dekorativen Künstler muß die Technik, in der er arbeitet, so sehr in Fleisch
und Blut übergegangen sein, daß er gar nicht anders kann, als auf sie Rück-
sicht nehmen. Er muß in dieser Beziehung so geschult sein, daß er die
Formen, die er erfindet, von vornherein nur in dem betreffenden Material, in
der betreffenden Technik denkt, daß sie in seiner Phantasie überhaupt gar nicht
ohne die fortwährende Vorstellung des technischen Prozesses vorhanden sind.
Ebenso ist es mit dem Gebrauchszweck. Es ist selbstverständlich, daß der
Künstler sich zuerst den praktischen Zweck, dem seine Schöpfung dienen soll,
vorstellt, daß er aus seiner eigenen Erinnerung und Erfahrung heraus zunächst
einmal das an Formen, Verhältnissen usw. feststellt, was unbedingt vorhanden
sein muß, wenn dieser Zweck erfüllt werden soll. 1 Dieses fortwährende Denken
an die Werkform ist die notwendige Voraussetzung alles künstlerischen Schaffens.
Aber auch nur die Voraussetzung, nicht dieses Schaffen selbst. Denn mit
diesem Denken an die Werkform ist die Kunstform noch keineswegs gefunden.
80
Die Ent- net — so müssen
stehung sie mit ihnen etwas
der deko- gemein haben, was
rativen andere Tätigkeiten
Kunst- nicht aufweisen, und
formen. dieses Etwas muß
eben das sein, was
sie zu Künsten
macht. Offenbar
kann das aber nicht
in dem bestehen,
worin sie sich von
ihnen unterscheiden,
d. h. in der Ange-
messenheit an den
praktischen Zweck,
sondern lediglich in
dem, worin sie mit
ihnen übereinstim-
men. Was das ist,
werden wir später
sehen. Hier genügt
es uns, zu konsta-
tieren, daß es die
Zweckmäßigkeit
und Materialgerech-
tigkeit nicht sein
kann.
Der Unterschied
zwischen den rei-
nen und angewand-
ten Künsten besteht
eben darin, daß jene
rein, d. h. ohne prak-
tischen Zweck, diese
angewandt, d. h. auf
einen praktischen
Erich Kleinhempel in Dresden,
Entwurf für Gläser.
D. Nr. 314.
Zweck angewandt sind. Mit anderen Worten, die angewandten Künste oder
Nutzkünste sind nicht nur Kunst, sondern auch Handwerk. Sie haben eine
künstlerische und eine handwerksmäßige Seite. Beiden muß Gerechtigkeit
geschehen, wenn die Schöpfung einwandfrei sein soll, aber nur eine von
ihnen, nur die künstlerische, hat ästhetische Bedeutung.
Bei jedem Werk der angewandten Kunst versteht sich die Berücksichtigung
des Gebrauchszweckes und des Materials von selbst. Das will nicht heißen,
man müsse immer die einfachsten primitivsten Techniken anwenden. Im
Gegenteil, wie in den anderen Künsten, so liegt auch in diesen eine möglichste
Steigerung der technischen Mittel im Wesen einer gesunden Entwicklung. Jeder
Kunsthandwerker wird das natürliche Streben haben, die bei seinen Arbeiten
zur Anwendung kommende Technik so sehr auszubilden, so sehr zu steigern
und zu verfeinern, wie ihm das mit den modernen technischen Mitteln nur
immer möglich ist. Aber er darf nichts machen, was der Technik geradezu
widerspricht, wobei es ohne Künstelei und Unsolidität nicht abgeht. Dem
dekorativen Künstler muß die Technik, in der er arbeitet, so sehr in Fleisch
und Blut übergegangen sein, daß er gar nicht anders kann, als auf sie Rück-
sicht nehmen. Er muß in dieser Beziehung so geschult sein, daß er die
Formen, die er erfindet, von vornherein nur in dem betreffenden Material, in
der betreffenden Technik denkt, daß sie in seiner Phantasie überhaupt gar nicht
ohne die fortwährende Vorstellung des technischen Prozesses vorhanden sind.
Ebenso ist es mit dem Gebrauchszweck. Es ist selbstverständlich, daß der
Künstler sich zuerst den praktischen Zweck, dem seine Schöpfung dienen soll,
vorstellt, daß er aus seiner eigenen Erinnerung und Erfahrung heraus zunächst
einmal das an Formen, Verhältnissen usw. feststellt, was unbedingt vorhanden
sein muß, wenn dieser Zweck erfüllt werden soll. 1 Dieses fortwährende Denken
an die Werkform ist die notwendige Voraussetzung alles künstlerischen Schaffens.
Aber auch nur die Voraussetzung, nicht dieses Schaffen selbst. Denn mit
diesem Denken an die Werkform ist die Kunstform noch keineswegs gefunden.
80