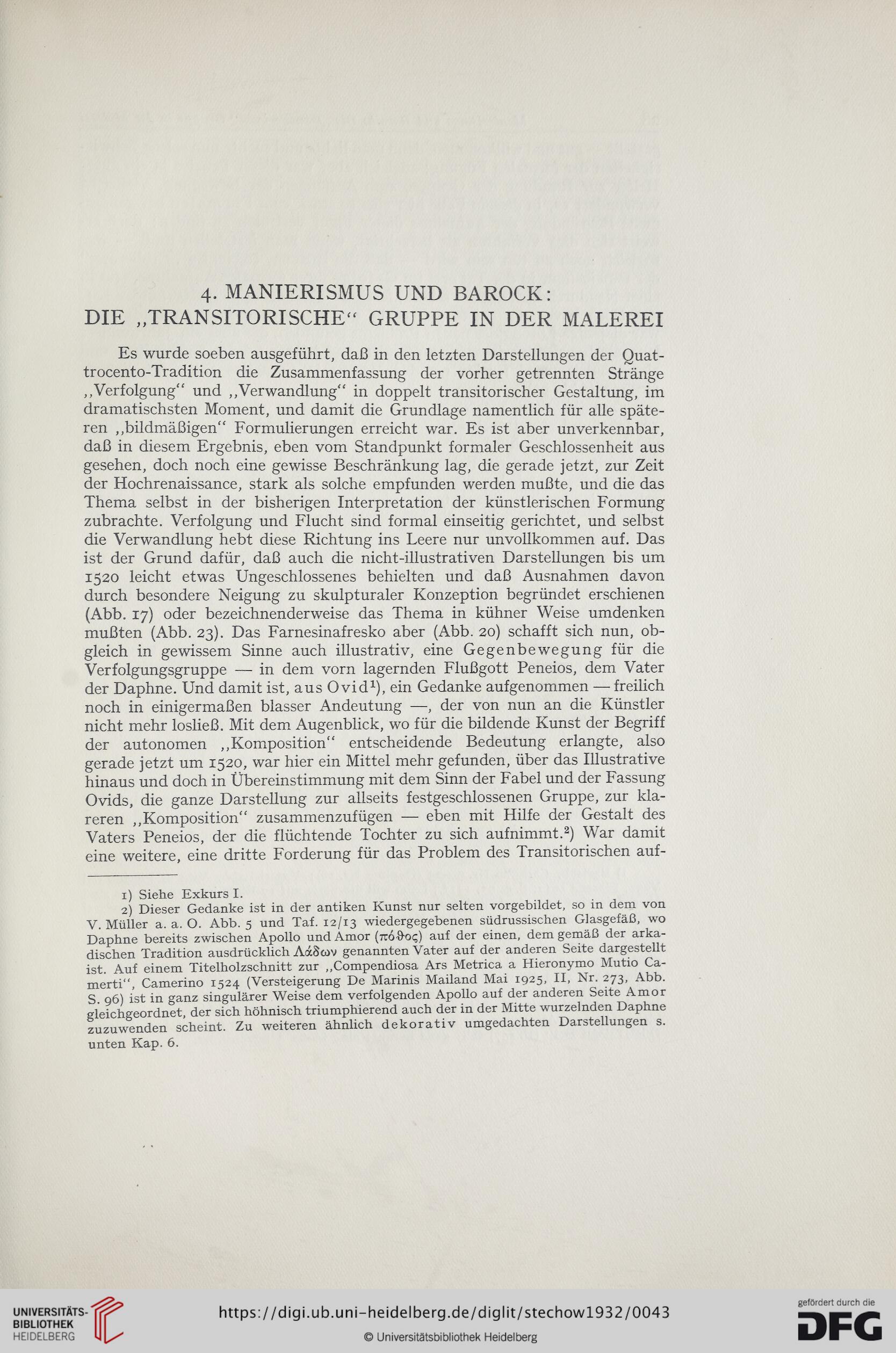4. MANIERISMUS UND BAROCK:
DIE „TRANSITORISCHE“ GRUPPE IN DER MALEREI
Es wurde soeben ausgeführt, daß in den letzten Darstellungen der Quat-
trocento-Tradition die Zusammenfassung der vorher getrennten Stränge
„Verfolgung“ und „Verwandlung“ in doppelt transitorischer Gestaltung, im
dramatischsten Moment, und damit die Grundlage namentlich für alle späte-
ren „bildmäßigen“ Formulierungen erreicht war. Es ist aber unverkennbar,
daß in diesem Ergebnis, eben vom Standpunkt formaler Geschlossenheit aus
gesehen, doch noch eine gewisse Beschränkung lag, die gerade jetzt, zur Zeit
der Hochrenaissance, stark als solche empfunden werden mußte, und die das
Thema selbst in der bisherigen Interpretation der künstlerischen Formung
zubrachte. Verfolgung und Flucht sind formal einseitig gerichtet, und selbst
die Verwandlung hebt diese Richtung ins Leere nur unvollkommen auf. Das
ist der Grund dafür, daß auch die nicht-illustrativen Darstellungen bis um
1520 leicht etwas Ungeschlossenes behielten und daß Ausnahmen davon
durch besondere Neigung zu skulpturaler Konzeption begründet erschienen
(Abb. 17) oder bezeichnenderweise das Thema in kühner Weise umdenken
mußten (Abb. 23). Das Farnesinafresko aber (Abb. 20) schafft sich nun, ob-
gleich in gewissem Sinne auch illustrativ, eine Gegenbewegung für die
Verfolgungsgruppe — in dem vorn lagernden Flußgott Peneios, dem Vater
der Daphne. Und damit ist, aus Ovid1), ein Gedanke aufgenommen — freilich
noch in einigermaßen blasser Andeutung —, der von nun an die Künstler
nicht mehr losließ. Mit dem Augenblick, wo für die bildende Kunst der Begriff
der autonomen „Komposition“ entscheidende Bedeutung erlangte, also
gerade jetzt um 1520, war hier ein Mittel mehr gefunden, über das Illustrative
hinaus und doch in Übereinstimmung mit dem Sinn der Fabel und der Fassung
Ovids, die ganze Darstellung zur allseits festgeschlossenen Gruppe, zur kla-
reren „Komposition“ zusammenzufügen — eben mit Hilfe der Gestalt des
Vaters Peneios, der die flüchtende Tochter zu sich aufnimmt.2) War damit
eine weitere, eine dritte Forderung für das Problem des Transitorischen auf-
1) Siehe Exkurs I.
2) Dieser Gedanke ist in der antiken Kunst nur selten vorgebildet, so in dem von
V. Müller a. a. O. Abb. 5 und Tat. 12/13 wiedergegebenen südrussischen Glasgefäß, wo
Daphne bereits zwischen Apollo und Amor (ttoHoc;) auf der einen, dem gemäß der arka-
dischen Tradition ausdrücklich Aa8wv genannten Vater auf der anderen Seite dargestellt
ist. Auf einem Titelholzschnitt zur „Compendiosa Ars Metrica a Hieronymo Mutio Ca-
merti“, Camerino 1524 (Versteigerung De Marinis Mailand Mai 1925, II, Nr. 273, Abb.
S. 96) ist in ganz singulärer Weise dem verfolgenden Apollo auf der anderen Seite Amor
gleichgeordnet, der sich höhnisch triumphierend auch der in der Mitte wurzelnden Daphne
zuzuwenden scheint. Zu weiteren ähnlich dekorativ umgedachten Darstellungen s.
unten Kap. 6.
DIE „TRANSITORISCHE“ GRUPPE IN DER MALEREI
Es wurde soeben ausgeführt, daß in den letzten Darstellungen der Quat-
trocento-Tradition die Zusammenfassung der vorher getrennten Stränge
„Verfolgung“ und „Verwandlung“ in doppelt transitorischer Gestaltung, im
dramatischsten Moment, und damit die Grundlage namentlich für alle späte-
ren „bildmäßigen“ Formulierungen erreicht war. Es ist aber unverkennbar,
daß in diesem Ergebnis, eben vom Standpunkt formaler Geschlossenheit aus
gesehen, doch noch eine gewisse Beschränkung lag, die gerade jetzt, zur Zeit
der Hochrenaissance, stark als solche empfunden werden mußte, und die das
Thema selbst in der bisherigen Interpretation der künstlerischen Formung
zubrachte. Verfolgung und Flucht sind formal einseitig gerichtet, und selbst
die Verwandlung hebt diese Richtung ins Leere nur unvollkommen auf. Das
ist der Grund dafür, daß auch die nicht-illustrativen Darstellungen bis um
1520 leicht etwas Ungeschlossenes behielten und daß Ausnahmen davon
durch besondere Neigung zu skulpturaler Konzeption begründet erschienen
(Abb. 17) oder bezeichnenderweise das Thema in kühner Weise umdenken
mußten (Abb. 23). Das Farnesinafresko aber (Abb. 20) schafft sich nun, ob-
gleich in gewissem Sinne auch illustrativ, eine Gegenbewegung für die
Verfolgungsgruppe — in dem vorn lagernden Flußgott Peneios, dem Vater
der Daphne. Und damit ist, aus Ovid1), ein Gedanke aufgenommen — freilich
noch in einigermaßen blasser Andeutung —, der von nun an die Künstler
nicht mehr losließ. Mit dem Augenblick, wo für die bildende Kunst der Begriff
der autonomen „Komposition“ entscheidende Bedeutung erlangte, also
gerade jetzt um 1520, war hier ein Mittel mehr gefunden, über das Illustrative
hinaus und doch in Übereinstimmung mit dem Sinn der Fabel und der Fassung
Ovids, die ganze Darstellung zur allseits festgeschlossenen Gruppe, zur kla-
reren „Komposition“ zusammenzufügen — eben mit Hilfe der Gestalt des
Vaters Peneios, der die flüchtende Tochter zu sich aufnimmt.2) War damit
eine weitere, eine dritte Forderung für das Problem des Transitorischen auf-
1) Siehe Exkurs I.
2) Dieser Gedanke ist in der antiken Kunst nur selten vorgebildet, so in dem von
V. Müller a. a. O. Abb. 5 und Tat. 12/13 wiedergegebenen südrussischen Glasgefäß, wo
Daphne bereits zwischen Apollo und Amor (ttoHoc;) auf der einen, dem gemäß der arka-
dischen Tradition ausdrücklich Aa8wv genannten Vater auf der anderen Seite dargestellt
ist. Auf einem Titelholzschnitt zur „Compendiosa Ars Metrica a Hieronymo Mutio Ca-
merti“, Camerino 1524 (Versteigerung De Marinis Mailand Mai 1925, II, Nr. 273, Abb.
S. 96) ist in ganz singulärer Weise dem verfolgenden Apollo auf der anderen Seite Amor
gleichgeordnet, der sich höhnisch triumphierend auch der in der Mitte wurzelnden Daphne
zuzuwenden scheint. Zu weiteren ähnlich dekorativ umgedachten Darstellungen s.
unten Kap. 6.