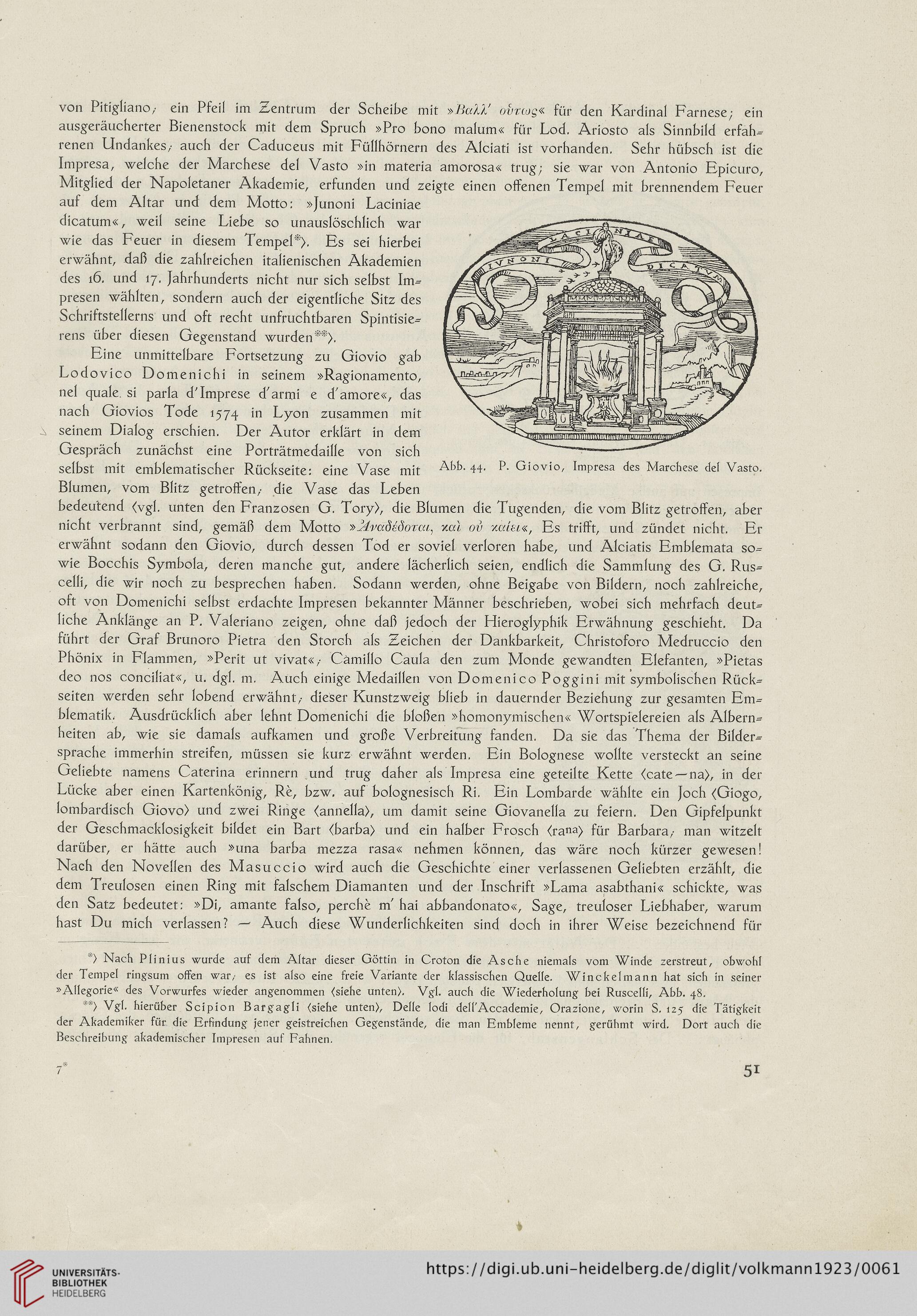von Pitigliano,- ein Pfeil im Zentrum der Scheibe mit »&U' ourwg« für den Kardinal Farnese; ein
ausgeräucherter Bienenstock mit dem Spruch »Pro bono malum« für Lod. Ariosto als Sinnbild erfah-
renen Undankes/ auch der Caduceus mit Füllhörnern des Alciati ist vorhanden. Sehr hübsch ist die
Impresa, welche der Marchese del Vasto »in materia amorosa« trug; sie war von Antonio Epicuro,
Mitglied der Napoletaner Akademie, erfunden und zeigte einen offenen Tempel mit brennendem Feuer
auf dem Altar und dem Motto: »Junoni Laciniae
dicatum«, weil seine Liebe so unauslöschlich war
wie das Feuer in diesem Tempel*/ Es sei hierbei
erwähnt, daß die zahlreichen italienischen Akademien
des 16. und 17. Jahrhunderts nicht nur sich selbst Im-
presen wählten, sondern auch der eigentliche Sitz des
Schriftstellerns und oft recht unfruchtbaren Spintisie-
rens über diesen Gegenstand wurden**/
Eine unmittelbare Fortsetzung zu Giovio gab
Lod ovico Domenichi in seinem »Ragionamento,
nel quäle, si parla dTmprese d'armi e d'amore«, das
nach Giovios Tode 1574 in Lyon zusammen mit
seinem Dialog erschien. Der Autor erklärt in dem
Gespräch zunächst eine Porträtmedaille von sich
selbst mit emblematischer Rückseite: eine Vase mit
Abb. 44. P. Giovio, Impresa des Marchese del Vasto.
Blumen, vom Blitz getroffen,- die Vase das Leben
bedeutend <vgl. unten den Franzosen G. Tory/ die Blumen die Tugenden, die vom Blitz getroffen, aber
nicht verbrannt sind, gemäß dem Motto »J/radedoraq xcu ov vuxtu«, Es trifft, und zündet nicht. Er
erwähnt sodann den Giovio, durch dessen Tod er soviel verloren habe, und Alciatis Emblemata so-
wie Bocchis Symbola, deren manche gut, andere lächerlich seien, endlich die Sammlung des G. Rus-
celli, die wir noch zu besprechen haben. Sodann werden, ohne Beigabe von Bildern, noch zahlreiche,
oft von Domenichi selbst erdachte Impresen bekannter Männer beschrieben, wobei sich mehrfach deut-
liche Anklänge an P. Valeriano zeigen, ohne daß jedoch der Hieroglyphik Erwähnung geschieht. Da
führt der Graf Brunoro Pietra den Storch als Zeichen der Dankbarkeit, Christoforo Medruccio den
Phönix in Flammen, »Perit ut vivat«,- Camillo Caula den zum Monde gewandten Elefanten, »Pietas
deo nos conciliat«, u. dgl. m. Auch einige Medaillen von Domenico Poggini mit symbolischen Rück-
seiten werden sehr lobend erwähnt,- dieser Kunstzweig blieb in dauernder Beziehung zur gesamten Em-
blematik. Ausdrücklich aber lehnt Domenichi die bloßen »homonymischen« Wortspielereien als Albern-
heiten ab, wie sie damals aufkamen und große Verbreitung fanden. Da sie das Thema der Bilder-
sprache immerhin streifen, müssen sie kurz erwähnt werden. Ein Bolognese wollte versteckt an seine
Geliebte namens Caterina erinnern und trug daher als Impresa eine geteilte Kette <cate —na>, in der
Lücke aber einen Kartenkönig, Re, bzw. auf bolognesisch Ri. Ein Lombarde wählte ein Joch <Giogo,
lombardisch Giovo> und zwei Ringe <annella>, um damit seine Giovanella zu feiern. Den Gipfelpunkt
der Geschmacklosigkeit bildet ein Bart <barba> und ein halber Frosch <rana> für Barbara,- man witzelt
darüber, er hätte auch »una barba mezza rasa« nehmen können, das wäre noch kürzer gewesen!
Nach den Novellen des Masuccio wird auch die Geschichte einer verlassenen Geliebten erzählt, die
dem Treulosen einen Ring mit falschem Diamanten und der Inschrift »Lama asabthani« schickte, was
den Satz bedeutet: »Di, amante falso, perche m' hai abbandonato«, Sage, treuloser Liebhaber, warum
hast Du mich verlassen? Auch diese Wunderlichkeiten sind doch in ihrer Weise bezeichnend für
*} Nach Plinius wurde auf dem Altar dieser Göttin in Croton die Asche niemals vom Winde zerstreut, obwohl
der Tempel ringsum offen war,- es ist also eine freie Variante der klassischen Quelle. Winckelmann hat sich in seiner
»Allegorie« des Vorwurfes wieder angenommen (siehe unten}. Vgl. auch die Wiederholung bei Ruscelli, Abb. 48.
**} Vgl. hierüber Scipion Bargagli (siehe unten}, Delle lodi dell'Accademie, Orazione, worin S. 125 die Tätigkeit
der Akademiker für die Erfindung jener geistreichen Gegenstände, die man Embleme nennt, gerühmt wird. Dort auch die
Beschreibung akademischer Impresen auf Fahnen.
7* 51
ausgeräucherter Bienenstock mit dem Spruch »Pro bono malum« für Lod. Ariosto als Sinnbild erfah-
renen Undankes/ auch der Caduceus mit Füllhörnern des Alciati ist vorhanden. Sehr hübsch ist die
Impresa, welche der Marchese del Vasto »in materia amorosa« trug; sie war von Antonio Epicuro,
Mitglied der Napoletaner Akademie, erfunden und zeigte einen offenen Tempel mit brennendem Feuer
auf dem Altar und dem Motto: »Junoni Laciniae
dicatum«, weil seine Liebe so unauslöschlich war
wie das Feuer in diesem Tempel*/ Es sei hierbei
erwähnt, daß die zahlreichen italienischen Akademien
des 16. und 17. Jahrhunderts nicht nur sich selbst Im-
presen wählten, sondern auch der eigentliche Sitz des
Schriftstellerns und oft recht unfruchtbaren Spintisie-
rens über diesen Gegenstand wurden**/
Eine unmittelbare Fortsetzung zu Giovio gab
Lod ovico Domenichi in seinem »Ragionamento,
nel quäle, si parla dTmprese d'armi e d'amore«, das
nach Giovios Tode 1574 in Lyon zusammen mit
seinem Dialog erschien. Der Autor erklärt in dem
Gespräch zunächst eine Porträtmedaille von sich
selbst mit emblematischer Rückseite: eine Vase mit
Abb. 44. P. Giovio, Impresa des Marchese del Vasto.
Blumen, vom Blitz getroffen,- die Vase das Leben
bedeutend <vgl. unten den Franzosen G. Tory/ die Blumen die Tugenden, die vom Blitz getroffen, aber
nicht verbrannt sind, gemäß dem Motto »J/radedoraq xcu ov vuxtu«, Es trifft, und zündet nicht. Er
erwähnt sodann den Giovio, durch dessen Tod er soviel verloren habe, und Alciatis Emblemata so-
wie Bocchis Symbola, deren manche gut, andere lächerlich seien, endlich die Sammlung des G. Rus-
celli, die wir noch zu besprechen haben. Sodann werden, ohne Beigabe von Bildern, noch zahlreiche,
oft von Domenichi selbst erdachte Impresen bekannter Männer beschrieben, wobei sich mehrfach deut-
liche Anklänge an P. Valeriano zeigen, ohne daß jedoch der Hieroglyphik Erwähnung geschieht. Da
führt der Graf Brunoro Pietra den Storch als Zeichen der Dankbarkeit, Christoforo Medruccio den
Phönix in Flammen, »Perit ut vivat«,- Camillo Caula den zum Monde gewandten Elefanten, »Pietas
deo nos conciliat«, u. dgl. m. Auch einige Medaillen von Domenico Poggini mit symbolischen Rück-
seiten werden sehr lobend erwähnt,- dieser Kunstzweig blieb in dauernder Beziehung zur gesamten Em-
blematik. Ausdrücklich aber lehnt Domenichi die bloßen »homonymischen« Wortspielereien als Albern-
heiten ab, wie sie damals aufkamen und große Verbreitung fanden. Da sie das Thema der Bilder-
sprache immerhin streifen, müssen sie kurz erwähnt werden. Ein Bolognese wollte versteckt an seine
Geliebte namens Caterina erinnern und trug daher als Impresa eine geteilte Kette <cate —na>, in der
Lücke aber einen Kartenkönig, Re, bzw. auf bolognesisch Ri. Ein Lombarde wählte ein Joch <Giogo,
lombardisch Giovo> und zwei Ringe <annella>, um damit seine Giovanella zu feiern. Den Gipfelpunkt
der Geschmacklosigkeit bildet ein Bart <barba> und ein halber Frosch <rana> für Barbara,- man witzelt
darüber, er hätte auch »una barba mezza rasa« nehmen können, das wäre noch kürzer gewesen!
Nach den Novellen des Masuccio wird auch die Geschichte einer verlassenen Geliebten erzählt, die
dem Treulosen einen Ring mit falschem Diamanten und der Inschrift »Lama asabthani« schickte, was
den Satz bedeutet: »Di, amante falso, perche m' hai abbandonato«, Sage, treuloser Liebhaber, warum
hast Du mich verlassen? Auch diese Wunderlichkeiten sind doch in ihrer Weise bezeichnend für
*} Nach Plinius wurde auf dem Altar dieser Göttin in Croton die Asche niemals vom Winde zerstreut, obwohl
der Tempel ringsum offen war,- es ist also eine freie Variante der klassischen Quelle. Winckelmann hat sich in seiner
»Allegorie« des Vorwurfes wieder angenommen (siehe unten}. Vgl. auch die Wiederholung bei Ruscelli, Abb. 48.
**} Vgl. hierüber Scipion Bargagli (siehe unten}, Delle lodi dell'Accademie, Orazione, worin S. 125 die Tätigkeit
der Akademiker für die Erfindung jener geistreichen Gegenstände, die man Embleme nennt, gerühmt wird. Dort auch die
Beschreibung akademischer Impresen auf Fahnen.
7* 51