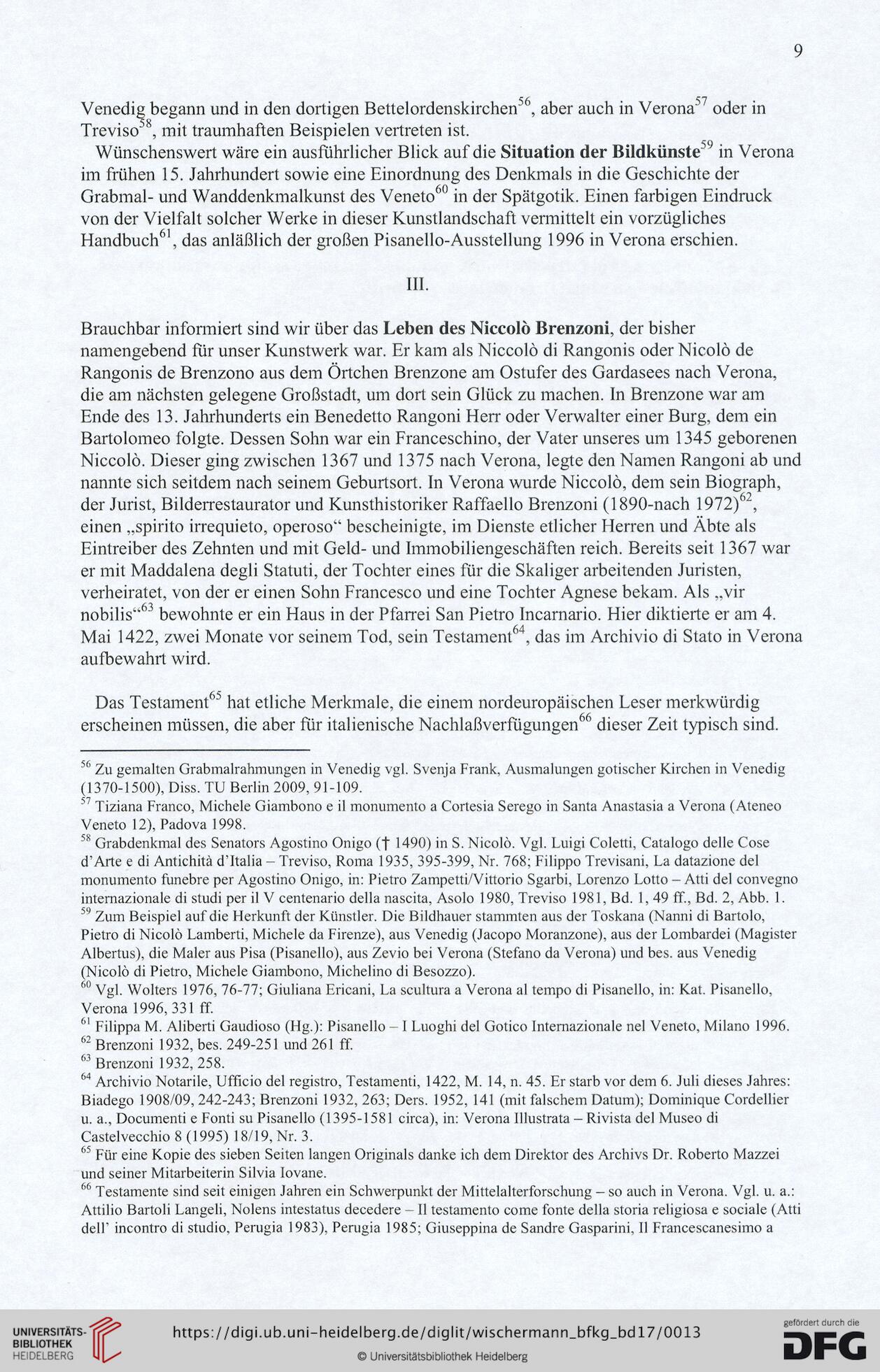9
Venedig begann und in den dortigen Bettelordenskirchen56, aber auch in Verona57 oder in
Treviso58, mit traumhaften Beispielen vertreten ist.
Wünschenswert wäre ein ausführlicher Blick auf die Situation der Bildkünste59 in Verona
im frühen 15. Jahrhundert sowie eine Einordnung des Denkmals in die Geschichte der
Grabmal- und Wanddenkmalkunst des Veneto60 in der Spätgotik. Einen farbigen Eindruck
von der Vielfalt solcher Werke in dieser Kunstlandschaft vermittelt ein vorzügliches
Handbuch61, das anläßlich der großen Pisanello-Ausstellung 1996 in Verona erschien.
III.
Brauchbar informiert sind wir über das Leben des Niccolö Brenzoni, der bisher
namengebend für unser Kunstwerk war. Er kam als Niccolö di Rangonis oder Nicolo de
Rangonis de Brenzono aus dem Örtchen Brenzone am Ostufer des Gardasees nach Verona,
die am nächsten gelegene Großstadt, um dort sein Glück zu machen. In Brenzone war am
Ende des 13. Jahrhunderts ein Benedetto Rangoni Herr oder Verwalter einer Burg, dem ein
Bartolomeo folgte. Dessen Sohn war ein Franceschino, der Vater unseres um 1345 geborenen
Niccolö. Dieser ging zwischen 1367 und 1375 nach Verona, legte den Namen Rangoni ab und
nannte sich seitdem nach seinem Geburtsort. In Verona wurde Niccolö, dem sein Biograph,
der Jurist, Bilderrestaurator und Kunsthistoriker Raffaello Brenzoni (1890-nach 1972)62,
einen „spirito irrequieto, operoso“ bescheinigte, im Dienste etlicher Herren und Äbte als
Eintreiber des Zehnten und mit Geld- und Immobiliengeschäften reich. Bereits seit 1367 war
er mit Maddalena degli Statuti, der Tochter eines für die Skaliger arbeitenden Juristen,
verheiratet, von der er einen Sohn Francesco und eine Tochter Agnese bekam. Als „vir
nobilis“63 bewohnte er ein Haus in der Pfarrei San Pietro Incarnario. Hier diktierte er am 4.
Mai 1422, zwei Monate vor seinem Tod, sein Testament64, das im Archivio di Stato in Verona
aufbewahrt wird.
Das Testament65 hat etliche Merkmale, die einem nordeuropäischen Leser merkwürdig
erscheinen müssen, die aber für italienische Nachlaßverfügungen66 dieser Zeit typisch sind.
56 Zu gemalten Grabmalrahmungen in Venedig vgl. Svenja Frank, Ausmalungen gotischer Kirchen in Venedig
(1370-1500), Diss. TU Berlin 2009, 91-109.
57 Tiziana Franco, Michele Giambono e il monumento a Cortesia Serego in Santa Anastasia a Verona (Ateneo
Veneto 12), Padova 1998.
58 Grabdenkmal des Senators Agostino Onigo (f 1490) in S. Nicolo. Vgl. Luigi Coletti, Catalogo delle Cose
d’Arte e di Antichitä d’Italia - Treviso, Roma 1935, 395-399, Nr. 768; Filippo Trevisani, La datazione del
monumento funebre per Agostino Onigo, in: Pietro Zampetti/Vittorio Sgarbi, Lorenzo Lotto — Atti del convegno
internazionale di studi per il V centenario della nascita, Asolo 1980, Treviso 1981, Bd. 1,49 ff., Bd. 2, Abb. 1.
59 Zum Beispiel auf die Herkunft der Künstler. Die Bildhauer stammten aus der Toskana (Nanni di Bartolo,
Pietro di Nicolo Lamberti, Michele da Firenze), aus Venedig (Jacopo Moranzone), aus der Lombardei (Magister
Albertus), die Maler aus Pisa (Pisanello), aus Zevio bei Verona (Stefano da Verona) und bes. aus Venedig
(Nicolo di Pietro, Michele Giambono, Michelino di Besozzo).
60 Vgl. Wolters 1976, 76-77; Giuliana Ericani, La scultura a Verona al tempo di Pisanello, in: Kat. Pisanello,
Verona 1996,331 ff.
61 Filippa M. Aliberti Gaudioso (Hg.): Pisanello -1 Luoghi del Gotico Internazionale nel Veneto, Milano 1996.
62 Brenzoni 1932, bes. 249-251 und 261 ff.
63 Brenzoni 1932, 258.
64 Archivio Notarile, Ufficio del registro, Testamenti, 1422, M. 14, n. 45. Er starb vor dem 6. Juli dieses Jahres:
Biadego 1908/09,242-243; Brenzoni 1932,263; Ders. 1952, 141 (mit falschem Datum); Dominique Cordellier
u. a., Documenti e Fonti su Pisanello (1395-1581 circa), in: Verona lllustrata - Rivista del Museo di
Castelvecchio 8 (1995) 18/19, Nr. 3.
65 Für eine Kopie des sieben Seiten langen Originals danke ich dem Direktor des Archivs Dr. Roberto Mazzei
und seiner Mitarbeiterin Silvia lovane.
66 Testamente sind seit einigen Jahren ein Schwerpunkt der Mittelalterforschung - so auch in Verona. Vgl. u. a.:
Attilio Bartoli Langeli, Nolens intestatus decedere - Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale (Atti
dell’ incontro di Studio, Perugia 1983), Perugia 1985; Giuseppina de Sandre Gasparini, Il Francescanesimo a
Venedig begann und in den dortigen Bettelordenskirchen56, aber auch in Verona57 oder in
Treviso58, mit traumhaften Beispielen vertreten ist.
Wünschenswert wäre ein ausführlicher Blick auf die Situation der Bildkünste59 in Verona
im frühen 15. Jahrhundert sowie eine Einordnung des Denkmals in die Geschichte der
Grabmal- und Wanddenkmalkunst des Veneto60 in der Spätgotik. Einen farbigen Eindruck
von der Vielfalt solcher Werke in dieser Kunstlandschaft vermittelt ein vorzügliches
Handbuch61, das anläßlich der großen Pisanello-Ausstellung 1996 in Verona erschien.
III.
Brauchbar informiert sind wir über das Leben des Niccolö Brenzoni, der bisher
namengebend für unser Kunstwerk war. Er kam als Niccolö di Rangonis oder Nicolo de
Rangonis de Brenzono aus dem Örtchen Brenzone am Ostufer des Gardasees nach Verona,
die am nächsten gelegene Großstadt, um dort sein Glück zu machen. In Brenzone war am
Ende des 13. Jahrhunderts ein Benedetto Rangoni Herr oder Verwalter einer Burg, dem ein
Bartolomeo folgte. Dessen Sohn war ein Franceschino, der Vater unseres um 1345 geborenen
Niccolö. Dieser ging zwischen 1367 und 1375 nach Verona, legte den Namen Rangoni ab und
nannte sich seitdem nach seinem Geburtsort. In Verona wurde Niccolö, dem sein Biograph,
der Jurist, Bilderrestaurator und Kunsthistoriker Raffaello Brenzoni (1890-nach 1972)62,
einen „spirito irrequieto, operoso“ bescheinigte, im Dienste etlicher Herren und Äbte als
Eintreiber des Zehnten und mit Geld- und Immobiliengeschäften reich. Bereits seit 1367 war
er mit Maddalena degli Statuti, der Tochter eines für die Skaliger arbeitenden Juristen,
verheiratet, von der er einen Sohn Francesco und eine Tochter Agnese bekam. Als „vir
nobilis“63 bewohnte er ein Haus in der Pfarrei San Pietro Incarnario. Hier diktierte er am 4.
Mai 1422, zwei Monate vor seinem Tod, sein Testament64, das im Archivio di Stato in Verona
aufbewahrt wird.
Das Testament65 hat etliche Merkmale, die einem nordeuropäischen Leser merkwürdig
erscheinen müssen, die aber für italienische Nachlaßverfügungen66 dieser Zeit typisch sind.
56 Zu gemalten Grabmalrahmungen in Venedig vgl. Svenja Frank, Ausmalungen gotischer Kirchen in Venedig
(1370-1500), Diss. TU Berlin 2009, 91-109.
57 Tiziana Franco, Michele Giambono e il monumento a Cortesia Serego in Santa Anastasia a Verona (Ateneo
Veneto 12), Padova 1998.
58 Grabdenkmal des Senators Agostino Onigo (f 1490) in S. Nicolo. Vgl. Luigi Coletti, Catalogo delle Cose
d’Arte e di Antichitä d’Italia - Treviso, Roma 1935, 395-399, Nr. 768; Filippo Trevisani, La datazione del
monumento funebre per Agostino Onigo, in: Pietro Zampetti/Vittorio Sgarbi, Lorenzo Lotto — Atti del convegno
internazionale di studi per il V centenario della nascita, Asolo 1980, Treviso 1981, Bd. 1,49 ff., Bd. 2, Abb. 1.
59 Zum Beispiel auf die Herkunft der Künstler. Die Bildhauer stammten aus der Toskana (Nanni di Bartolo,
Pietro di Nicolo Lamberti, Michele da Firenze), aus Venedig (Jacopo Moranzone), aus der Lombardei (Magister
Albertus), die Maler aus Pisa (Pisanello), aus Zevio bei Verona (Stefano da Verona) und bes. aus Venedig
(Nicolo di Pietro, Michele Giambono, Michelino di Besozzo).
60 Vgl. Wolters 1976, 76-77; Giuliana Ericani, La scultura a Verona al tempo di Pisanello, in: Kat. Pisanello,
Verona 1996,331 ff.
61 Filippa M. Aliberti Gaudioso (Hg.): Pisanello -1 Luoghi del Gotico Internazionale nel Veneto, Milano 1996.
62 Brenzoni 1932, bes. 249-251 und 261 ff.
63 Brenzoni 1932, 258.
64 Archivio Notarile, Ufficio del registro, Testamenti, 1422, M. 14, n. 45. Er starb vor dem 6. Juli dieses Jahres:
Biadego 1908/09,242-243; Brenzoni 1932,263; Ders. 1952, 141 (mit falschem Datum); Dominique Cordellier
u. a., Documenti e Fonti su Pisanello (1395-1581 circa), in: Verona lllustrata - Rivista del Museo di
Castelvecchio 8 (1995) 18/19, Nr. 3.
65 Für eine Kopie des sieben Seiten langen Originals danke ich dem Direktor des Archivs Dr. Roberto Mazzei
und seiner Mitarbeiterin Silvia lovane.
66 Testamente sind seit einigen Jahren ein Schwerpunkt der Mittelalterforschung - so auch in Verona. Vgl. u. a.:
Attilio Bartoli Langeli, Nolens intestatus decedere - Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale (Atti
dell’ incontro di Studio, Perugia 1983), Perugia 1985; Giuseppina de Sandre Gasparini, Il Francescanesimo a