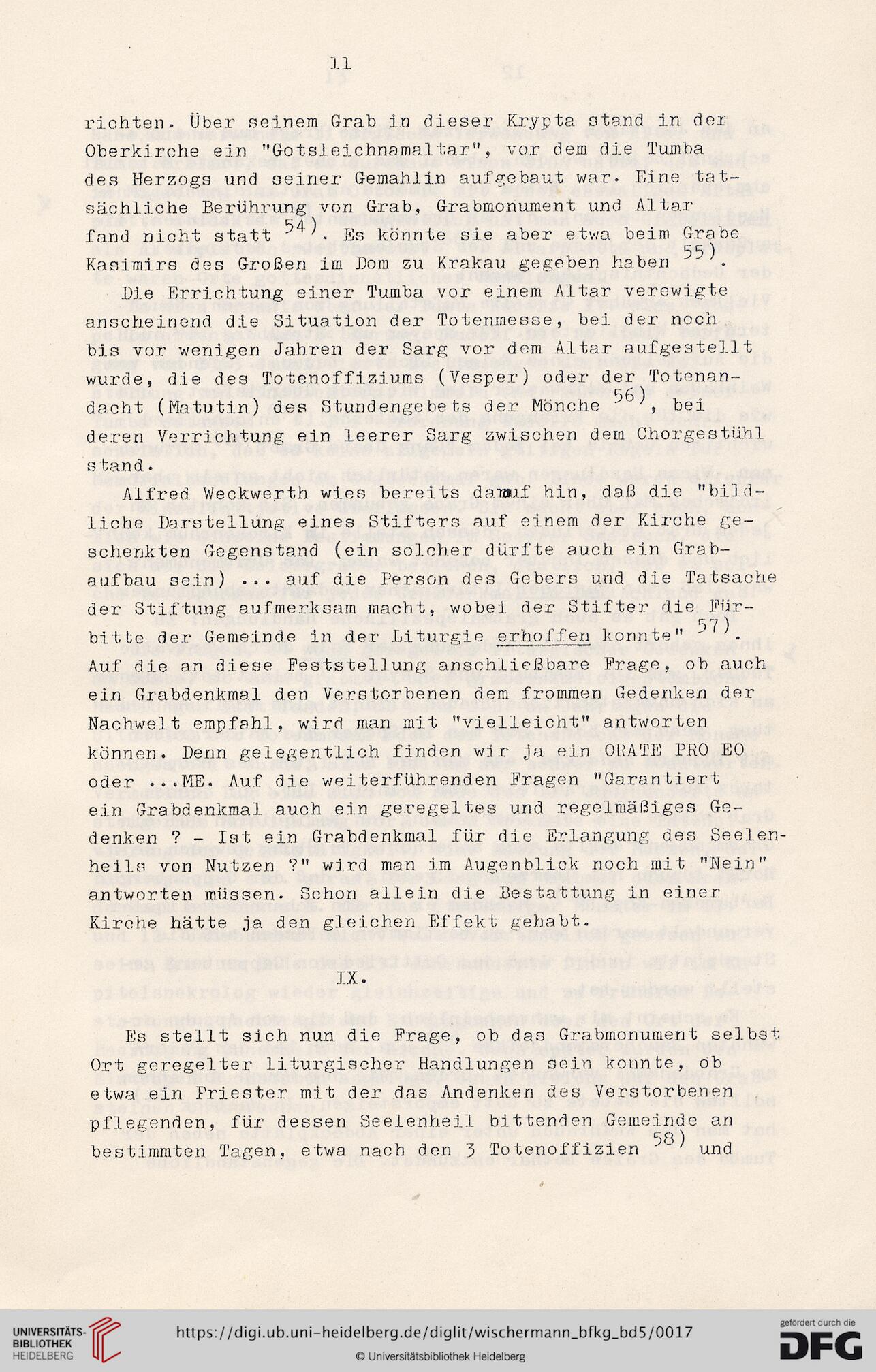11
richten. Uber seinem Grab in dieser Krypta stand in der
Oberkirche ein "Gotsleichnaroaltar", vor dem die Tumba
des Herzogs und seiner Gemahlin aufgebaut war. Eine tat-
sächliche Berührung von Grab, Grabmonument und Altar
54 )
fand nicht statt '. Es könnte sie aber etwa beim Grabe
55 )
Kasimirs des Großen im Dom zu Krakau gegeben haben .
Die Errichtung einer' Tumba vor einem Altar verewigte
anscheinend die Situation der Totenmesse, bei der noch
bis vor wenigen Jahren der Sarg vor dem Altar aufgestellt
wurde, die des Totenoffiziums (Vesper) oder der Totenan-
dacht (Matutin) des Stundengebets der Mönche ^6), ^ei
deren Verrichtung ein leerer Sarg zwischen dem Chorgestühl
stand.
Alfred Weckweyth wies bereits darauf hin, daß die "bild-
liche Darstellung eines Stifters auf einem der Kirche ge-
schenkten Gegenstand (ein solcher dürfte auch ein Grab-
aufbau sein) ... auf die Person des Gebers und die Tatsache
der Stiftung aufmerksam macht, wobei der Stifter die Für-
bitte der Gemeinde in der Liturgie erhoffen konnte" .
Auf die an diese Feststellung anschließbare Frage, ob auch
ein Grabdenkmal den Verstorbenen dem frommen Gedenken der
Nachwelt empfahl, wird man mit "vielleicht" antworten
können. Denn gelegentlich finden wir ja ein ORATE PRO EO
oder ...ME. Auf die weiterführenden Fragen "Garantiert
ein Grabdenkmal auch ein geregeltes und regelmäßiges Ge-
denken ? - Ist ein Grabdenkmal für die Erlangung des Seelen-
heils von Nutzen ?" wird man im Augenblick noch mit "Nein"
antworten müssen. Schon allein die Bestattung in einer
Kirche hätte ja den gleichen Effekt gehabt.
IX.
Es stellt sich nun die Frage, ob das Grabmonument selbst
Ort geregelter liturgischer Handlungen sein konnte, ob
etwa ein Priester mit der das Andenken des Verstorbenen
pflegenden, für dessen Seelenheil bittenden Gemeinde an
bestimmten Tagen, etwa nach den 3 Totenoffizien und
richten. Uber seinem Grab in dieser Krypta stand in der
Oberkirche ein "Gotsleichnaroaltar", vor dem die Tumba
des Herzogs und seiner Gemahlin aufgebaut war. Eine tat-
sächliche Berührung von Grab, Grabmonument und Altar
54 )
fand nicht statt '. Es könnte sie aber etwa beim Grabe
55 )
Kasimirs des Großen im Dom zu Krakau gegeben haben .
Die Errichtung einer' Tumba vor einem Altar verewigte
anscheinend die Situation der Totenmesse, bei der noch
bis vor wenigen Jahren der Sarg vor dem Altar aufgestellt
wurde, die des Totenoffiziums (Vesper) oder der Totenan-
dacht (Matutin) des Stundengebets der Mönche ^6), ^ei
deren Verrichtung ein leerer Sarg zwischen dem Chorgestühl
stand.
Alfred Weckweyth wies bereits darauf hin, daß die "bild-
liche Darstellung eines Stifters auf einem der Kirche ge-
schenkten Gegenstand (ein solcher dürfte auch ein Grab-
aufbau sein) ... auf die Person des Gebers und die Tatsache
der Stiftung aufmerksam macht, wobei der Stifter die Für-
bitte der Gemeinde in der Liturgie erhoffen konnte" .
Auf die an diese Feststellung anschließbare Frage, ob auch
ein Grabdenkmal den Verstorbenen dem frommen Gedenken der
Nachwelt empfahl, wird man mit "vielleicht" antworten
können. Denn gelegentlich finden wir ja ein ORATE PRO EO
oder ...ME. Auf die weiterführenden Fragen "Garantiert
ein Grabdenkmal auch ein geregeltes und regelmäßiges Ge-
denken ? - Ist ein Grabdenkmal für die Erlangung des Seelen-
heils von Nutzen ?" wird man im Augenblick noch mit "Nein"
antworten müssen. Schon allein die Bestattung in einer
Kirche hätte ja den gleichen Effekt gehabt.
IX.
Es stellt sich nun die Frage, ob das Grabmonument selbst
Ort geregelter liturgischer Handlungen sein konnte, ob
etwa ein Priester mit der das Andenken des Verstorbenen
pflegenden, für dessen Seelenheil bittenden Gemeinde an
bestimmten Tagen, etwa nach den 3 Totenoffizien und