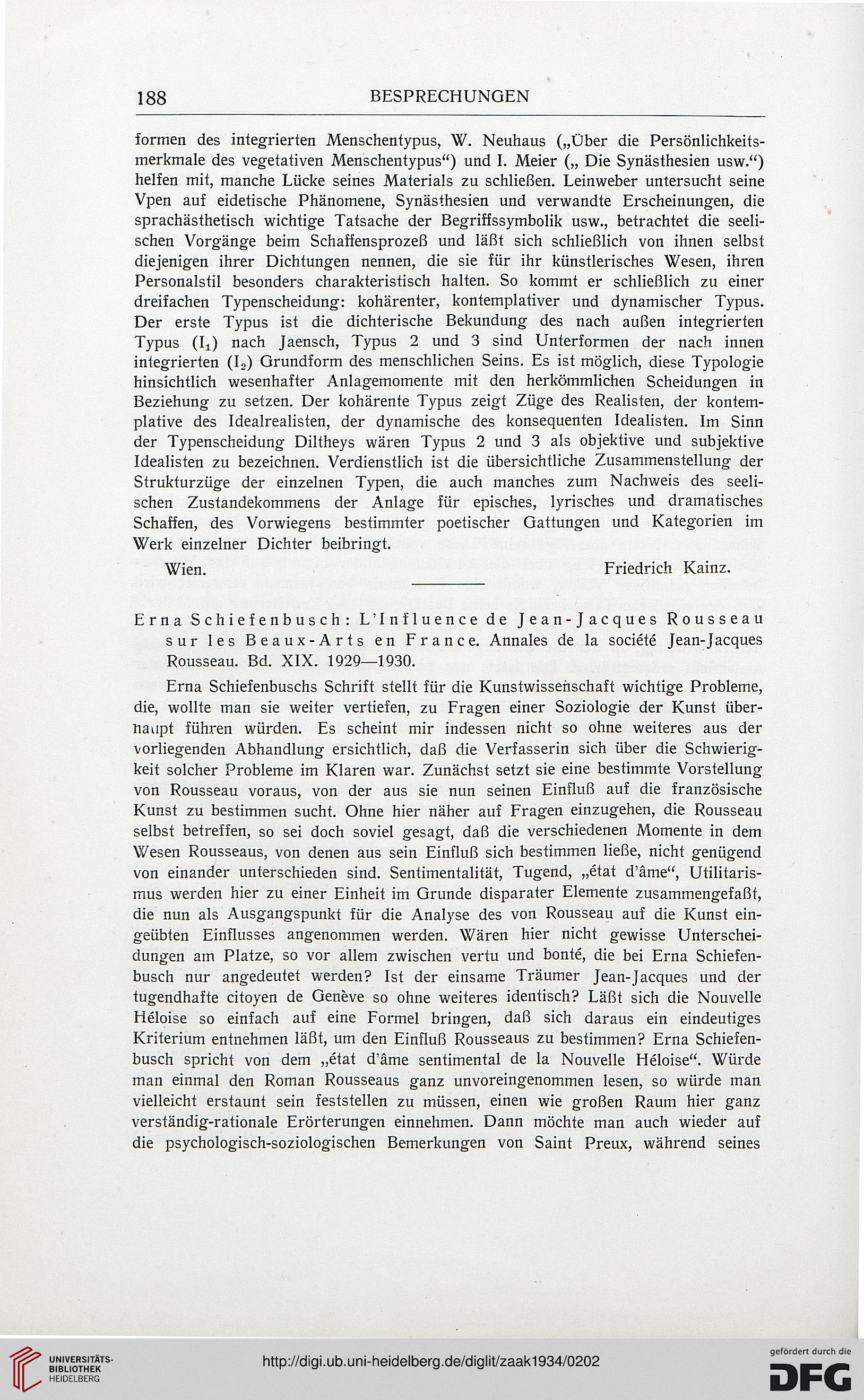188
BESPRECHUNGEN
formen des integrierten Menschentypus, W. Neuhaus („Über die Persönlichkeits-
merkmale des vegetativen Menschentypus") und I. Meier („ Die Synästhesien usw.")
helfen mit, manche Lücke seines Materials zu schließen. Leinweber untersucht seine
Vpen auf eidetische Phänomene, Synästhesien und verwandte Erscheinungen, die
sprachästhetisch wichtige Tatsache der Begriffssymbolik usw., betrachtet die seeli-
schen Vorgänge beim Schaffensprozeß und läßt sich schließlich von ihnen selbst
diejenigen ihrer Dichtungen nennen, die sie für ihr künstlerisches Wesen, ihren
Personalstil besonders charakteristisch halten. So kommt er schließlich zu einer
dreifachen Typenscheidung: kohärenter, kontemplativer und dynamischer Typus.
Der erste Typus ist die dichterische Bekundung des nach außen integrierten
Typus (Ii) nach Jaensch, Typus 2 und 3 sind Unterformen der nach innen
integrierten (I2) Grundform des menschlichen Seins. Es ist möglich, diese Typologie
hinsichtlich wesenhafter Anlagemomente mit den herkömmlichen Scheidungen in
Beziehung zu setzen. Der kohärente Typus zeigt Züge des Realisten, der kontem-
plative des Idealrealisten, der dynamische des konsequenten Idealisten. Im Sinn
der Typenscheidung Diltheys wären Typus 2 und 3 als objektive und subjektive
Idealisten zu bezeichnen. Verdienstlich ist die übersichtliche Zusammenstellung der
Strukturzüge der einzelnen Typen, die auch manches zum Nachweis des seeli-
schen Zustandekommens der Anlage für episches, lyrisches und dramatisches
Schaffen, des Vorwiegens bestimmter poetischer Gattungen und Kategorien im
Werk einzelner Dichter beibringt.
Wien. Friedrich Kainz.
Erna Schiefenbusch: L'Influence de Jean-Jacques Rousseau
sur les Beaux-Arts en France. Annales de la societe Jean-Jacques
Rousseau. Bd. XIX. 1929—1930.
Erna Schiefenbuschs Schrift stellt für die Kunstwissenschaft wichtige Probleme,
die, wollte man sie weiter vertiefen, zu Fragen einer Soziologie der Kunst über-
haupt führen würden. Es scheint mir indessen nicht so ohne weiteres aus der
vorliegenden Abhandlung ersichtlich, daß die Verfasserin sich über die Schwierig-
keit solcher Probleme im Klaren war. Zunächst setzt sie eine bestimmte Vorstellung
von Rousseau voraus, von der aus sie nun seinen Einfluß auf die französische
Kunst zu bestimmen sucht. Ohne hier näher auf Fragen einzugehen, die Rousseau
selbst betreffen, so sei doch soviel gesagt, daß die verschiedenen Momente in dem
Wesen Rousseaus, von denen aus sein Einfluß sich bestimmen ließe, nicht genügend
von einander unterschieden sind. Sentimentalität, Tugend, „etat d'äme", Utilitaris-
mus werden hier zu einer Einheit im Grunde disparater Elemente zusammengefaßt,
die nun als Ausgangspunkt für die Analyse des von Rousseau auf die Kunst ein-
geübten Einflusses angenommen werden. Wären hier nicht gewisse Unterschei-
dungen am Platze, so vor allem zwischen vertu und bonte, die bei Erna Schiefen-
busch nur angedeutet werden? Ist der einsame Träumer Jean-Jacques und der
tugendhafte citoyen de Geneve so ohne weiteres identisch? Läßt sich die Nouvelle
Heloise so einfach auf eine Formel bringen, daß sich daraus ein eindeutiges
Kriterium entnehmen läßt, um den Einfluß Rousseaus zu bestimmen? Erna Schiefen-
busch spricht von dem „etat d'äme sentimental de la Nouvelle Heloise". Würde
man einmal den Roman Rousseaus ganz unvoreingenommen lesen, so würde man
vielleicht erstaunt sein feststellen zu müssen, einen wie großen Raum hier ganz
verständig-rationale Erörterungen einnehmen. Dann möchte man auch wieder auf
die psychologisch-soziologischen Bemerkungen von Saint Preux, während seines
BESPRECHUNGEN
formen des integrierten Menschentypus, W. Neuhaus („Über die Persönlichkeits-
merkmale des vegetativen Menschentypus") und I. Meier („ Die Synästhesien usw.")
helfen mit, manche Lücke seines Materials zu schließen. Leinweber untersucht seine
Vpen auf eidetische Phänomene, Synästhesien und verwandte Erscheinungen, die
sprachästhetisch wichtige Tatsache der Begriffssymbolik usw., betrachtet die seeli-
schen Vorgänge beim Schaffensprozeß und läßt sich schließlich von ihnen selbst
diejenigen ihrer Dichtungen nennen, die sie für ihr künstlerisches Wesen, ihren
Personalstil besonders charakteristisch halten. So kommt er schließlich zu einer
dreifachen Typenscheidung: kohärenter, kontemplativer und dynamischer Typus.
Der erste Typus ist die dichterische Bekundung des nach außen integrierten
Typus (Ii) nach Jaensch, Typus 2 und 3 sind Unterformen der nach innen
integrierten (I2) Grundform des menschlichen Seins. Es ist möglich, diese Typologie
hinsichtlich wesenhafter Anlagemomente mit den herkömmlichen Scheidungen in
Beziehung zu setzen. Der kohärente Typus zeigt Züge des Realisten, der kontem-
plative des Idealrealisten, der dynamische des konsequenten Idealisten. Im Sinn
der Typenscheidung Diltheys wären Typus 2 und 3 als objektive und subjektive
Idealisten zu bezeichnen. Verdienstlich ist die übersichtliche Zusammenstellung der
Strukturzüge der einzelnen Typen, die auch manches zum Nachweis des seeli-
schen Zustandekommens der Anlage für episches, lyrisches und dramatisches
Schaffen, des Vorwiegens bestimmter poetischer Gattungen und Kategorien im
Werk einzelner Dichter beibringt.
Wien. Friedrich Kainz.
Erna Schiefenbusch: L'Influence de Jean-Jacques Rousseau
sur les Beaux-Arts en France. Annales de la societe Jean-Jacques
Rousseau. Bd. XIX. 1929—1930.
Erna Schiefenbuschs Schrift stellt für die Kunstwissenschaft wichtige Probleme,
die, wollte man sie weiter vertiefen, zu Fragen einer Soziologie der Kunst über-
haupt führen würden. Es scheint mir indessen nicht so ohne weiteres aus der
vorliegenden Abhandlung ersichtlich, daß die Verfasserin sich über die Schwierig-
keit solcher Probleme im Klaren war. Zunächst setzt sie eine bestimmte Vorstellung
von Rousseau voraus, von der aus sie nun seinen Einfluß auf die französische
Kunst zu bestimmen sucht. Ohne hier näher auf Fragen einzugehen, die Rousseau
selbst betreffen, so sei doch soviel gesagt, daß die verschiedenen Momente in dem
Wesen Rousseaus, von denen aus sein Einfluß sich bestimmen ließe, nicht genügend
von einander unterschieden sind. Sentimentalität, Tugend, „etat d'äme", Utilitaris-
mus werden hier zu einer Einheit im Grunde disparater Elemente zusammengefaßt,
die nun als Ausgangspunkt für die Analyse des von Rousseau auf die Kunst ein-
geübten Einflusses angenommen werden. Wären hier nicht gewisse Unterschei-
dungen am Platze, so vor allem zwischen vertu und bonte, die bei Erna Schiefen-
busch nur angedeutet werden? Ist der einsame Träumer Jean-Jacques und der
tugendhafte citoyen de Geneve so ohne weiteres identisch? Läßt sich die Nouvelle
Heloise so einfach auf eine Formel bringen, daß sich daraus ein eindeutiges
Kriterium entnehmen läßt, um den Einfluß Rousseaus zu bestimmen? Erna Schiefen-
busch spricht von dem „etat d'äme sentimental de la Nouvelle Heloise". Würde
man einmal den Roman Rousseaus ganz unvoreingenommen lesen, so würde man
vielleicht erstaunt sein feststellen zu müssen, einen wie großen Raum hier ganz
verständig-rationale Erörterungen einnehmen. Dann möchte man auch wieder auf
die psychologisch-soziologischen Bemerkungen von Saint Preux, während seines