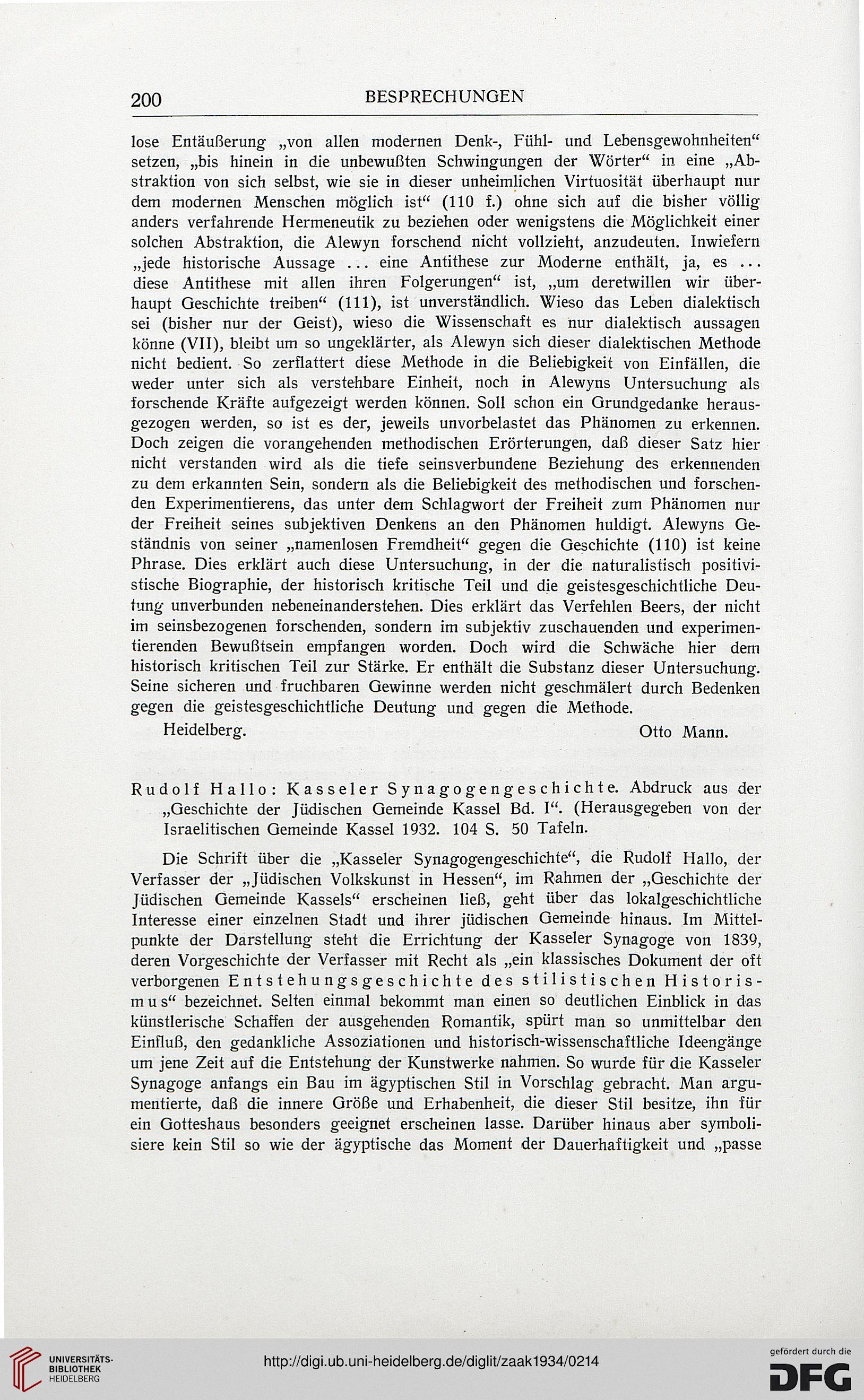200
BESPRECHUNGEN
lose Entäußerung „von allen modernen Denk-, Fühl- und Lebensgewohnheiten"
setzen, „bis hinein in die unbewußten Schwingungen der Wörter" in eine „Ab-
straktion von sich selbst, wie sie in dieser unheimlichen Virtuosität überhaupt nur
dem modernen Menschen möglich ist" (110 f.) ohne sich auf die bisher völlig
anders verfahrende Hermeneutik zu beziehen oder wenigstens die Möglichkeit einer
solchen Abstraktion, die Alewyn forschend nicht vollzieht, anzudeuten. Inwiefern
„jede historische Aussage . .. eine Antithese zur Moderne enthält, ja, es ...
diese Antithese mit allen ihren Folgerungen" ist, „um deretwillen wir über-
haupt Geschichte treiben" (111), ist unverständlich. Wieso das Leben dialektisch
sei (bisher nur der Geist), wieso die Wissenschaft es nur dialektisch aussagen
könne (VII), bleibt um so ungeklärter, als Alewyn sich dieser dialektischen Methode
nicht bedient. So zerflattert diese Methode in die Beliebigkeit von Einfällen, die
weder unter sich als verstehbare Einheit, noch in Alewyns Untersuchung als
forschende Kräfte aufgezeigt werden können. Soll schon ein Grundgedanke heraus-
gezogen werden, so ist es der, jeweils unvorbelastet das Phänomen zu erkennen.
Doch zeigen die vorangehenden methodischen Erörterungen, daß dieser Satz hier
nicht verstanden wird als die tiefe seinsverbundene Beziehung des erkennenden
zu dem erkannten Sein, sondern als die Beliebigkeit des methodischen und forschen-
den Experimentierens, das unter dem Schlagwort der Freiheit zum Phänomen nur
der Freiheit seines subjektiven Denkens an den Phänomen huldigt. Alewyns Ge-
ständnis von seiner „namenlosen Fremdheit" gegen die Geschichte (110) ist keine
Phrase. Dies erklärt auch diese Untersuchung, in der die naturalistisch positivi-
stische Biographie, der historisch kritische Teil und die geistesgeschichtliche Deu-
tung unverbunden nebeneinanderstehen. Dies erklärt das Verfehlen Beers, der nicht
im seinsbezogenen forschenden, sondern im subjektiv zuschauenden und experimen-
tierenden Bewußtsein empfangen worden. Doch wird die Schwäche hier dem
historisch kritischen Teil zur Stärke. Er enthält die Substanz dieser Untersuchung.
Seine sicheren und fruchbaren Gewinne werden nicht geschmälert durch Bedenken
gegen die geistesgeschichtliche Deutung und gegen die Methode.
Heidelberg. Otto Mann.
Rudolf Hallo: Kasseler Synagogengeschichte. Abdruck aus der
„Geschichte der Jüdischen Gemeinde Kassel Bd. I". (Herausgegeben von der
Israelitischen Gemeinde Kassel 1932. 104 S. 50 Tafeln.
Die Schrift über die „Kasseler Synagogengeschichte", die Rudolf Hallo, der
Verfasser der „Jüdischen Volkskunst in Hessen", im Rahmen der „Geschichte der
Jüdischen Gemeinde Kassels" erscheinen ließ, geht über das lokalgeschichtliche
Interesse einer einzelnen Stadt und ihrer jüdischen Gemeinde hinaus. Im Mittel-
punkte der Darstellung steht die Errichtung der Kasseler Synagoge von 1839,
deren Vorgeschichte der Verfasser mit Recht als „ein klassisches Dokument der oft
verborgenen Entstehungsgeschichte des stilistischen Historis-
m u s" bezeichnet. Selten einmal bekommt man einen so deutlichen Einblick in das
künstlerische Schaffen der ausgehenden Romantik, spürt man so unmittelbar den
Einfluß, den gedankliche Assoziationen und historisch-wissenschaftliche Ideengänge
um jene Zeit auf die Entstehung der Kunstwerke nahmen. So wurde für die Kasseler
Synagoge anfangs ein Bau im ägyptischen Stil in Vorschlag gebracht. Man argu-
mentierte, daß die innere Größe und Erhabenheit, die dieser Stil besitze, ihn für
ein Gotteshaus besonders geeignet erscheinen lasse. Darüber hinaus aber symboli-
siere kein Stil so wie der ägyptische das Moment der Dauerhaftigkeit und „passe
BESPRECHUNGEN
lose Entäußerung „von allen modernen Denk-, Fühl- und Lebensgewohnheiten"
setzen, „bis hinein in die unbewußten Schwingungen der Wörter" in eine „Ab-
straktion von sich selbst, wie sie in dieser unheimlichen Virtuosität überhaupt nur
dem modernen Menschen möglich ist" (110 f.) ohne sich auf die bisher völlig
anders verfahrende Hermeneutik zu beziehen oder wenigstens die Möglichkeit einer
solchen Abstraktion, die Alewyn forschend nicht vollzieht, anzudeuten. Inwiefern
„jede historische Aussage . .. eine Antithese zur Moderne enthält, ja, es ...
diese Antithese mit allen ihren Folgerungen" ist, „um deretwillen wir über-
haupt Geschichte treiben" (111), ist unverständlich. Wieso das Leben dialektisch
sei (bisher nur der Geist), wieso die Wissenschaft es nur dialektisch aussagen
könne (VII), bleibt um so ungeklärter, als Alewyn sich dieser dialektischen Methode
nicht bedient. So zerflattert diese Methode in die Beliebigkeit von Einfällen, die
weder unter sich als verstehbare Einheit, noch in Alewyns Untersuchung als
forschende Kräfte aufgezeigt werden können. Soll schon ein Grundgedanke heraus-
gezogen werden, so ist es der, jeweils unvorbelastet das Phänomen zu erkennen.
Doch zeigen die vorangehenden methodischen Erörterungen, daß dieser Satz hier
nicht verstanden wird als die tiefe seinsverbundene Beziehung des erkennenden
zu dem erkannten Sein, sondern als die Beliebigkeit des methodischen und forschen-
den Experimentierens, das unter dem Schlagwort der Freiheit zum Phänomen nur
der Freiheit seines subjektiven Denkens an den Phänomen huldigt. Alewyns Ge-
ständnis von seiner „namenlosen Fremdheit" gegen die Geschichte (110) ist keine
Phrase. Dies erklärt auch diese Untersuchung, in der die naturalistisch positivi-
stische Biographie, der historisch kritische Teil und die geistesgeschichtliche Deu-
tung unverbunden nebeneinanderstehen. Dies erklärt das Verfehlen Beers, der nicht
im seinsbezogenen forschenden, sondern im subjektiv zuschauenden und experimen-
tierenden Bewußtsein empfangen worden. Doch wird die Schwäche hier dem
historisch kritischen Teil zur Stärke. Er enthält die Substanz dieser Untersuchung.
Seine sicheren und fruchbaren Gewinne werden nicht geschmälert durch Bedenken
gegen die geistesgeschichtliche Deutung und gegen die Methode.
Heidelberg. Otto Mann.
Rudolf Hallo: Kasseler Synagogengeschichte. Abdruck aus der
„Geschichte der Jüdischen Gemeinde Kassel Bd. I". (Herausgegeben von der
Israelitischen Gemeinde Kassel 1932. 104 S. 50 Tafeln.
Die Schrift über die „Kasseler Synagogengeschichte", die Rudolf Hallo, der
Verfasser der „Jüdischen Volkskunst in Hessen", im Rahmen der „Geschichte der
Jüdischen Gemeinde Kassels" erscheinen ließ, geht über das lokalgeschichtliche
Interesse einer einzelnen Stadt und ihrer jüdischen Gemeinde hinaus. Im Mittel-
punkte der Darstellung steht die Errichtung der Kasseler Synagoge von 1839,
deren Vorgeschichte der Verfasser mit Recht als „ein klassisches Dokument der oft
verborgenen Entstehungsgeschichte des stilistischen Historis-
m u s" bezeichnet. Selten einmal bekommt man einen so deutlichen Einblick in das
künstlerische Schaffen der ausgehenden Romantik, spürt man so unmittelbar den
Einfluß, den gedankliche Assoziationen und historisch-wissenschaftliche Ideengänge
um jene Zeit auf die Entstehung der Kunstwerke nahmen. So wurde für die Kasseler
Synagoge anfangs ein Bau im ägyptischen Stil in Vorschlag gebracht. Man argu-
mentierte, daß die innere Größe und Erhabenheit, die dieser Stil besitze, ihn für
ein Gotteshaus besonders geeignet erscheinen lasse. Darüber hinaus aber symboli-
siere kein Stil so wie der ägyptische das Moment der Dauerhaftigkeit und „passe