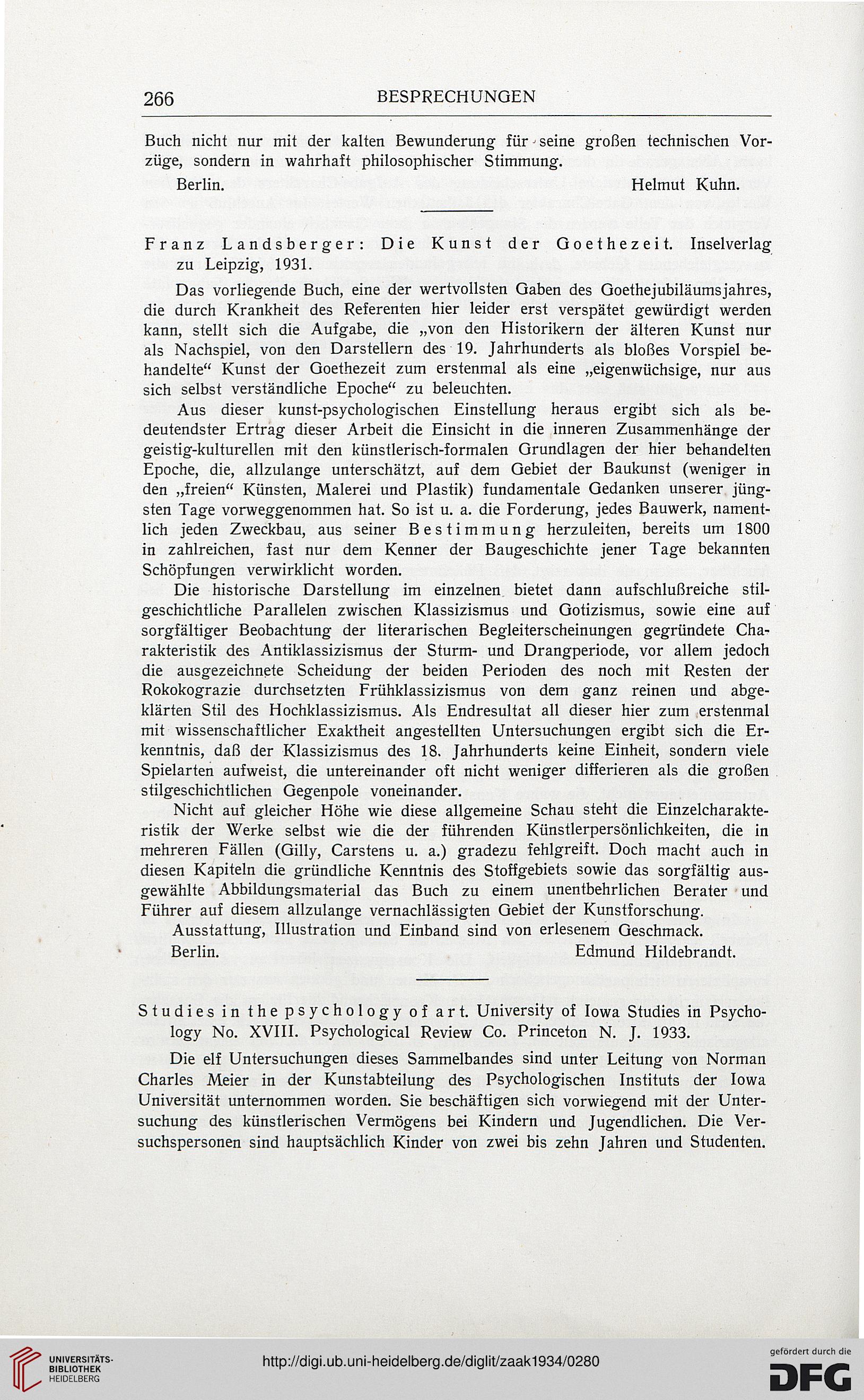266
BESPRECHUNGEN
Buch nicht nur mit der kalten Bewunderung für seine großen technischen Vor-
züge, sondern in wahrhaft philosophischer Stimmung.
Berlin. Helmut Kuhn.
Franz Landsberger: Die Kunst der Goethezeit. Inselverlag
zu Leipzig, 1931.
Das vorliegende Buch, eine der wertvollsten Gaben des Goethejubiläumsjahres,
die durch Krankheit des Referenten hier leider erst verspätet gewürdigt werden
kann, stellt sich die Aufgabe, die „von den Historikern der älteren Kunst nur
als Nachspiel, von den Darstellern des 19. Jahrhunderts als bloßes Vorspiel be-
handelte" Kunst der Goethezeit zum erstenmal als eine „eigenwüchsige, nur aus
sich selbst verständliche Epoche" zu beleuchten.
Aus dieser kunst-psychologischen Einstellung heraus ergibt sich als be-
deutendster Ertrag dieser Arbeit die Einsicht in die inneren Zusammenhänge der
geistig-kulturellen mit den künstlerisch-formalen Grundlagen der hier behandelten
Epoche, die, allzulange unterschätzt, auf dem Gebiet der Baukunst (weniger in
den „freien" Künsten, Malerei und Plastik) fundamentale Gedanken unserer jüng-
sten Tage vorweggenommen hat. So ist u. a. die Forderung, jedes Bauwerk, nament-
lich jeden Zweckbau, aus seiner Bestimmung herzuleiten, bereits um 1800
in zahlreichen, fast nur dem Kenner der Baugeschichte jener Tage bekannten
Schöpfungen verwirklicht worden.
Die historische Darstellung im einzelnen bietet dann aufschlußreiche stil-
geschichtliche Parallelen zwischen Klassizismus und Gotizismus, sowie eine auf
sorgfältiger Beobachtung der literarischen Begleiterscheinungen gegründete Cha-
rakteristik des Antiklassizismus der Sturm- und Drangperiode, vor allem jedoch
die ausgezeichnete Scheidung der beiden Perioden des noch mit Resten der
Rokokograzie durchsetzten Frühklassizismus von dem ganz reinen und abge-
klärten Stil des Hochklassizismus. Als Endresultat all dieser hier zum erstenmal
mit wissenschaftlicher Exaktheit angestellten Untersuchungen ergibt sich die Er-
kenntnis, daß der Klassizismus des 18. Jahrhunderts keine Einheit, sondern viele
Spielarten aufweist, die untereinander oft nicht weniger differieren als die großen
stilgeschichtlichen Gegenpole voneinander.
Nicht auf gleicher Höhe wie diese allgemeine Schau steht die Einzelcharakte-
ristik der Werke selbst wie die der führenden Künstlerpersönlichkeiten, die in
mehreren Fällen (Gilly, Carstens u. a.) gradezu fehlgreift. Doch macht auch in
diesen Kapiteln die gründliche Kenntnis des Stoffgebiets sowie das sorgfältig aus-
gewählte Abbildungsmaterial das Buch zu einem unentbehrlichen Berater und
Führer auf diesem allzulange vernachlässigten Gebiet der Kunstforschung.
Ausstattung, Illustration und Einband sind von erlesenem Geschmack.
Berlin. Edmund Hildebrandt.
Studies in the psychology of art. University of Iowa Studies in Psycho-
logy No. XVIII. Psychological Review Co. Princeton N. J. 1933.
Die elf Untersuchungen dieses Sammelbandes sind unter Leitung von Norman
Charles Meier in der Kunstabteilung des Psychologischen Instituts der Iowa
Universität unternommen worden. Sie beschäftigen sich vorwiegend mit der Unter-
suchung des künstlerischen Vermögens bei Kindern und Jugendlichen. Die Ver-
suchspersonen sind hauptsächlich Kinder von zwei bis zehn Jahren und Studenten.
BESPRECHUNGEN
Buch nicht nur mit der kalten Bewunderung für seine großen technischen Vor-
züge, sondern in wahrhaft philosophischer Stimmung.
Berlin. Helmut Kuhn.
Franz Landsberger: Die Kunst der Goethezeit. Inselverlag
zu Leipzig, 1931.
Das vorliegende Buch, eine der wertvollsten Gaben des Goethejubiläumsjahres,
die durch Krankheit des Referenten hier leider erst verspätet gewürdigt werden
kann, stellt sich die Aufgabe, die „von den Historikern der älteren Kunst nur
als Nachspiel, von den Darstellern des 19. Jahrhunderts als bloßes Vorspiel be-
handelte" Kunst der Goethezeit zum erstenmal als eine „eigenwüchsige, nur aus
sich selbst verständliche Epoche" zu beleuchten.
Aus dieser kunst-psychologischen Einstellung heraus ergibt sich als be-
deutendster Ertrag dieser Arbeit die Einsicht in die inneren Zusammenhänge der
geistig-kulturellen mit den künstlerisch-formalen Grundlagen der hier behandelten
Epoche, die, allzulange unterschätzt, auf dem Gebiet der Baukunst (weniger in
den „freien" Künsten, Malerei und Plastik) fundamentale Gedanken unserer jüng-
sten Tage vorweggenommen hat. So ist u. a. die Forderung, jedes Bauwerk, nament-
lich jeden Zweckbau, aus seiner Bestimmung herzuleiten, bereits um 1800
in zahlreichen, fast nur dem Kenner der Baugeschichte jener Tage bekannten
Schöpfungen verwirklicht worden.
Die historische Darstellung im einzelnen bietet dann aufschlußreiche stil-
geschichtliche Parallelen zwischen Klassizismus und Gotizismus, sowie eine auf
sorgfältiger Beobachtung der literarischen Begleiterscheinungen gegründete Cha-
rakteristik des Antiklassizismus der Sturm- und Drangperiode, vor allem jedoch
die ausgezeichnete Scheidung der beiden Perioden des noch mit Resten der
Rokokograzie durchsetzten Frühklassizismus von dem ganz reinen und abge-
klärten Stil des Hochklassizismus. Als Endresultat all dieser hier zum erstenmal
mit wissenschaftlicher Exaktheit angestellten Untersuchungen ergibt sich die Er-
kenntnis, daß der Klassizismus des 18. Jahrhunderts keine Einheit, sondern viele
Spielarten aufweist, die untereinander oft nicht weniger differieren als die großen
stilgeschichtlichen Gegenpole voneinander.
Nicht auf gleicher Höhe wie diese allgemeine Schau steht die Einzelcharakte-
ristik der Werke selbst wie die der führenden Künstlerpersönlichkeiten, die in
mehreren Fällen (Gilly, Carstens u. a.) gradezu fehlgreift. Doch macht auch in
diesen Kapiteln die gründliche Kenntnis des Stoffgebiets sowie das sorgfältig aus-
gewählte Abbildungsmaterial das Buch zu einem unentbehrlichen Berater und
Führer auf diesem allzulange vernachlässigten Gebiet der Kunstforschung.
Ausstattung, Illustration und Einband sind von erlesenem Geschmack.
Berlin. Edmund Hildebrandt.
Studies in the psychology of art. University of Iowa Studies in Psycho-
logy No. XVIII. Psychological Review Co. Princeton N. J. 1933.
Die elf Untersuchungen dieses Sammelbandes sind unter Leitung von Norman
Charles Meier in der Kunstabteilung des Psychologischen Instituts der Iowa
Universität unternommen worden. Sie beschäftigen sich vorwiegend mit der Unter-
suchung des künstlerischen Vermögens bei Kindern und Jugendlichen. Die Ver-
suchspersonen sind hauptsächlich Kinder von zwei bis zehn Jahren und Studenten.