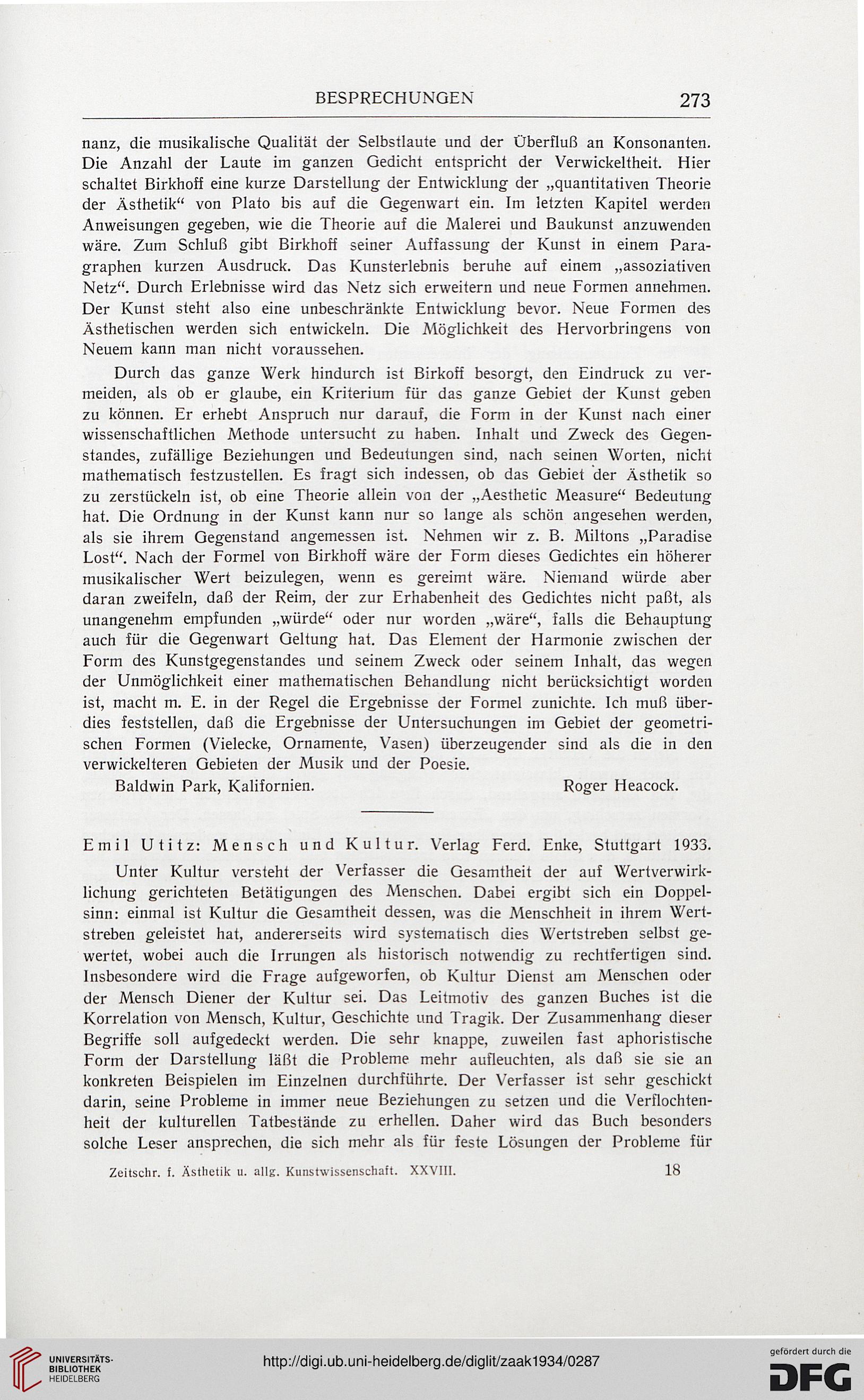BESPRECHUNGEN
273
nanz, die musikalische Qualität der Selbstlaute und der Überfluß an Konsonanten.
Die Anzahl der Laute im ganzen Gedicht entspricht der Verwickeltheit. Hier
schaltet Birkhoff eine kurze Darstellung der Entwicklung der „quantitativen Theorie
der Ästhetik" von Plato bis auf die Gegenwart ein. Im letzten Kapitel werden
Anweisungen gegeben, wie die Theorie auf die Malerei und Baukunst anzuwenden
wäre. Zum Schluß gibt Birkhoff seiner Auffassung der Kunst in einem Para-
graphen kurzen Ausdruck. Das Kunsterlebnis beruhe auf einem „assoziativen
Netz". Durch Erlebnisse wird das Netz sich erweitern und neue Formen annehmen.
Der Kunst steht also eine unbeschränkte Entwicklung bevor. Neue Formen des
Ästhetischen werden sich entwickeln. Die Möglichkeit des Hervorbringens von
Neuem kann man nicht voraussehen.
Durch das ganze Werk hindurch ist Birkoff besorgt, den Eindruck zu ver-
meiden, als ob er glaube, ein Kriterium für das ganze Gebiet der Kunst geben
zu können. Er erhebt Anspruch nur darauf, die Form in der Kunst nach einer
wissenschaftlichen Methode untersucht zu haben. Inhalt und Zweck des Gegen-
standes, zufällige Beziehungen und Bedeutungen sind, nach seinen Worten, nicht
mathematisch festzustellen. Es fragt sich indessen, ob das Gebiet der Ästhetik so
zu zerstückeln ist, ob eine Theorie allein von der „Aesthetic Measure" Bedeutung
hat. Die Ordnung in der Kunst kann nur so lange als schön angesehen werden,
als sie ihrem Gegenstand angemessen ist. Nehmen wir z. B. Miltons „Paradise
Lost". Nach der Formel von Birkhoff wäre der Form dieses Gedichtes ein höherer
musikalischer Wert beizulegen, wenn es gereimt wäre. Niemand würde aber
daran zweifeln, daß der Reim, der zur Erhabenheit des Gedichtes nicht paßt, als
unangenehm empfunden „würde" oder nur worden „wäre", falls die Behauptung
auch für die Gegenwart Geltung hat. Das Element der Harmonie zwischen der
Form des Kunstgegenstandes und seinem Zweck oder seinem Inhalt, das wegen
der Unmöglichkeit einer mathematischen Behandlung nicht berücksichtigt worden
ist, macht m. E. in der Regel die Ergebnisse der Formel zunichte. Ich muß über-
dies feststellen, daß die Ergebnisse der Untersuchungen im Gebiet der geometri-
schen Formen (Vielecke, Ornamente, Vasen) überzeugender sind als die in den
verwickeiteren Gebieten der Musik und der Poesie.
Baldwin Park, Kalifornien. Roger Heacock.
Emil Utitz: Mensch und Kultur. Verlag Ferd. Enke, Stuttgart 1933.
Unter Kultur versteht der Verfasser die Gesamtheit der auf Wertverwirk-
lichung gerichteten Betätigungen des Menschen. Dabei ergibt sich ein Doppel-
sinn: einmal ist Kultur die Gesamtheit dessen, was die Menschheit in ihrem Wert-
streben geleistet hat, andererseits wird systematisch dies Wertstreben selbst ge-
wertet, wobei auch die Irrungen als historisch notwendig zu rechtfertigen sind.
Insbesondere wird die Frage aufgeworfen, ob Kultur Dienst am Menschen oder
der Mensch Diener der Kultur sei. Das Leitmotiv des ganzen Buches ist die
Korrelation von Mensch, Kultur, Geschichte und Tragik. Der Zusammenhang dieser
Begriffe soll aufgedeckt werden. Die sehr knappe, zuweilen fast aphoristische
Form der Darstellung läßt die Probleme mehr aufleuchten, als daß sie sie an
konkreten Beispielen im Einzelnen durchführte. Der Verfasser ist sehr geschickt
darin, seine Probleme in immer neue Beziehungen zu setzen und die Verflochten-
heit der kulturellen Tatbestände zu erhellen. Daher wird das Buch besonders
solche Leser ansprechen, die sich mehr als für feste Lösungen der Probleme für
Zcitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXVIII. 18
273
nanz, die musikalische Qualität der Selbstlaute und der Überfluß an Konsonanten.
Die Anzahl der Laute im ganzen Gedicht entspricht der Verwickeltheit. Hier
schaltet Birkhoff eine kurze Darstellung der Entwicklung der „quantitativen Theorie
der Ästhetik" von Plato bis auf die Gegenwart ein. Im letzten Kapitel werden
Anweisungen gegeben, wie die Theorie auf die Malerei und Baukunst anzuwenden
wäre. Zum Schluß gibt Birkhoff seiner Auffassung der Kunst in einem Para-
graphen kurzen Ausdruck. Das Kunsterlebnis beruhe auf einem „assoziativen
Netz". Durch Erlebnisse wird das Netz sich erweitern und neue Formen annehmen.
Der Kunst steht also eine unbeschränkte Entwicklung bevor. Neue Formen des
Ästhetischen werden sich entwickeln. Die Möglichkeit des Hervorbringens von
Neuem kann man nicht voraussehen.
Durch das ganze Werk hindurch ist Birkoff besorgt, den Eindruck zu ver-
meiden, als ob er glaube, ein Kriterium für das ganze Gebiet der Kunst geben
zu können. Er erhebt Anspruch nur darauf, die Form in der Kunst nach einer
wissenschaftlichen Methode untersucht zu haben. Inhalt und Zweck des Gegen-
standes, zufällige Beziehungen und Bedeutungen sind, nach seinen Worten, nicht
mathematisch festzustellen. Es fragt sich indessen, ob das Gebiet der Ästhetik so
zu zerstückeln ist, ob eine Theorie allein von der „Aesthetic Measure" Bedeutung
hat. Die Ordnung in der Kunst kann nur so lange als schön angesehen werden,
als sie ihrem Gegenstand angemessen ist. Nehmen wir z. B. Miltons „Paradise
Lost". Nach der Formel von Birkhoff wäre der Form dieses Gedichtes ein höherer
musikalischer Wert beizulegen, wenn es gereimt wäre. Niemand würde aber
daran zweifeln, daß der Reim, der zur Erhabenheit des Gedichtes nicht paßt, als
unangenehm empfunden „würde" oder nur worden „wäre", falls die Behauptung
auch für die Gegenwart Geltung hat. Das Element der Harmonie zwischen der
Form des Kunstgegenstandes und seinem Zweck oder seinem Inhalt, das wegen
der Unmöglichkeit einer mathematischen Behandlung nicht berücksichtigt worden
ist, macht m. E. in der Regel die Ergebnisse der Formel zunichte. Ich muß über-
dies feststellen, daß die Ergebnisse der Untersuchungen im Gebiet der geometri-
schen Formen (Vielecke, Ornamente, Vasen) überzeugender sind als die in den
verwickeiteren Gebieten der Musik und der Poesie.
Baldwin Park, Kalifornien. Roger Heacock.
Emil Utitz: Mensch und Kultur. Verlag Ferd. Enke, Stuttgart 1933.
Unter Kultur versteht der Verfasser die Gesamtheit der auf Wertverwirk-
lichung gerichteten Betätigungen des Menschen. Dabei ergibt sich ein Doppel-
sinn: einmal ist Kultur die Gesamtheit dessen, was die Menschheit in ihrem Wert-
streben geleistet hat, andererseits wird systematisch dies Wertstreben selbst ge-
wertet, wobei auch die Irrungen als historisch notwendig zu rechtfertigen sind.
Insbesondere wird die Frage aufgeworfen, ob Kultur Dienst am Menschen oder
der Mensch Diener der Kultur sei. Das Leitmotiv des ganzen Buches ist die
Korrelation von Mensch, Kultur, Geschichte und Tragik. Der Zusammenhang dieser
Begriffe soll aufgedeckt werden. Die sehr knappe, zuweilen fast aphoristische
Form der Darstellung läßt die Probleme mehr aufleuchten, als daß sie sie an
konkreten Beispielen im Einzelnen durchführte. Der Verfasser ist sehr geschickt
darin, seine Probleme in immer neue Beziehungen zu setzen und die Verflochten-
heit der kulturellen Tatbestände zu erhellen. Daher wird das Buch besonders
solche Leser ansprechen, die sich mehr als für feste Lösungen der Probleme für
Zcitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXVIII. 18